MEINE HEIMAT
1951
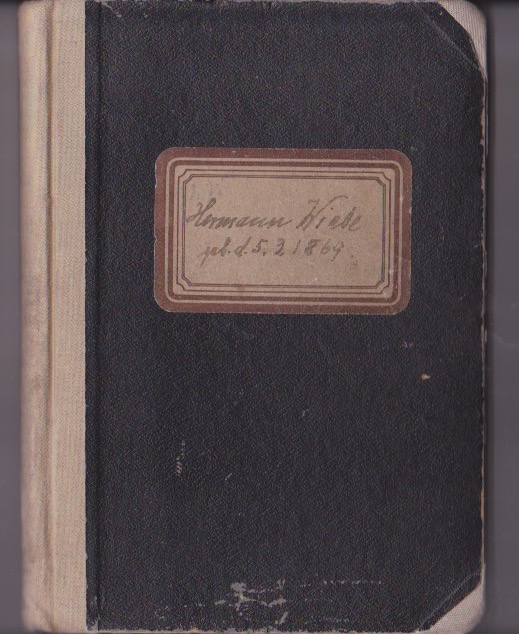
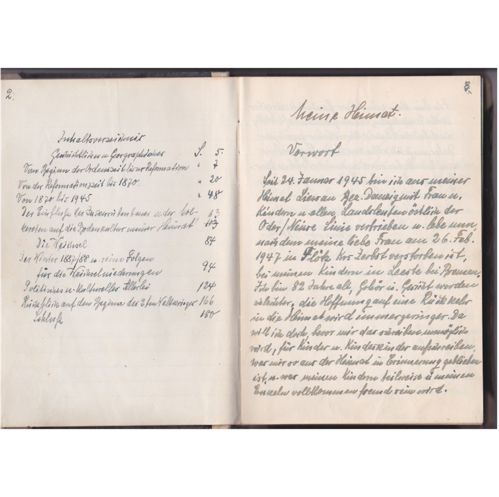
Inhaltsverzeichnis
Geschichtliches u. Geographisches S. 5
Vom Beginn der Ordenszeit bis zur Reformation “ 7
Von der Reformationszeit bis 1870 “ 20
Von 1870 bis 1945 48
Der Einfluss des Zuckerrübenbaues u. der Mol-
kereien auf die Bodenkultur meiner Heimat 63
Die Weichsel 84
Der Winter 1887/88 u. seine Folgen
für die Weichselniederungen 94
Politisches u. kulturelles Allerlei 124
Rückblick auf den Beginn des 2ten Weltkrieges 166
Schluß 180
Meine Heimat.
Vorwort
Seit dem 24. Januar 1945 bin ich aus meiner Heimat Liessau Bez. Danzig mit Frau u. Kindern u. allen Landsleuten östlich der Oder/Neisse Linie vertrieben u. lebe nun, nachdem meine liebe Frau am 26. Feb. in Flötz Krs Zerbst verstorben ist, bei meinen Kindern in Leeste bei Bremen. Ich bin 82 Jahre alt, Gehör u. Gesicht werden schlechter; die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat wird immer geringer. Da will ich doch, bevor mir das schreiben unmöglich wird, für Kinder u. Kindeskinder aufschreiben, was mir so aus der Heimat in Erinnerung geblieben ist, u. was meinen Kindern teilweise u. meinen Enkeln vollkommen fremd sein wird.
Ich bin kein zünftiger Geschichtsschreiber u. die Unterlagen, die ich gesammelt hatte, sind bei der Flucht alle verloren gegangen. Daher muss ich alles aus dem Gedächtnis schreiben. Dabei wird mancher Fehler unterlaufen, wofür ich den Leser jetzt schon um Entschuldigung bitte.
Leeste b. Bremen d. 18. April 1951
Hermann Wiebe
1 Geschichtliches und Geographisches
a. Vor der Besitzergreifung durch den Deutschen Ritterorden 1228
Nach Angaben der deutschen Geschichtsschreibung ist den Phöniziern schon vor Christi Geburt die Bernsteinküste Ost u. Westpreußens bekannt gewesen, u. aus den Urnenfunden, auch in meiner Heimat, dem großen Marienburger Werder, soll sich ergeben haben, daß in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in Ost u. Westpreußen germanische Stämme gelebt haben. Als dieselben in der Völkerwanderungszeit, scheinbar freiwillig, das Land verlassen hatten, rückten slawische Völkerstämme in die leer gewordenen Gebiete. Ob die, östlich der unteren Weichsel 1228 ansässigen, Preußen oder Pruzzen, auch dazu gehörten, weiß ich nicht. Jedenfalls lagen sie mit den slawischen Polen u. Masuren im Streit, der den Herzog von Masowien veranlaßte, den deutschen Ritterorden gegen die, damals noch heidnischen Prußen um Hilfe zu bitten. Aber westlich der Weichsel saßen damals fraglos slawische Stämme u. wahrscheinlich auch bis an die gegenwärtig so heiß umstrittene Oder/Neisse Linie. Aber Pommern u. Schlesien waren ohne Kampf, schon im 15. u. 16. Jahrhundert, deutsch geworden u. das Weichselmündungsgebiet, meine Heimat, ist überhaupt erst durch Eindeichung der Weichsel u. Nogat durch den deutschen Ritterorden im 13. Jahrhundert, bewohnbar geworden u. dann sofort mit deutschen Bauern u. Handwerkern u. Kaufleuten aus Westdeutschland besiedelt worden. Für das Danziger Werder dürfte das gleiche gelten. Westpreußen ist dann von 1310, wo es ohne Krieg durch Verträge mit den pommerellischen Herzögen u. den Markgrafen von Brandenburg, die das Land zeitweise unter ihre Herrschaft gebracht hatten, an den Ritterorden gekommen u. etwa 1460 durch Personalunion an die Krone Polen gekommen u. bis 1772 zusammen mit den östlich der Weichsel u. Nogat gelegenen Kreisen Marienburg, Elbing, Stuhm, Graudenz, Kulm und Thorn (altes Ordensland) dort verblieben.
b. Vom Beginn der Ordenszeit bis zur Reformationszeit u. der Einwanderung der mennonitischen Holländer
Der Orden hatte zunächst schwere Kämpfe mit Prußen und Littauern zu bestehen, umso staunenswerter ist es, daß er neben diesen Kämpfen u. dem Aufbau der Burgen, Städte und Dörfer noch die Eindeichung der Weichsel u. Nogat von Thorn abwärts bis zur Ostsee resp. dem frischen Haff durchführen konnte. Die Deiche werden ja anfänglich vielleicht nur gegen Sommerhochwasser geschützt haben. Aber, wer einmal Erdarbeiten gemacht hat, kann ungefähr ermessen, welche Riesenarbeit an Hand u. Spanndiensten notwendig war, um auch nur Sommerwälle auf diesen vielen hundert Kilometern aufzuschütten. Die Dörfer in den drei Werdern (Danziger Werder, großes Marienburger Werder u. kleines Marienburger Werder, östlich der Nogat) werden im allgemeinen wohl schon im 13. Jahrhundert angelegt sein. Ihre Gründungsurkunde haben sie wohl aber zumeist erst im 14. Jahrhundert u. hauptsächlich in der langen Regierungszeit Winrich von Knipprode’s1350-1383, in der höchsten Blütezeit des Ordens erhalten. Ich habe vor meinem Umzug nach Liessau im Jahre 1909 – 16 Jahre in Brodsack gewohnt, bin in beiden Dörfern zeitweise Gemeindevorsteher gewesen u. habe sowohl die Abschrift der Gründungsurkunde von Brodsack aus dem Jahre 1383 u. von Liessau aus dem Jahre 1352 in den alten Gemeindeacten gefunden u. die Letztere dem Archiv in Danzig zur Aufbewahrung übergeben. Gleichzeitig mit der Gründung u. Besiedlung der Dörfer in den Werdern, wurde auch die Entwässerung geordnet u. ausgebaut.
Es bestanden bis in die neueste Zeit 3 große Entwässerungspolder ziemlich gleichmäßig 22000 ha umfassend. Polder I: Das Linaugebiet, an der einen Seite von der Hauptweichsel u. Elbinger Weichsel begrenzt, auf der andern Seite von den Dörfern Damerau, Gr. Lichtenau(teilweise), Parschau, Trampenau (teilweise), Neuteichsdorf, Bröske, Ladekopp, Orloff, Orlofferfelde, Platenhof, Tiegenhagen, Tiegenort, Grenzdorf, Frisches Haff.
Polder II: Das Gebiet der Jungferschen Lake an der einen Seite begrenzt von der Nogat u. der Elbinger Einlage, an der andern Seite von den Dörfern Blumstein, Herrenhagen, Gr. Lesewitz, Kl. Lesewitz, Lindenau, Niedau, Marienau (teilweise), Rückenau, Fürstenau, Tiegenhof, Petershagen, Altendorf, Stobbendorf.
Polder III: Das Gebiet der Schwente, in ihrem Unterlauf Tiege genannt, umfaßt alle Dörfer u. Ländereien südlich der Eisenbahn Dirschau-Marienburg, sowie die nördlich dieser Bahnstrecke gelegenen Dörfer Liessau, Kl Lichtenau, Altenau, Heubuden, Warnau, Kaminke, Tragheim, Irrgang, Eichwalde, Brodsack, Tannsee,Marienau (teilweise), Leske,Trampenau (teilweise), Trappenfelde, Gr. Lichtenau (teilweise), die Städte Neuteich u. Tiegenhof.An dieser Zugehörigkeit zu den einzelnen Poldern hat sich seit der Ordenszeit kaum etwas geändert; nur in den tiefstgelegenen Ländereien, zunächst dem frischen Haff sind bei den sehr erheblichen Regulierungsarbeiten zwischen den beiden Weltkriegen kleinere Entwässerungspolder den vorseitig genannten 3 großen Poldern zugeschlagen worden. Auch über die Entwässerungskunst der Ordenszeit muß man staunen. Und wie sorgfältig sind die tiefergelegenen Ortschaften davor geschützt worden, daß sie von den höher gelegenen Dörfern nicht überwässert werden! Auch wenn die höher gelegenen Dörfer darunter litten, daß sie ihr Wasser um die tiefer gelegenen herumführen mußten, so durften sie unter keinen Umständen, etwa durch einen kleinen Durchstich, ihr Wasser auf die tiefer gelegene Nachbarschaft loslassen. Die Werderländereien wurden durch zahlreiche Gräben zerschnitten, die wohl in der Ordenszeit sämtlich der Entwässerung dienten, die Wege (Triften) waren mit Kopfweiden bepflanzt, die, besonders nachdem die Wälder mehr u. mehr verschwunden waren, das Brennholz lieferten. Die Höfe sind zur Ordenszeit wohl kaum größer, wie 1-2 culm. Hufen =16 ½-33 ha gewesen. Bauernhäuser u. Höfe aus der Ordenszeit waren im 16. Jahrhundert wohl nicht mehr vorhanden. Einige Dorfkarten aus der Zeit zwischen 1500 u. 1600 waren in den letzten Jahren noch vorhanden, z.B. aus Zugdamm im Danziger, u. aus Gr. Lichtenau u. Gr. Hausdorf im Großen Werder. Sie zeigen fast gleichmäßig kleinere Vorlaubshöfe, die aber die Vorlaube nicht, wie in den Bauten unserer Werder zwischen 1700 – 1850 an der vorderen Langseite, sondern am Giebel zeigen, der nach der Straße gerichtet ist. Holz war damals u. blieb bis in meine Zeit, also bis 1900 das Baumaterial für die Gebäude in den Werdern.
Die Linau, welche die Hauptentwässerungsader des unter I genannten Entwässerungspolder war, hatte verschiedene Nebenflüsse, die der Entwässerung mehrerer Dörfer dienten. Es waren die Gr. Lichtenauer Vorflut u. die Schöneberger Vorflut. In diese Vorfluten mündeten die angrenzenden Dörfer mit ihren Hauptwassergängen, die wiederum die Abwässer der kleineren Gräben aufnahmen. Vorfluten und Hauptwassergänge unterstanden der Aufsicht der Deichgrafen (die seit 1870 Deichhauptmann genannt wurden) u. den ihnen unterstehenden Deichgeschworenen u. in den einzelnen Dörfern den Schulzen (Gemeindevorsteher). Der Boden war durchweg Schwemmland u. ein Geschenk der Weichsel u. lag in verschieden starker Schicht auf früherem Meeresboden. Diese Schicht war in den oberen Teilen der Werder 1-3 Meter dick u. viel stärker als in der sogenannten Niederung, den tiefergelegenen Teilen des Werders. Zumeist waren die Böden durchlässig u. bedurften scheinbar keiner Dränage, die ja auch unbekannt war. Wo es notwendig war, mußten die Gräben enger aneinandergelegt werden.
Der Boden war aber dort nicht so gleichmäßig, wie man nach seiner Entstehung zu urteilen, annehmen mußte. Es gab sehr schwere Lehmböden, Böden mit schönstem mildem Lehmboden, hauptsächlich an den Deichen der Weichsel u. Nogat entlang, die leider oft durch Deichbrüche verwüstet u. mit Stromsand überschüttet u. dadurch mehr oder weniger stark verschlechtert wurden. Aber, abgesehen von den versandeten Flächen, war der ganze Werderboden bestes Weizenland u. muß schon sehr bald nach der Besiedlung reiche Erträge gebracht haben u. die Bauern übermütig gemacht haben, wie verschiedene Erzählungen dartun. Z.B. sollen sich die Gr. Lichtenauer Bauern einmal den Hochmeister aus der benachbarten Marienburg zum Essen eingeladen haben. Als Sitzgelegenheit standen hölzerne Tonnen um den Tisch. Als der Hochmeister diese schäbige Sitzgelegenheit tadelte, erklärten ihm die Bauern, daß er noch nie auf so kostbaren Stühlen gesessen habe. Die Tonnen waren nämlich mit Gold gefüllt. Zur Strafe für diesen Übermut mußten die Bauern einen Turm für die Befestigungswerke der Marienburg, unweit der Nogat, bauen u. den Mörtel dazu anstatt mit Wasser, mit Buttermilch einrühren. Der Turm bekam den Namen „Buttermilchturm“ u. hat den Namen bis auf den heutigen Tag behalten. Er steht, wenn man vom großen Werder über die eiserne Nogatbrücke nach Marienburg fährt, sofort hinter dem Nogatufer, unmittelbar neben dem Bahnkörper, wo der Marienburger Mühlengraben in die Nogat mündet.
Doch bin ich von meiner Beschreibung der Entwässerung des großen Werders etwas abgeschweift. Als 2. Polder der Entwässerung habe ich das Gebiet der Jungferschen Lake genannt. Sie hat ebenfalls mehrere Hauptflüsse oder Nebenflüsse, die hier sonderbarer Weise „Laken“ genannt werden. Da giebt es eine Lindenauer Lake u. eine Schadwalder Lake u. noch mehrere Hauptwassergänge, die sich alle in Krebsfelde am sogenannten Schleusendamm in die Jungfersche Lake ergossen. Letztere mündete bei Jungfer in das frische Haff, während die Linau durch ihren Mündungsarm Preesnick, unweit Tiegenort, in das Haff mündete, u. zwischen beiden Mündungen befand sich noch die Mündung der Tiege oder Schwente. Die Letztere hatte im Oberwerder, nachdem sie sich bei Neuteich in 2 Arme, die große u. kleine Schwente geteilt hatte, von denen die große Schwente über Leske, Tralau, Heubuden, Altmünsterberg u. Wernersdorf bis in die oberste Spitze des Werders reichte u. die kleine Schwente über Trampenau,Trappenfelde bis Altenau reichte u. hier von sogenannten zahlreichen Hauptwassergängen, die dort zusammenliefen, gebildet wurde. Dazu gehörte auch der „hohe Graben“, die Entwässerung für Liessau, der Schmerblockgraben, die Entwässerung für Kl. Lichtenau.
Entwässerung für Altweichsel
Unterhalb Neuteich mündete dann noch die Eichwalder Vorfluth u. die Tannsee-Tragheimer Vorfluth in die ungeteilte Schwente, wie auch die Dörfer hieran u. Tiege durch Wasserschöpfwerke ihr Wasser in die Schwente beförderten. Doch das gehört einem späteren Kapitel an.
1466 war dann das Kapitel „Ordenszeit“ für meine Heimat, das Weichselmündungsgebiet, abgeschloßen. Die stolze Marienburg war den Polen übergeben u. dazu noch weite Gebiete des ursprünglichen Ordenslandes, östlich der Weichsel, zu denen auch meine Heimat, das große Marienburger Werder gehörte. Der Orden hatte seinen Sitz nach Königsberg i.Pr. verlegt und erholte sich in seiner damaligen Gestalt nicht mehr.
Über die Gründe, die zum Zusammenbruch des einst so blühenden Staatswesen führten, ist von berufenen u. unberufenen Geschichtsschreibern viel geschrieben worden. Die Wirtschaftspolitik des Ordens, die von den aufstrebenden größeren Städten des Ordenslandes, besonders Danzig, Elbing u. Thorn, als unlautere Konkurrenz angesehen wurde, die beginnende Zuchtlosigkeit der Ordensritter, die doch das Gelöbnis der Keuschheit u. Ehelosigkeit abgelegt hatten, der mangelhafte Nachwuchs im Kollegium der Ordensbrüder, die Weigerung der im Grunde landfremden Ordensritter, dem Landadel u. den Städten einen entsprechenden Anteil an den Regierungsgeschäften einzuräumen, hatte schon vor der Schlacht von Tannenberg 1410 zu Zwistigkeiten zwischen dem Orden und seinen Untertanen geführt. Und als die Schlacht von Tannenberg dann für den Orden verloren war, brach die Feindschaft gegen den Orden in vielen Städten u. auch bei vielen adligen Herren offen aus. Ja, man sagt, daß diese Feindschaft schon in der Schlacht eine Rolle gespielt habe u. regelrecht Landesverrat verübt worden sei. Jedenfalls begaben sich Städte u. Landadel sehr bald unter den Schutz des Polenkönigs, wohl, weil sie, von der schon damals in Polen herrschenden schlappen Regierungsweise persönliche Vorteile für sich erhofften. Und so kam es dann, daß der vollkommen machtlos gewordene Orden es sich um 1454/1466 gefallen lassen mußte, daß ihm das ganze Land westlich der Weichsel, u. von dem Gebiet östlich der Weichsel, also dem ursprünglichen Ordensland, die Kreise Marienburg, Stuhm, Graudenz, Kulm, Thorn, Elbing u. das Bistum Ermland mit seinem Bischofssitz Frauenburg entrissen wurden. Besonders das letztere Gebiet zerfetzte den Rest des Ordensstaates noch furchtbar. Marienwerder blieb zwar beim Orden, aber die Niederung vor seinen Toren bis zum Weichselstrom wurde polnisch. Tiefe Trauer muß heute noch u. heute erst recht jeden Deutschen erfüllen, der diese Entwickelung mit einigem Interesse verfolgt. Mancher sagt, der Orden hatte seine Aufgabe erfüllt u. mußte abtreten. Das mag richtig sein, aber daß dabei eine Polonisierung mit in Kauf genommen werden mußte, ist uns Deutschen doch noch heute recht schmerzlich. Der Orden bestand dann noch in kümmerlichster Weise, bis er von seinem letzten Hochmeister, Albrecht von Hohenzollern, 1525 zum weltlichen Herzogtum gemacht wurde, das aber noch dem Polenkönig lehnspflichtig wurde.
Von der Reformationszeit bis 1870
In der Reformationszeit hatten sich außer den Lutheranern u. Calvinisten noch einige andere kleinere Gruppen vom Katholizismus getrennt, darunter auch die sogenannten Taufgesinnten, die später Mennoniten genannt wurden. Sie hatten ihren Ursprung in der Schweiz, gewannen aber auch bald in den Niederlanden viele Anhänger. Sie waren sich zwar in dem Bestreben: los von Papsttum! einig, hatten aber einige wesentliche Unterschiede gegenüber den andern Protestanten. Sie verwarfen die Kindertaufe u. lehrten, daß der Mensch erst auf den Namen Christi getauft werden dürfe, wenn er seinen Glauben persönlich bekannt habe, also wenn er soweit erwachsen wäre, daß er die Tragweite seiner Aufnahme in den Bund der Christen begreifen könne, also etwa im Alter von 16-20 Jahren. Dann verwarfen die Mennoniten den Eidschwur u. den Kriegsdienst. Diese 3 Grundsätze haben den Mennoniten viel Anfeindung, nicht nur von den Katholiken, sondern auch von den Lutheranern u. Calvinisten eingetragen. Aber die Glaubenstreue der Mennoniten war bewundernswert. Sie nahmen den Tod auf dem Schaffot oder in den Gewässern der Schweiz u. die Vertreibung aus ihrer Heimat auf sich, aber an ihrem Glauben hielten sie fest. Als um 1550 in den damals spanischen Niederlanden unter Philipp d. II von Spanien erneut große Verfolgungen der Protestanten u. der Mennoniten besonders einsetzten, flohen viele Anhänger des mennonitischen Bekenntnisses zuerst nach Preußen u. Danzig, die beide schon etwa 1525 evangelisch lutherisch geworden waren. Aber an beiden Stellen stießen sie auf den Widerstand der evangelischen Geistlichkeit. Zwar war der Herzog in Preußen tolerant u. wollte die fleißigen, der Entwässerungskunst kundigen Holländer gerne in seinem menschenarmen Lande halten. Aber das Drängen der Geistlichkeit u. besonders Luther’s, der ja von jeher Ratgeber u. Vertrauensmann für den Herzog gewesen war, bewogen denselben, die Einwanderer wieder des Landes zu verweisen oder wenigstens ihnen das Leben so zu verleiden, daß sie freiwillig wegzogen. Da bot sich plötzlich in dem benachbarten polnischen Preußen eine große Siedlungsgelegenheit für die holländischen Bauern, die mit der Entwässerungskunst aus der holländischen Heimat vertraut waren. Vom Drausensee bis nach Danzig, am frischen Haff entlang, bestanden damals noch keine Deiche, u. bei hohem Wasserstand im Haff, drang das Wasser weit ins Land u. machte dieses Land zum Teil ganz u. zum Teil wenigstens zeitweise unbenutzbar. Große Teile dieses Landes im großen Werder gehörten zur Starostei Tiegenhof, die damals an einen Danziger Bankier verpfändet war. Dieser u. auch andere Danziger Kaufleute, die sogenannte morrastige Gründe besaßen, u. auch die Krone Polen, die viel von diesen morrastigen u. bisher unbrauchbaren Gebieten besaß, nahmen die entwässerungskundigen Holländer gerne auf ihren Gebieten auf, und wenn auch Danzig u. die Werder sehr bald evangelisch-lutherisch geworden waren, so fanden die mennonitischen Holländer bei dem kath. Polenkönig sehr bald Rückversicherung gegen Übergriffe der luth. Geistlichkeit.
Und nun begann durch die Mennoniten ein Kulturwerk 1. Ranges. Etwa 60 klm. Deiche mußten vom Drausensee bis Danzig am frischen Haff entlang geschüttet u. unterhalten werden, gleichzeitig mußten die Deiche an den Hauptentwässerungsflüssen Jungfersche Lake, Tiege (Schwente) u. Linau gemacht werden, die doch nicht verbaut werden konnten. Diese Deiche an den Unterläufen der Jungferschen Lake, der Tiege u. der Linau waren wohl noch einmal 60 klm. lang. Dazu kamen noch die vielen Wälle, die die einzelnen Entwässerungsgebiete von einander abgrenzten, denn auch die Holländer hielten darauf, wie s.Z. der Ritterorden bei der Besiedlung der Werder, daß der höher gelegene Polder den tiefer gelegenen nicht überwässerte. Dann wurden für jeden Polder besonders Wassermühlen gebaut, die das Wasser bis 2 m. hoch in die schon mehrfach erwähnten Hauptwasserläufe Linau, Tiege u. Jungfersche Lake resp. deren Nebenflüsse pumpten. Diese durch den Wind betriebenen (im großen Werder etwa 20-30) bestanden in meiner Jugend noch fast vollzählig u. waren auch bei Bedarf ständig in Betrieb. Sie konnten aber nicht nach Belieben pumpen, denn wenn durch Stauwind oder andere Einflüsse das Wasser in den Hauptwasserläufen zu hoch stand, mußte gewartet werden, bis die Vorwasserverhältnisse günstiger geworden waren, sonst würde das Wasser über die Deiche wieder in das Land zurücklaufen. Das gab oft eine große Geduldsprobe ab. Eine der Mühlen war als Markmühle bezeichnet. Keine Mühle durfte pumpen, bevor diese Mühle anfing zu arbeiten, was man an den sich drehenden Mühlenflügeln erkennen konnte. Darauf wurde schon sehr aufgepaßt, denn jeder wollte so schnell wie möglich trocken gelegt sein. Besonders kam das bei Deichbrüchen der Weichsel oder Nogat in Frage. Da lagen die Mühlen so lange still, bis der Haffwasserstand das Pumpen erlaubte. Da wurde es mit der Frühjahrsbestellung manchmal schon recht spät u. die Erträge dementsprechend geringer, u. mein Vater, der noch viele Deichbrüche erlebt hat, sagte öfter, wenn wir darauf zu sprechen kamen in seinem geliebten Plattdeutsch: „Noa Viet geiht Sack on Saat quiet“! [Nach Veit ist man Sack und Saat los]. St. Veit, der 14. Juni, galt also als letzter Termin für die Aussaat. Im übrigen nahm mein Vater als echter Sohn seiner holländischen Vorfahren einen Deichbruch u. dementsprechende Überschwemmung der Felder nicht sehr tragisch u. meinte, der Ausfall in Bruchjahren wurde in den nächsten Jahren durch bessere Ernten reichlich wettgemacht. Ich selbst habe in meiner engsten Heimat, dem großen Werder, keinen Deichbruch mehr erlebt, aber im kleinen Marienburger Werder 1888 meine diesbezüglichen Studien machen können, als dort am 25. März 1888 bei Jonasdorf der Nogatdamm brach u. der größte Teil dieses Werders unter Wasser gesetzt wurde. Doch darauf komme ich noch später zurück.
Eine weitere Arbeit stand den holländischen Siedlern noch bevor, ehe sie darangehen konnten, sich Haus u. Hof zu bauen u. ihre Felder zu bestellen. Das trocken gelegte Land mußte durch viele, viele Gräben, die dort erst gegraben werden mußten, erst richtig entwässert werden, u. der Grabenaushub mußte auf die Plätze geschafft werden, wo die Hofgebäude hinkommen sollten. Das waren oft recht ansehnliche Hügel, die wohl 2-3 m. über die Umgebung hinausragten, u. wenn die Höfe wohl selten mehr, wie 1 Hufe (=16 ½ ha) groß gewesen sind u. die benötigten Gebäude dementsprechend, der Platz durch die Sitte, die Gebäude im Winkel zu stellen auch kleiner gehalten werden konnte, so gehörte zum Bau eines kleinen Hofes doch immer ein ganz ansehnlicher Hügel. Die Gebäude standen dann aber auch so hoch, daß bei kleineren Überschwemmungen das Wasser nicht in die Gebäude kam. Bei sehr großen Brüchen mußte aber Vieh u. Menschen in die oberen Gelasse retirieren, d.h. die Menschen zogen in das Oberstübchen, u. die Tiere wurden auf den Stallboden gebracht, von dem das Heu während des Winters schon ziemlich verschwunden war. Alle diese Arbeiten halten wohl einen Vergleich mit der Schüttung der Weichsel u. Nogatdämme durch den Orden aus, besonders, wenn man bedenkt, daß der Orden doch sicher Kriegsgefangene oder andere Hörige zu diesen Arbeiten verwenden konnten, während die Holländer alle Arbeiten allein machen mußten. Die Gebäude wurden ausschließlich von Holz gebaut u. mit Rohr gedeckt. Letzteres gab es am frischen Haff in Mengen, u. Holz ist wohl ausschließlich aus Polen geliefert u. auf der Weichsel heruntergekommen. Solche Bauernhöfe bestanden aus Wohnhaus, Stall u. einer unter rechtem Winkel an den Stall angebauten Scheune unter Stroh oder Rohrdach. In unserer Zeit wurden massive Brandgiebel zwischen Wohnhaus u. Stall eingebaut u. der einzige Zugang aus dem Wohnhaus zum Stall durch eine starke eiserne Tür verschlossen, noch später wurde auch mehrfach das Wohnhaus mit Pfannen gedeckt, alles zur Sicherung der Menschen bei Bränden. Solche Gebäude sahen etwa folgendermassen aus: Das Wohnhaus stand auf Ziegelfundamenten u. war an der Nordseite zur Hälfte unterkellert. Da man, des Grundwasserstandes wegen, mit den Kellern nicht tief in den Boden gehen konnte, so war der Fußboden für die über den Kellern befindlichen Wohnräume, die sogenannte Kleinestube u. Eckstube, etwa 30 cm höher gelegt, als für die Hauptwohnstube, die sogenannte große Stube, die zugleich die Schlafstube für die Eltern war, die in dem dort aufgestellten Himmelbett nächtigten, während die Kinder in der kleinen Stube u. der Eckstube u. im Notfall auch in dem Oberstübchen über der großen Stube ihr Unterkommen fanden. Die kleine Stube besaß in meinem Geburtshaus einen Ziegelofen, die große Stube einen großen Kachelofen, die Eckstube war nicht heizbar. Über dem Kachelofen befand sich in der hölzernen Stubendecke ein etwa 25×25 cm großes Loch, das zur notwendigen Erwärmung des Oberstübchens diente u. mit einem passenden Holzstöppsel verschlossen werden konnte. In der Wand zwischen kleine Stube u. große Stube neben dem etwa 1 m. von der Wand abgestellten Kachelofen befand sich das sogenannte, von beiden Seiten mit Türen verschließbare „Mälkschaff“ (Milchschrank), in dem bei Winterzeit die Milch in großen irdenen Milchschüsseln zum Entrahmen aufgestellt wurden. Im Sommer diente dieser Milchschrank, nachdem die Regalbretter herausgenommen waren, als Bettstelle für ein paar Jungens. Man muß bedenken, daß bei meinen Eltern in den ersten 10 Jahren ihrer Ehe 7 Kinder geboren u. auch angehalten wurden. Da mußte zusammengerückt werden. Es befand sich zwar auch ein kleines Stübchen auf der andern Seite des quer durch das Haus gehenden Hausflurs, die sogenannte Sommerstube, die aber in den ersten 6 Jahren der Ehe meiner Eltern von dem alten Großvater Peter Wiebe belegt war, der 1872 im Alter von 85 Jahren starb. Danach wurde das Stübchen von einem unverheiratet gebliebenen Bruder meines Vaters, Onkel Aron, bis an sein Lebensende bewohnt. Ich schildere diese Verhältnisse so eingehend, weil sie bei den andern Mennonitenfamilien ähnlich lagen. An der andern Seite des Hausflurs befand sich dann noch neben der Sommerstube der Eingang zum Stall, dann schloß sich die Mädchenkammer, ein fensterloses dunkles Loch, u. die Speisekammer mit einem Fenster in der Außenwand an. In der Mitte des Hauses stand die ziemlich geräumige Küche mit offenem Schornstein, in dem auch das Fleisch u. die Würste geräuchert wurden. Von dieser Küche aus wurden auch die beiden Öfen in der großen u. kleinen Stube geheizt u. zwar hauptsächlich mit Rapsstroh u. Gerstenspreu oder Weidenstrauch. An Möbeln befanden sich in der Bauernwohnung neben den notwendigsten Bettgestellen u. Schränken etwa 1 Dtz. Holzstühle in der kleinen u. Eckstube u. etwa 1 ½ Dtz Rohrstühle u. Kissenstühle, die letzteren aber nur zu Festlichkeiten aus dem Oberstübchen heruntergeholt wurden, der wilden Jungen wegen. Polstermöbel u. Teppiche waren in den ersten 17 Jahren ihrer Ehe, im Haushalt meiner Eltern unbekannt. Als sie dann 1883 nach Irrgang in ein neues größeres Haus zogen, wurde ein Sofa angeschafft, damit war aber auch dem Luxusbedürfnis meiner Eltern Genüge getan. Man schämt sich manchmal, wenn man diese spartanische Lebensweise mit dem, schon recht anspruchsvoll gewordenen, Styl unserer letzten 25 Ehestandsjahre in Liessau vergleicht, in dem Polstermöbel u. Teppiche keine Seltenheit mehr waren.
Die Ställe waren meist, wegen der angebauten Scheune ziemlich dunkel, u. wenn dann noch, der Scheune gegenüber, ein Schweinestall angebaut war, dann bekam der Stall nur Licht vom Giebel her. Die angebaute Scheune zeigte zuerst eine Tenne neben der Stallwand, von der aus das Heu auf den Stallboden gebracht wurde, dann kam ein Getreidefach u. noch eine Tenne mit anschließendem Giebelfach, für das meistens der aufgefahrene Hügel nicht mehr ganz reichte u. dessen Schwellen oft auf mannshohen hölzernen Tanken standen oder lagen. In den höher gelegenen Teilen der Niederung, wo nicht mehr so große u. hohe Hügel für den Hof notwendig waren, wurde die Scheune auch schon vielfach etwas entfernt vom Stall, aber auch im rechten Winkel zu demselben, allein aufgestellt u. dann kam, des größeren Getreidebaues wegen, auch oft ein besonderer Speicher dazu. In allen andern Höfen wurden Getreide u. Futtermittel auf dem Wohnhausboden gelagert.
Als die mennonitischen Holländer in das Weichselmündungsgebiet u. somit in polnisches Gebiet kamen, hatten sie mancherlei Bedingungen gestellt, unter denen sie nur nach Preußen zuziehen wollten. Das waren unter anderm: Unbehinderte Ausübung ihres Gottesdienstes, Befreiung von der Eidesleistung, Befreiung vom Kriegsdienst, Befreiung von Hand u. Spanndiensten für die Krone Polen, Befreiung von allen Arbeiten an den Weichsel u. Nogatdeichen, das Letztere wohl als Gegenleistung für ihre Arbeiten an den Haffdeichen. Diese Privilegien liessen sie sich von jedem neuen Polenkönig bestätigen u. auch Friedrich der Große bestätigte ihnen bei seiner Besitzergreifung Westpreußens 1772 diese Privilegien, wenn auch mit einigen Einschränkungen, so besonders betr. Kriegsdienstverweigerung. Dafür mußten die westpreußischen Mennoniten jährlich 5000 Thlr.in die Kasse des Kadettenhauses zu Kulm zahlen. Die Ansiedlung der Mennoniten geschah meistens durch Abschließung von Pachtverträgen mit den verschiedenen Besitzern dieser niedrigen Ländereien, der Krone Polen, den verschiedenen kath. Bischöfen u. auch polnischen Großgrundbesitzern u. reichen Kaufleuten aus Danzig u. Elbing auf 30-50 Jahre. Letztere beiden Städte weigerten sich zunächst, mennonitische Kaufleute u. Fabrikanten oder Handwerker in ihre Mauern aufzunehmen. Einmal, weil die Mennoniten den Bürgereid nicht leisten wollten u. auch den Wehrdienst verweigerten, dann aber auch aus Handelsneid, da sie die Konkurrenz der, in handwerklichen Künsten den Danzigern u. Elbingern oft überlegenen, Mennoniten fürchteten. Diese Situation nutzten die kath. Bischöfe von Oliva u. Pelplin weidlich aus u. siedelten die Mennoniten auf ihrem Gebiet, das teilweise bis hart an die Stadtmauern von Danzig ging, an. Und nun war die Konkurrenz der Holländer doch nicht zu vermeiden. Auf diesem bischöflichen Gebiet durften sich die Mennoniten dann auch bald ihr Gotteshaus bauen, das sie auch noch lange nach dem benutzten, als ihnen die Danziger das Bürgerrecht gewährten u. das erst den Belagerungen Danzigs in der napoleonischen Zeit zum Opfer fiel. Die Stadt Elbing hatte den, in ihre Mauern eingezogenen, Mennoniten übrigens schon viel früher das Bürgerrecht verliehen, als Danzig, das sich erst Mitte des 17. Jahrhunderts dazu entschließen konnte. Um diese Zeit war es auch, daß sich die Mennoniten nach langem Drängen bereit erklärten, die Arbeiten an den Weichsel u. Nogatdeichen in gleichem Umfang, wie die andern Dienstpflichtigen zu übernehmen, wofür man ihnen die besondern Arbeiten an der Unterhaltung der Haffdeiche abnahm, so daß die ganzen Deiche, rund um das große Werder, einheitlich dem Deichamt unterstellt wurden. Zu dieser Zeit etwa wurde auch der Deich an der linken Seite der Elbinger Weichsel geschüttet, der bis dahin nicht bestanden hatte. Im 17 u. 18ten Jahrhundert hatten sich die Holländer schon so stark vermehrt, daß die ursprünglich von ihnen kultivierten Ländereien nicht mehr für sie ausreichten u. sie sich nach anderm Landbesitz umsehen mußten. Da fanden sich in fast allen Dörfern des großen Werders Bauern mit größerem Landbesitz bereit, von ihrem niedrigen oder weit vom Hof gelegenen Lande gegen gute Bezahlung etwas zu verkaufen, u. die Mennoniten bezahlten gut u. machten auch sehr bald die niedrigen Ländereien durch ihre Entwässerungskunst erfolgreich. Und so entstanden die Feldhöfe im großen Werder, die es zur Ordenszeit nicht gegeben hatte. Diese Streusiedlung entsprach überhaupt der Eigentümlichkeit der Mennoniten, die sich, auch wo sie neue Dörfer gründeten, nie in geschlossenen Dörfern ansiedelten. Dann verkaufte die Krone Polen einige der früheren Ordenshöfe u. Ländereien, u. so kam Herrenhagen, Heubuden u. Leske in den Besitz der Mennoniten. Warnau, das früher u. noch zu meiner Jugendzeit Korzelitzki hieß, nach seinem früheren Besitzer, dem polnischen Ritter Korzelitz, war wohl das erste Dorf, in dem sich die Mennoniten auf hohem Lande u. in einem geschlossenen Dorf ansiedelten. Aber auch diese Ländereien genügten nicht, u. schon zur letzten Regierungszeit Friedrichs des Großen, knüpften die Mennoniten Verhandlungen mit der russischen Regierung unter der Kaiserin Katharina der Großen an, welche ihnen reichlich gutes Siedlungsland u. Gewährung aller Privilegien versprach, die sie im Weichsel Mündungsgebiet besessen hatten. Hinzu kam noch, daß der Nachfolger des alten Fritz, wieder aufgestachelt von der lutherischen Geistlichkeit, den Mennoniten den weiteren Erwerb von Grund u. Boden verbot. Sie konnten fernerhin nur ein Grundstück aus evang. oder katholischem Besitz kaufen, wenn sie eines ihrer Grundstücke an Evangelische verkauften. Das brachte die Auswanderungspläne der Mennoniten zur Reife, u. etwa 1790 begann die Auswanderung nach Südrußland, die auch bis 1870, mit zeitweiligen Unterbrechungen, anhielt. Dort in der Ukraine kamen die holländischen Mennoniten nicht, wie im Mündungsgebiet der Weichsel, auf niedriges Land, das sie erst entwässern müßten, sondern auf schönsten hohen Ackerboden. Aber sie haben auch auf diesem Boden ihren Mann gestanden u. sind meistens zu großem Wohlstand gekommen. Dort sind sie schon im ersten Weltkrieg 1917 von den Bolschewisten um die Früchte ihres Fleißes betrogen, wie wir in Deutschland 30 Jahre später. In der Heimat ging die Entwickelung weiter. Die Privilegien betr. freier Ausübung ihres Gottesdienstes u. der Berechtigung, ihre Aussagen vor Gericht mit einem „Ja“ oder „Nein“ bekräftigen zu dürfen, das einem Eid gleich kam u. auch wie ein Eid bestraft wurde, wenn es falsch abgegeben war, wurden ihnen nicht beschnitten, aber die Kriegsdienstverweigerung konnte nur bis 1868 aufrecht erhalten werden. Dann wurde dieses Privileg aufgehoben, den Mennoniten aber durch Kabinettordre König Wilhelms I. die Berechtigung zugesprochen, ihren Militärdienst bei den Trainfahrern, Krankenpflegern, Ökonomiehandwerkern oder Schreibern zu leisten.
Die Verhältnisse der Mennoniten in den Oberniederungen waren denen der Gr. Werderschen Mennoniten ähnlich verlaufen. Sie hatten dort aber weniger unter den Anfeindungen der luth. Geistlichkeit zu leiden, wodurch sie schon viel früher, wie bei uns, in ein gutes Verhältnis zu ihren evang. Landsleuten gelangten u. Heiraten zwischen Angehörigen beider Bekenntnisse häufiger waren. Die Entwässerungsverhältnisse waren in den Oberniederungen ganz anders gelagert, wie bei uns. Wir hatten im gr. Werder keinen Wasserzufluß von der Höhe u. konnten unser nicht frei ablaufendes Wasser mit Windmühlen in das frische Haff pumpen, was mit Windmühlen nur möglich war, weil das Wasser nur höchstens 2 m. zu heben war. In den Oberniederungen mußte das Wasser, durch Zuflüsse von den angrenzenden Höhen noch vermehrt, in die Weichsel ablaufen. Das konnte aber erst geschehen, wenn der Wasserstand in der Weichsel entsprechend gesunken war. Zu diesen Entwässerungszwecken war der Damm nicht ganz bis zum Ende der betr. Niederung durch geführt. Dadurch war aber auch dem Weichselhochwasser der Weg in die Niederung frei, u. das Wasser drang also alljährlich mehr oder weniger von unten her in die Niederungen ein u. nahm nachher auch auf demselben Wege seinen Abfluß. Das dauerte aber oft viele Wochen u. zwang die Bauern, genau, wie bei uns, auf hohen Erdhügeln ihre Höfe aufzubauen. Erst mit der Erfindung der Dampfmaschine wurde diesem Übelstand abgeholfen. Die Dämme wurden vollkommen geschlossen u. große Dampfschöpfwerke aufgestellt, die eine erhebliche Verbesserung in der Entwässerung herbeiführten. Der Übelstand, daß auch ein Teil der von der Höhe zugeflossenen Wasser mit ausgepumpt werden mußte, blieb bestehen.
Während z.B. in der Schwetz-Neuenburger Niederung, im Dorfe Montau, die Mennoniten sich schon um 1580 ein eigenes Gotteshaus bauen konnten, war dieses den viel zahlreicheren Mennoniten im großen Werder bis Mitte des 18ten Jahrhunderts untersagt, wohl wieder auf Betreiben der lutherischen Geistlichkeit. Aber zu dieser Zeit, als die Vorbereitungen für eine Teilung Polens immer deutlicher wurden, wandten sich die Mennoniten noch einmal an die polnische Regierung, um die Genehmigung zu Kirchenbauten zu erhalten. Durch die Fürsprache einflußreicher Personen wurde die Genehmigung erreicht. Wie solche Fürsprachen in Polen erreicht wurden, kann man sich denken. Der Eine wird es Bestechung, der Andere Erpressung nennen. In diesem Punkte hatten die Mennoniten einige Erfahrung. Aber jede erfolgreiche „Fürsprache“ kostete sie ein schönes Stück Geld. Aber zunächst wurden nun im gr. Werder um 1768 herum mindestens die Kirchen in Heubuden, Ladekopp, Rosenort, Tiegenhagen u. Fürstenwerder gebaut, die Kirche in Orlofferfeld war wohl schon etwas älter. Aber diese Kirchen mußten alle ohne Glockenturm gebaut werden, wie auch die evangelischen Kirchen während der Polenzeit. Aber während bei den ev. Kirchen diese Beschränkung sofort nach dem Einzug der Preußen wegfiel, war den Mennoniten der Turmbau bis ins 20 Jahrhundert untersagt u. erst kurz vor dem I. Weltkrieg bekam die Mennonitengemeinde Thiensdorf-Pr.Rosengarth im kl. Marienburger Werder, auf Fürsprache des lutherischen Pfarrers Krause Thiensdorf, die Erlaubnis, ihre neu erbaute Kirche in pr. Rosengarth mit einem Glockenturm u. Kirchenglocken zu versehen. Es ist, soviel ich weiß, die einzige Mennonitenkirche mit Glocken.
Übrigens wurden auch diese Kirchen des 18ten Jahrhunderts ausschließlich aus Holz gebaut u. mit Pfannen gedeckt, während die in der Polenzeit erbauten ev. Kirchen regelmäßig Fachwerkbauten ohne Turm waren, der ihnen aber teilweise im Laufe des 19. Jahrhunderts angebaut wurde, soweit die Gemeinde das Geld dazu hergeben wollte.

Daß Seuchen das große Werder besonders heimgesucht hätten, ist mir nicht bekannt. Zwar hat die Cholera während des 19. Jahrhunderts mehreremal im Gr. Werder geherrscht u. in einzelnen Ortschaften eine Anzahl Personen hingerafft, aber von meinen Verwandten war keiner darunter. Auch die Napoleonischen Kriege, die doch bei der wiederholten Belagerung Danzigs ihre Wellen auch bis zu uns schlugen, haben in meiner Familie nur ein Todesopfer gefordert, das war mein Urgroßvater Peter Wiebe Ladekopp, der 1813 an der Ruhr starb, welche die aus Rußland zurückflutenden französischen Truppen eingeschleppt hatten. Die wirtschaftliche Lage für den Bauern war zunächst nicht schlecht. Das beweist der verhältnismäßig hohe Preis von 15000 Thlr., den mein Großvater Peter Wiebe 1816 seinen Geschwistern für den 2 Hufen großen väterlichen Hof in Ladekopp zahlte. Aber wenige Jahre später gingen die Preise für alle landwirtschaftlichen Produkte so erheblich zurück, daß mir mein Vater die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts als ganz erbärmlich schilderte u. viele Bauern mit dem Bettelstab von Haus u. Hof gingen. Als dann etwa 1829 der Rapsbau eingeführt wurde, begann sich die Lage der Bauern zu bessern. Raps gab gute Erträge u. hatte einen hohen Preis. Es wurde von den Bauern auch alles mögliche für damalige Zeiten für den Raps getan. Er stand in gut gedüngter Schwarzbrache u. wurde wie ein rohes Ei in der Wirtschaft behandelt. Ich habe mal ein Rechnungsbuch meines Großvaters über mehr als 30 Jahre gesehen. Es enthielt nur die Einnahmen aus Raps. Durch den Rapsbau war eine größere Manigfaltigkeit im Ackerbau hervorgerufen. Hinter Raps u. hinter einem […]nten Schlag (Kartoffeln, Wicken u. Pferdebohnen) folgte regelmäßig Weizen. Auch der Rotkleeanbau wurde aufgenommen. Aber die Hauptverkaufsfrüchte blieben immer Raps und Getreide, das bis in die 2te Hälfte des 19. Jahrhunderts noch ausschließlich mit dem Flegel ausgedroschen wurde, während der Raps mit Pferden ausgeritten u. mit einem Rapszylinder zunächst von den Rapsschlauben getrennt u. dann, wie Getreide, durch den Wind geworfen wurde. In den fünfziger Jahren erschienen dann zunächst die Göpeldreschmaschinen, die mit Pferden betrieben wurden. Mein Großvater hatte sehr bald eine solche Maschine erstanden, u. sein unverheiratet gebliebener Sohn Aron war in seinem Element, als er mit dieser Maschine nicht nur auf dem väterlichen Hof, sondern in weitem Umkreis bei den Nachbarn von Hof zu Hof fuhr u. ihnen das Getreide ausdrosch. Nach beendetem Drusch fuhr er weiter; die Reinigung mußte jeder auf eigene Faust ausführen. Auch dazu fanden sich sehr bald Reinigungsmaschinen. Etwa 20 Jahre später tauchten dann schon die Dampfdreschmaschinen mit voller Reinigung auf, die das Getreide gleich malfertig in den Sack laufen ließen.
In den holländischen Dörfern war natürlich die Viehwirtschaft vorherrschend. Die Milch wurde zu Käse verarbeitet, von dem es natürlich verschiedene Sorten u. Qualitäten gab. Es wurden hauptsächlich Werderkäse u. Kräuterkäse, aber auch Limburger hergestellt, der seines pikanten Geschmackes wegen beliebt u. seines üblen Geruchs wegen gefürchtet war. Die Qualitäten waren in allen Sorten sehr verschieden, je nachdem man die Milch sofort nach dem Melken, wie sie von der Kuh kam, verarbeitete, oder Morgen u. Abendmilch zusammengoß, nachdem man von der Ersteren noch schnell ein bisschen Rahm abgeschöpft hatte. Das war dem Käse sofort anzumerken u. danach auch verschiedene Preise. Mancher Bauer hatte in Danzig oder Elbing seine festen Abnehmer unter den Kaufleuten, aber im ganzen kamen die Käsehändler herumgefahren u. holten die Käse regelmäßig ab. Ich kann mich noch daran erinnern, daß der Käsehändler auf den Hof kam, der Wiegebalken wurde an einem beliebigen Baumast in der Nähe des Hauses befestigt, die Wiegesteine hervorgesucht und das Verwiegen der Käse konnte los gehen. Dezimalwagen u. gußeiserne Gewichte gab es damals bei uns noch nicht. Bei den Bauern im oberen Werder, die nicht genügend Wiesen besaßen u. auch wohl nicht der Milchverarbeitung so kundig waren, wie die Holländer, spielte die Milchkuh eine viel geringere Rolle, deshalb waren deren Viehbestände auch verhältnismäßig kleiner u. folgedessen der Düngeranfall geringer, was sich im Stande der Felder sehr bemerkbar machte. Aber im ganzen waren die Jahre von 1850 bis 1880 für alle Bauern eine günstige Zeit, da die Preise für alle landw. Produkte gut u. die Steuern u. Löhne gering waren.zwirn
Von 1870 bis 1945
Nach dem deutsch-französischen Krieg 70/71, der für Deutschland so glänzend beendet wurde, fing sich das wirtschaftliche Leben sehr zu regen an. Wenn man sich die Verkehrsverhältnisse der damaligen Zeit ansieht, so war allerdings auch viel zu machen notwendig. Die einzige Chaussee, die das große Werder in seinem oberen Teil durchschnitt, war die Staatschaussee Berlin Dirschau-Marienburg, Königsberg, die in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut war. Mein Urgroßvater Isbrand Wiebe Herrenhagen hat damals Taxatorendienst für die Bewertung der zum Chausseebau benötigten Ländereien geleistet. Außerdem bestand seit 1858 die Staatsbahn Berlin-Königsberg, die ebenfalls über Dirschau-Marienburg geführt wurde. Dieser Streifen meiner Heimat war also schon 1870 verhältnismässig gut aufgeschlossen. Aber sonst gab es im ganzen Werder nur Triften, mit Kopfweiden bestanden u. bei Regenwetter fast unpassierbar. Dem sollte nun abgeholfen werden. 1871 wurde die erste Kreischaussee Neuteich Dirschau gebaut, die noch Chausseegeld Einnehmerhäuschen erhielt, von denen eines an meinem früheren Lande in Liessau u. eines kurz vor Neuteich steht. Übrigens hatte auch die Staatschaussee Dirschau Marienburg diese Einnehmerhäuschen; bei meinem Denken sind sie aber nicht mehr benutzt worden. Bei den weiteren Chausseebauten verzichtete man auf diese Verkehrshindernisse. 1873/75 wurde dann die Kreischaussee Marienburg-Neuteich-Tiegenhof gebaut, die an meinem väterlichen Hof in Ladekopp vorbeiführte. Ich kann mich noch erinnern, wie die alten Kopfweiden für den Chausseebau ausgerodet u. auf Vaters Hof gefahren wurden. Dann folgten Jahr um Jahr weitere Chausseebauten, u. wenn anfänglich der benötigte Grund u. Boden vom Kreise an die Eigentümer bezahlt wurde, mußten sich sehr bald die Dörfer, die eine Chaussee haben wollten, zum Ankauf der benötigten Ländereien verpflichten. Ja, die Sehnsucht nach der Chaussee war so groß geworden, daß einige Dörfer, denen es mit dem Chausseebau nicht schnell genug ging, sich auf eigene Kosten Anschlußstrecken bauten, zu denen sie allerdings vom Kreise Zuschüsse bekamen. Sie mußten diese selbstgebauten Strecken aber auch viele Jahre lang unterhalten, bis der Kreis im Zuge weiterer Chausseebauten, die sich an die Privatchaussee’n anschloßen, diese Strecken auch auf den Kreis übernahmen. Ich erinnere mich da an die Strecken Barendt-Damerau, Parschau-Trampenau u. Gr.Lesewitz-Tragheim, die in der ersten Zeit ihres Bestehens solche Privatbauten waren.
Bei Beginn des II. Weltkrieges 1939 gab es wohl kaum ein Dorf im Kreise, das nicht Chausseeanschluß hatte. Ende der 80ger Jahre wurde dann die Staatsbahn Simonsdorf-Neuteich Tiegenhof gebaut u. im Laufe der nächsten 20 Jahre das Kleinbahnnetz Marienburg-WernersdorfGr. Montau-Biesterfelde-Liessau-Gr. Lichtenau Neuteich-Lindenau-Gr.Lesewitz-Marienburg: mit einer Abzweigung von Lindenau über Gr.Mausdorf-Lakendorf-Fürstenau Tiegenhof nach Steegen.
Den Grundstock zu diesen Bahnen legten die Zuckerfabriken Liessau, Neuteich, Marienburg u. Tiegenhof, die im Konkurrenzkampf um die Zuckerrüben einige, ihnen wichtig erscheinende Strecken zunächst nur als Rübenbahnen ausbauten u. benutzten. Aber schon nach einigen Jahren gingen diese Bahnen an die Westpreußische Kleinbahn A.G. über, welche die Strecken besser ausbaute u. auch Personen u. allgemeinen Güterverkehr einrichtete.
Als Verkehrseinrichtungen muß man auch die künstlichen Wasserstraßen bezeichnen, wie den Weichsel-Haff Kanal, der etwa 1840 ausgebaut wurde u. von Rotebude a.d. Weichsel, wo eine Schiffahrtsschleuse in den Weichseldamm eingebaut wurde, durch die Linau nach Platenhof b. Tiegenhof führte, wo ihn wieder eine Schiffahrtsschleuse mit der Tiege verband. Dann führte der Schiffahrtsweg durch die Tiege u. den Müllerlandskanal in das frische Haff.
Dieser ganze Schiffahrtsweg ist im Zuge der Entwässerungsbauten für den Linauspolder eingegangen, bis auf die Tiege, die heute über die Elbinger Weichsel, die Verbindung zur Stromweichsel u. nach Danzig herstellt. Die Elbinger Weichsel war in ihrem Oberlauf bei der endgültigen Weichselregulierung schon so stark versandet, daß man bei niedrigem Wasserstand der Stromweichsel, bei Fürstenwerder-Schönbaum mit Wagen durchfahren konnte. Daß die dort befindliche Fähre beim übersetzen von Fuhrwerken öfter auf dem Flußboden festsaß u. die Fährleute zu unserem Schreck plötzlich ins Wasser sprangen u. nachschoben. Das Wasser war nur etwa 60 cm. tief. Das habe ich selbst erlebt. Aber nachdem die Weichselregulierung fertig u. die Elbinger Weichsel gegen die Stromweichsel abgeschlossen u. eine Schiffahrtschleuse eingebaut war, wurde die Elbinger Weichsel gründlich ausgebaggert u. ist jetzt durchweg bis zu ihrer Mündung ins frische Haff schiffbar. Außerdem ist es ein Hauptentwässerungsfluß für große Teile des großen Marienburger Werders geworden, denn die beiden großen, teilweise elektr. u. teilweise mit Dieselmotor angetriebenen Schöpfwerke für den Linaupolder u. für den Jungfer’sche Lake Polder stehen beide garnicht weit voneinander entfernt, an der Elbingerweichsel, das Erstere bei Kalteherberge, das Letztere einige klm. stromabwärts. Sie haben je 3 Durchlaßrohre von 2m. Durchmesser u. pumpen, wenn sein muß u. alle Rohre arbeiten, in wenigen Tagen die Linau leer, wozu die früheren vielen Windmühlen immer mehrere Wochen brauchten u. der Wasserstand in der Linau dann immer noch sehr hoch war.
Ein anderer Schiffahrtsweg war die Tiege-Schwente, die Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts ebenfalls ausgebaggert u. bis Neuteich schiffbar gemacht war. Es war ein ziemlich reger Schiffsverkehr auf diesem Flüßchen, wozu die Zuckerverschiffungen der Neuteicher Zuckerfabrik u. die Versorgung der Fabrik mit Kalk u. Kohle [unleserlich] viel beitrug. Auch Getreide wurde viel in Neuteich verladen u. der Neuteicher Holzhandel ging auch zum großen Teil Schwente aufwärts.
Ein weiterer Schiffahrtsweg war seit etwa 1890 die Jungfersche Lake, die durch einen breiten Kanal bis Lindenau schiffbar gemacht wurde. Etwa 50 Jahre hat dieser Kanal bestanden u. fiel dann den Entwässerungsbauten für das Polder der Jungferschen Lake zum Opfer. Heute ist dieser ehemalige Schiffahrtskanal, ebenso wie der ehemalige Weichsel Haffkanal weiter nichts als ein großer Entwässerungsgraben. Es sind Kindheitserinnerungen, wie auch die gelbe Postkutsche, die vor der Fertigstellung der Staatsbahn Simonsdorf-Tiegenhof so pünktlich durch meines Vaters Felder in Irrgang fuhr, daß sie den auf den Feldern arbeitenden Leuten die Uhr ersetzen konnte.
Eine weitere Verkehrsverbesserung waren die Autobus Linien Danzig-Rotebude-Ladekopp-Tiegenhof Elbing mit Abzweigung von Ladekopp über Neuteich nach Marienburg, die besonders zur Zeit der Danziger Freistadtherrlichkeit u. der damit für viele Reisende verbundenen Grenzschwierigkeiten viel benutzt wurden. Auch die Entwickelung der Fahrräder u. Automobile ist mir von seinen Anfängen gut in Erinnerung. Das erste Automobil sah ich 1890 auf einer Ausstellung in Elbing. Es war ein kleines offenes Wägelchen, etwa in der Form, wie unsere kleinen einspännigen Spazierwagen (Phaeton genannt). Ein paar Jahre vorher waren auch die gummibereiften Zweiräder aufgetaucht. Es waren Hochräder mit einem kleinen Hinterrad. Der Fahrer saß hoch oben über dem hartgummibereiften Vorderrad in lebensgefährlicher Stellung, denn bei dem geringsten Anstoß auf der Fahrbahn mußte er, besonders bei schneller Fahrt, kopfüber herunterfallen. Diese Räder haben sich auch nicht eingebürgert, u. als einige Jahre später die luftgummibereiften Fahrräder mit gleich hohen Rädern u. tiefem Sitz auftauchten, hatten sie sich im Nu die Gunst des Publikums, besonders der Jugend, erobert. Ganz so schnell führten sich die Automobile nicht ein. Es war immerhin doch schon eine erhebliche Ausgabe, die Anschaffung eines Auto[s], die zunächst durchweg als offene Wagen mit 2, 4 u. 6 Sitzen auf den Markt kamen. Selbst S.H. Wilhelm d. II., der sehr motorliebend war, fuhr jahrelang im offenen Wagen. Aber allmählig wurden die Wagen größer u. stärker gebaut u. zunächst mit einem Notverdeck versehen. Als dann der 1. Weltkrieg kam, wurde jede Motorisierung rasch vorgetrieben u. nach Beendigung des Krieges hatte die Limousine sich das Feld erobert u. schon vor dem 2ten Weltkrieg gab es fast keine offenen Automobile mehr, abgesehen von den Sportwagen. Auch ich hatte mir 1933 noch einen alten Wagen (Limousine) gekauft u. wenn er auch nicht sehr schön aussah u. keine 100 klm. in der Stunde lief, mir u. meiner Frau genügten auch 50 klm. vollständig u. wir sind gerne in unserem alten Wagen gefahren u. kamen uns schon immer ungeheuer beweglich vor im Vergleich zu unserem bisherigen Pferdefuhrwerk.
Zum Schluß muß ich aber noch das schnellste Beförderungsmittel, das Flugzeug erwähnen, wenn ich es bisher auch noch nicht benutzt habe u. auch keine Sehnsucht danach habe. Auch dessen Entwickelung habe ich u. viele andere mit Spannung verfolgt. Ich muß oft an meinen alten Onkel Warkentinin Susewaldan der Linau denken, den ich 1908 noch einmal besuchte. Trotz seiner 87 Jahre war er geistig noch immer sehr rege, konnte aber nicht mehr allein gehen. Als ich zu ihm kam, saß er am Tisch in seinem Lehnstuhl u. betrachtete Zeitschriften mit Abbildungen von Flugzeugen u. sagte zu mir auf Plattdeutsch: „Se wöllen immer flögen, oawer geroad wenn et losgoahne sahl, es wat entwei.“[Sie wollen immer fliegen, aber gerade wenn es losgehen soll, ist was entzwei]. Der alte Ohm hat die Menschen nicht mehr fliegen sehen. Aber die Entwickelung der Flugzeuge ging auch ohne ihn u. trotz aller oft tötlich verlaufenen Unfälle weiter. Im Frühling 1914 war es so weit, daß ein Geschwader Flugzeuge einen Propagandaflug durch Deutschland antrat u. auch ziemlich programmäßig u. ohne Unfall durchführte. Tag u. Stunde, wenn die Flugzeuge bei Dirschau die Weichsel überqueren würden, waren bekannt gemacht u. so hatten sich denn viele Werderaner z.T. per Wagen gegenüber Dirschau auf der Chaussee Dirschau-Marienburg aufgestellt u. erwarteten bei schönstem Wetter die Flieger; darunter auch ich mit meiner Familie. Und wir wurden nicht enttäuscht. Pünktlich erschienen die Flieger u. wurden gebührend bestaunt. Einige Monate später begann der 1. Weltkrieg u. damit eine rasende Entwickelung der Flugzeuge u. der Fliegerkunst. Damals hatte das Flugzeug noch einen Konkurrenten in dem vom Grafen Zeppelin erfundenen Luftschiff. Aber schon während des ersten Krieges war der Kampf um die Vorherrschaft zu Gunsten der Flugzeuge entschieden, trotzdem die Flugzeuge, auch am Ende des 1. Krieges, noch nicht annähernd die Leistungen aufweisen konnten, die sie heute spielend erfüllen u. wozu das lenkbare Luftschiff des Grafen Zeppelin viel zu unbeweglich war und dem Gegner zu große Angriffsmöglichkeiten bot. Zwar wollte der Graf Zeppelin u. seine Gefolgsleute sich noch nicht so ohne weiteres geschlagen bekennen u. führte zwischen den Weltkriegen noch einmal eine Propagandafahrt um die Erde über Sibirien, Japan, St. Franzisko u. New York ohne Unfall durch, den wir ebenfalls von Liessau aus ein paar Minuten am Horizont verfolgen konnten u. richtete danach einen regelmäßigen Verkehr Deutschland-Vereinigte Staaten ein, aber als nach einer der ersten Landungen in Amerika das Luftschiff in Flammen aufging, da war das Kapitel Flugzeug gegen Luftschiff endgültig zu Gunsten des Flugzeuges entschieden. Heute, wo die Flugzeuge mit derselben Sicherheit, wie Eisenbahnzüge oder Schnelldampfer u. mit derselben Pünktlichkeit in der ganzen Welt verkehren u. riesige Lasten durch die Luft befördern u. beliebig mit Fallschirmen absetzen können, erübrigt es sich, auf die Heldentaten der einzelnen Flieger einzugehen. Sie sind ja allgemein bekannt.
Nur rückblickend möchte ich noch ein paar Daten aus der Entwickelung der Flugzeuge anführen
1909 war noch kein brauchbares Flugzeug geschaffen
1914 wirkte es noch sensationell, daß ein Verband von Flugzeugen bei seinem Propagandaflug durch Deutschland seine Ankunft an den einzelnen zu berührenden Punkten ziemlich genau angeben konnte.
1918 waren die Flugzeuge nicht nur zu Aufklärungszwecken sondern für Luftkämpfe in großem Umfang zu verwenden, aber solche Entfernungen wie von Nordamerika nach Deutschland konnte man noch nicht ohne Zwischenlandung zurücklegen.
Etwa 1925 gelang der erste Flug über den Atlantik, aber als der Flieger notlanden mußte, wußte er durchaus nicht, wo er war.
1934 gelang der erste Flug von Australien über den stillen Ozean nach St.Franzisko.
Im 2ten Weltkrieg vernichtete die deutsche Luftwaffe in fast einem Tag die polnische Luftwaffe u. ihre Flugplätze u. landete in Kreta soviel Fallschirmjäger, daß die Insel mit ihnen besetzt werden konnte.
1944/45 finden die Zusammenkünfte der Alliierten in Teheran, auf der Krim, in Potsdam, Paris und Washington fast ausschließlich auf dem Luftwege statt.
1948/49 werden die 2 Mill. Westberliner monatelang mit allen Bedürfnissen auch Kohlen auf dem Luftwege versorgt, als die Russen die Zufuhren auf dem Land u. Wasserwege abgeschnitten hatten.
1950 wird der Nordpol, dessen Entdeckung soviel Todesopfer gefordert hat, von amerikanischen Flugzeugen 3x wöchentlich zur Beobachtung der Wetterverhältnisse angeflogen; bisher sind 250 Flüge von Alaska aus zum Pol erfolgt.
1951 Amerikanische Flugzeuge werfen auf dem koreanischen Kriegsschauplatz Kanonen aus Flugzeugen mit Fallschirmen ab.
Die deutsche Zeitschrift Revue schickt ihre Vertreter Bertram u. Wundshammer auf eine Flugtour um die Welt mit ordentlichen Verkehrsflugzeugen aller Länder, die sie auf ihrer 71755 klm langen Reisestrecke berühren werden, um die Pünktlichkeit der Verkehrsgesellschaften zu prüfen. Sie sind pünktlich nach 98 Tagen von ihrem Flug wohlbehalten heimgekehrt.
Der Einfluß des Zuckerrübenbaues u. der Molkereien auf die Bodenkultur meiner Heimat.
Im Jahre 1871 wurde die erste Zuckerfabrik des Ostens in Liessau, meinem späteren Heimatort gebaut, u. als 1875 die Kreis Chaussee Marienburg-Neuteich-Tiegenhof fertig war, ging man daran, in Neuteich, das nun schon nach 3 Seiten Chaussee’n ausstrahlte, ebenfalls eine Zuckerfabrik zu bauen. 1877 hat die Fabrik zum erstenmal gearbeitet. Diesem Zuckerfabrikbau folgten dann in verhältnismäßig schneller Folge die Bauten von Marienburg, Tiegenhof, Dirschau, wo sogar 2 Fabriken hart nebeneinander entstanden, in Gr. Zünder,Praust, Sobbowitz, Pelplin, Mewe, Schwetz, Kulmsee, Marienwerder, Riesenburg u. Altfelde.Die Zuckerfabriken schossen also förmlich, wie Pilze aus der Erde. Aber sie verschwanden auch zum großen Teil wieder ebenso schnell. Im Anfang des 20ten Jahrhunderts gingen die Fabriken in Liessau, die dem Weichsel-Regulierungsprojekt zum Opfer fiel, beide Dirschauer Fabriken, Gr. Zünder, Sobbowitz, Mewe, Marienwerder, Tiegenhof ein. Man muß sich heute etwas verwundert fragen, was die Kapitalisten u. Bauern damals bewogen hat, so sinnlos u. in Massen Zuckerfabriken zu bauen. Die Zeit der Hochkonjunktour in Zucker, die um die Mitte des 19ten Jahrhunderts die Landwirtschaft auf den guten Böden Sachsens u. Schlesiens in kurzer Zeit reich gemacht hatte, war eigentlich schon bei dem Bau der Neuteicher Fabrik vorbei. Ich kann mich nicht erinnern, daß mein Vater für seine 3 Ant. der Zuckerfabrik Neuteich jemals hohe Dividenden bekommen hat, u. der Preis für die Zuckerrüben betrug auch selten mehr, wie 1.M. pr. Ctr., der sogar am Ende des 19. Jahrhunderts auf 80 Pf., ja, in einem oder 2 Jahren auf 72 u. 75 Pf. zurück ging. Das waren keine Preise, die zur Vergrößerung des Zuckerrübenbaues anreizen konnten. Da mußten schon andere Faktoren mitspielen, daß wenigstens die Hälfte der Fabriken sich bis zum Beginn des ersten Weltkrieges am Leben erhielt. Einmal wurde der Boden durch die Hackkultur wesentlich von Unkraut befreit u. die bisher übliche Schwarzbrache konnte vielfach wegfallen. An Stelle der Schwarzbrache wurde Johannibrache nach zweijährigem Klee eingeführt u. wer da glaubte, ohne Brache durch verstärkten Zuckerrübenbau auszukommen, der hielt nur einjährigen Rotklee, mit etwas Weißklee und Gras vermischt, der eine prächtige Vorfrucht für Rübensamen war. Dann bot der Zuckerrübenbau in seinen Blättern u. seinen gratis zurückgelieferten Schnitzeln soviel Futter, daß auch der Schlag Futterrüben eingespart werden konnte. Und zuletzt war auch die gute Wirkung der Zuckerrüben auf die nachfolgenden Halmfrüchte nicht zu unterschätzen. Ein weiteres, aber für die Landwirtschaft meiner Heimat sehr wichtiges Abfallprodukt aus der Rübenzuckerfabrikation will ich hier noch erwähnen, des Scheideschlammes oder bei uns Kalkschlamm genannt. Dieser wurde anfänglich wenig beachtet u. blieb jahrelang sozusagen auf dem Kehrrichthaufen liegen, bis ihn dann nahe der Fabrik wohnende Landwirte ohne gegenseitige Vergütung abfuhren. Dann erkannte man bald die düngende u. besonders aufschließende Wirkung des Kalkschlammes, u. er wurde ein sehr begehrtes Düngemittel, das zunächst mit je 1000 Ctr nach Beendigung der Campagne versteigert u. dann auch gleich abgefahren wurde. Aber die Nachfrage nach Kalkschlamm war bald so groß geworden, daß er über seinen Wert hinaus in die Höhe getrieben wurde. Das konnte nun auch nicht zur Förderung des Rübenbaues dienen, daß die Preise für 1000 Ctr. bis auf 400 M. in die Höhe getrieben u. damit den wirtschaftlich schwächeren Landwirten der Erwerb dieses so wichtigen u. anfänglich einzigen käuflichen Düngemittels unmöglich gemacht wurde. Die Fabrik teilte den vorhandenen Kalkschlamm aus eigener Produktion im Verhältnis zu den angelieferten Rüben ein u. kaufte von polnischen Fabriken, die den Kalkschlamm nicht so schätzten wie die Werderbauern, noch große Posten hinzu u. gab dann den Kalkschlamm zu festen Preisen von 200-250 M. pr. Ctr. ab. Auf dem Wege über den Rübenbau lernte man dann auch sehr allmählig den chemischen Dünger u. seine Verwendung kennen. Aber abgesehen von Chilesalpeter, der damals einziger Stickstoffdünger war, u. dessen Wirkung augenscheinlich war, führte sich der chemische Dünger, wie Phosphor u. Kalidünger, die nicht so augenscheinlich wirkten, nur sehr langsam ein. Die Zuckerfabriken drangen zwar darauf, daß Phosphorsäure in Gestalt von Superphosphat angewendet werden sollte, lieferte auch den nötigen Superphosphat u. stellte die neue Düngerstreumaschine zur Verfügung, um den Zuckergehalt in der Rübe zu erhöhen. Die Rübenbauer glaubten aber vielfach, daß diese Verbesserung im Gehalt der Rübe auf Kosten des Ertrags ginge, u. da ihnen daran nicht gelegen sein konnte, wanderte mancher Sack Superphosphat anstatt auf den Acker, in den Graben. Wie stark der Kunstdüngerverbrauch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts im Gr. Werder war, beweist der Umstand, daß eine oder zwei, von der Zuckerfabrik angeschaffte Düngestreumaschinen genügten, um zumindesten für den kleinen u. mittleren Grundbesitz den Kunstdünger auszustreuen, der übrigens auch vielfach unter Verwendung speziell zu diesem Zweck konstruierter bleierner Düngerstreukästen, die mit einem Gurt über der Schulter getragen wurden, mit der Hand ausgestreut wurde. Aber in der Zeit, als ich von Brodsack nach Liessau zog (1909) da war der Verbrauch der 4 Hauptdüngemittel Kalk, Kainit, Phosphorsäure u. Stickstoff schon so gestiegen, daß mittlere Wirtschaften (100 ha) u. größere ihre eigenen Düngerstreumaschinen benötigten. Der Verbrauch von Kali u. Superphosphat hielt sich im Gr. Werder auf seinen guten Böden immer in engen Grenzen, nur die verhältnismässig kleinen versandeten Flächen mußten von allem haben. Die Verwendung von Stickstoffdünger war schon erheblich größer, reichte aber nicht entfernt an die Massen heran, die hier in Westdeutschland gebraucht werden. Das a und o unserer Werderschen Ackerwirtschaft blieb aber immer der Kalkschlamm. Die Landwirte aus den Rübenbaubezirken, die uns ihren Kalkschlamm verkauften, spotteten oft über unsere Verschwendung, daß wir nicht einfach Düngekalk verwendeten u. den fehlenden Stickstoff durch Zukauf ersetzten, anstatt die teure Bahnfracht u. die große Mehrarbeit an Gespannarbeit auf uns zu nehmen. Am augenscheinlichsten wirkte der Kalkschlamm zu Zuckerrüben, die schon bald nach Einführung des Zuckerrübenbaues anfingen, an Wurzelbrand zu leiden. Da war das Allheilmittel der Kalkschlamm, der förmlich Wunder wirkte. Aber bevor der letzte Landwirt, der Zuckerrüben bauen wollte, sich zu dieser Erkenntnis durchgerungen hatte, vergingen viele Jahre, und ein erheblicher Teil zog sich vom Zuckerrübenbau zurück, weil er die Ausgabe für die Kalkung seiner Böden scheute.
Fast gleichzeitig mit dem Bau der Zuckerfabriken begann die Errichtung von Molkereien. Zunächst waren es unternehmungslustige Landwirte, die hie u. da im Gr. Werder auf eigene Kosten kleine Molkereien errichteten (Janßon Tiege, Dyck Brodsack, Wiebe Gr. Lesewitz) u. sie wohl zunächst auf eigene Kosten betrieben. Aber bald schlossen sich die Bauern eines Dorfes zusammen u. gründeten Genossenschaftsmolkereien, die sie dann an schweizer oder oberbayerische Fachleute verpachteten und etwa um 1890 war das ganze Gr. Werder mit einem Netz von Molkereien überzogen. Einige Genossenschaften hatten auch Selbstverwaltung, aber sie mußten sich doch immer einen Fachmann halten, denn die Schweizerkäsefabrikation war selbst unsern Werderbauern holländischer Abstammung fremd, geschweige denn dem größeren Besitz im Werder, der fast immer wenig mit der Kuh u. noch weniger mit ihrer Milch anzufangen wußte. Aber nun die Verarbeitung der Milch nicht mehr von ihnen u. besonders nicht von ihren Frauen gefordert wurde, mehrten sich schnell die Kuhbestände, besonders, wo noch ein leidliches Wiesenareal vorhanden, oder, wie in den an Weichsel u. Nogat angrenzenden Dörfern, Aussendeichweiden vorhanden waren. Die Selbstverwaltung ging bis auf ganz vereinzelte Fälle ganz zurück, wozu wohl öfter betrügerische Manipulationen der Verwalter beigetragen haben dürften. Durch die verstärkte Rinderhaltung u. die bei den Molkereien bald aufgenommene Schweinemast, wurde der Stalldüngeranfall erheblich zugunsten des Ackerbaues vergrößert. Und so entstand im Zusammenwirken der Zuckerfabriken u. Molkereien eine erhebliche Blüte auf dem Acker, wie im Viehstall. Die Landwirtschaft schloß sich in landw. Vereinen zur Pflege des Fachwissens u. der Geselligkeit zusammen. Aber nichts wirkte so belehrend, wie die Gründungen u. Unterhaltung der landw. Versuchsringe, die auf Initiative meines jüngeren Nachbarn Ernst Penner ins Leben gerufen u. in Liessau viele Jahre von dem Dipl. Landwirt Emil Wiebe, einem meiner vielen Vettern II. Grades, mit großem Erfolg verwaltet wurde. Da wurden alle Fragen, die mit dem Ackerbau zusammenhingen, durch Feldversuche exact geprüft u. zwar in der Hauptsache bei Ernst Penner Liessau. Aber jedes Mitglied konnte nach Belieben auf seinen eigenen Feldern die Wirkung von Düngung, Ackerbearbeitung, Sorten, Bestellungszeit etc. nachprüfen lassen u. da ist es mir doch aufgegangen, daß man nur zu einem richtigen Urteil über die Klärung obiger Fragen kommen kann, wenn man diese Fragen auf eigenem Grund u. Boden durch einen zuverlässigen, akademisch gebildeten Landwirt in exacten Versuchen nachprüfen lässt, wobei ich den Ton auf zuverlässig legen möchte. Und Emil Wiebe war zuverlässig.
Im Verlauf dieser Entwickelung in der Landwirtschaft war es selbstverständlich, daß sich viele Bauern außer für den Ackerbau auch mit der Tierzucht befaßten. Schon in den sechziger u. siebenziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatten sich einzelne Landwirte mit Verbesserung der vorhandenen Rinder u. Pferderassen beschäftigt u. ganz nach eigenem Geschmack Zuchtmaterial aus Holstein u. Ostfriesland u. bei Pferden aus dem Rheinland eingeführt u. sehr beachtliche Erfolge damit erzielt. Janßon Tiege hatte schwarzweiße Ostfriesen u. mein Onkel Gerh. Wiebe Gr. Lesewitz Braunvieh aus der Wilstermarsch in Holstein eingeführt. Es war ein herrlicher Anblick, schon Mitte der achtziger Jahre die braune etwa 30-40 Haupt starke Milchviehherde in Gr. Lesewitz, die aber doch nur bei einigen Verwandten Nachahmung gefunden hatte. Mehr Beifall fanden die ostfriesischen Schwarzweißen, holländischer Abstammung. Und als sich dann um 1890 die Züchter dieser ostfriesischen Rinder zu einer Herdbuchgesellschaft zusammenschlossen u. regelmäßig in Danzig u. Marienburg Auctionen veranstalteten, wozu die paar Braunviehzüchter nicht im Stande waren, da war das Schicksal der braunen Herden besiegelt. Nach weiteren 20 Jahren waren die letzten Braunen von der Bildfläche verschwunden. In der Pferdezucht ging die Vereinheitlichung nicht so radikal vor sich. Es standen da immer 2 Bestrebungen gegeneinander. Auf der einen Seite wollte der preußische Staat die Remontezucht gefördert wissen, was auch der Passion vieler Landwirte entsprach, auf der andern Seite drängte die Entwickelung in der Landwirtschaft, mit dem immer stärker werdenden Rübenbau u. damit gesteigerten Ansprüchen an die Zugkraft der Pferde, zur Züchtung eines starken Arbeitspferdes, und so war die Zahl der Warmblutzüchter dort erheblich zurückgegangen u. waren bei unserm Weggang aus der Heimat wohl beide Zuchtrichtungen gleich stark u. es gab ein Stutbuch für Warmblut Trakehner Abstammung u. ein Stutbuch für schwere Arbeitspferde Rheinisch-Belgischer Abstammung.
Die Schweinezucht hatte sich wieder mehr einheitlich entwickelt u. in dem Verband der Züchter des deutschen Edelschweines organisiert. Ich war zeitweise in allen Verbänden Mitglied, habe aber keine Lorbeeren dabei geerntet. Mir lag der Ackerbau mehr, aber Pflanzenzüchter bin ich auch nicht geworden. Aber wir hatten bei Beginn des ersten Weltkrieges in unsern Reihen schon einige Züchter, die sich einen Namen gemacht u. vom preußischen Staat zu Ökonomieräten ernannt worden waren. Soweit ich mich erinnere waren das Grunau Lindenau, Grunau Tralau, Grunau Krebsfelde u. Jacobsohn Tragheim. Sollte ich noch einen vergessen haben, so möge er mir das verzeihen. Es deckt sie längst alle der grüne Rasen.
Soweit ich vorstehende Verhältnisse u. Ereignisse geschildert habe, beziehen sie sich auf die Zeit vor dem ersten Weltkrieg, als 5 goldene Zwanzigmarkstücke nicht mehr wert waren, wie eine Banknote zu 100 Mark u. auch im Ausland nicht besser bezahlt wurden. Dieser Irrtum, daß Mark = Mark ist, hat sowohl im 1. wie im 2ten Weltkrieg viele zu Bettlern gemacht. Die Generation des 2ten Weltkrieges hat allerdings schon kaum jemals ein Goldstück gesehen, aber auch ihr war der Gedanke eingehämmert, daß deutsche Banknoten allemal Goldwert haben. Sie sind vom Vater Staat genauso zu Narren gehalten wie wir im 1ten Weltkrieg.
So mancher Leser, besonders der vom Fach wird sich nun wohl fragen: „Was habt Ihr denn damals vom preußischen Morgen geerntet u. wie hoch war der Wert dieser Ernten?“! Ich möchte diese Fragen auch beantworten, aber ich muß immer wieder darauf hinweisen, daß doch seit Beginn des 1ten Weltkrieges zunächst die deutsche Währung u. mit dem 2ten Weltkrieg auch die Währung sämtlicher anderer Staaten, vielleicht mit Ausnahme der Schweiz, heillos in Unordnung geraten ist u. daher höchstens Vergleiche mit der Zeit vor dem 1ten Weltkrieg für die Zeit von 1924 bis 1934 zu ziehen sind, das ist die Zeit nach Beendigung der Inflation bis zur nationalsozialistischen Herrschaft, wo sofort wieder angefangen wurde, mit den Währungen im deutschen Reich u. in Danzig zu jonglieren. Die Inflation der deutschen Währung, die bis Herbst 1923 auch in Danzig maßgebend war, wurde nicht ganz zu gleicher Zeit beendet. Die Währungsreform für Danzig, das ja seit Jan. 1920 „Freie Stadt“ war, wurde Herbst 1923 dadurch beendet, daß Danzig sich von der deutschen Währung lossagte u. den Danziger Gulden einführte der sich auf das engl. Pfund stützte, im Verhältnis von 1 Pf Sterl=25 Danziger Gulden. Nach Stabilisierung der Deutschen R.mark galt der Danziger Gulden 0,80 R.M.
Die Währungsreform in Deutschland wurde später fertig u. zwar im Frühjahr 1924. Sie wurde als ein Wunder betrachtet u. von den einen Herrn Helferich, von den andern Herrn Schacht, Reichsbankpräsident u. Wirtschaftsminister in Berlin nachgesagt. Helferich kam vor Inkrafttreten der Währungsreform bei einem Zugunglück in der Schweiz ums Leben, blieb noch Schacht übrig, dem das Ausland nachsagte, daß er das Ausland dabei schändlich betrogen habe, was ich ihm noch nicht mal so sehr verübeln könnte.
Verhältnis einiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse
1913 R.M. 1925 Danz. Gulden
| Weizen 1 Ctr. | 10.00 | 15 |
| Gerste | 9.00 | 12 |
| Hafer | 9.00 | 12 |
| Roggen | 8.00 | 12 |
| Zuckerrüben | 1.00 | 1.75 |
| Milch 1 Lit. | 0,10 | 0.10 |
| Mohn 1 Ctr. | – | 50.00 |
| Victoria Erbsen | – | 25.00 |
| Rübensamen | – | 47.00 |
| Leinsamen | – | 25.00 |
| Schweine | ||
| Rinder |
Geerntet wurden
1909-1913 1925-1929
| Weizen pr.pr.Morg. | 16 Ctr. | 16 Ctr. |
| Gerste “ “ | 16 “ | 17 “ |
| Hafer | 17 | 17 |
| Roggen | 14 | 12 |
| Zuckerrüben | 160 | 180 |
| Milch pr Kuh | 3800 Lit. | 3400 ltr |
| Mohn pr.pr.Mg | – | 6,00 Ctr |
| Victoria Erbsen | – | 14.00 |
| Rübensamen | – | 13.00 |
| Leinsamen (Öllein) | – | 10.00 |
| Senf | – | 10.00 |
| Süßlupinen | – | 8.00 |
| Mais (Pfarrkirchner) | – | 20.00 |
| Kartioffeln125.00 |
Die Bewirtschaftungsweise lag nicht streng fest. Es war eine sogenannte Conjunktourwirtschaft mit regelmäßiger Kleefolge u. zwar derart, daß möglichst nicht Getreide oder Rüben hinter sich selbst gebaut wurden. Es waren eine Anzahl Früchte hinzugekommen, die wir vor dem ersten Weltkrieg nicht angebaut hatten. Mohn u. Victoria Erbsen gediehen in den ersten Jahren prächtig, aber nach etwa 10 Jahren waren die Erbsenkrankheiten, wie Braunfleckenkrankheit u. der Erbsenwickler so schlimm, daß wir den weiteren Anbau aufgeben mußten. Beim Mohn fanden sich Wurzelschädlinge, welche die Pflanzen während der Blüte zum umfallen brachten. Daß wir diese schönen Vorfrüchte für Weizen vom Anbau streichen mußten, tat uns sehr leid. Auch Rübensamen war eine gute Vorfrucht für Weizen, aber von 1925-1935 war es eine Stümperei mit dem Rübensamen. Man konnte zwar immer Stecklinge für einen ganzen Schlg., das waren bei mir ca.30 [80?] pr. Morgen anbauen, aber wieviel man davon auspflanzen konnte, bestimmte die Zuckerfirma, u. ich habe manchen großen Posten Rübensamenstecklinge vernichten müssen, weil die Zuckerfirma keinen Absatz für den Samen hatte. Von 34/35 an kamen dann bessere Zeiten für den Rübensamenbau, u. man konnte bis Kriegsende alle geernteten Pflanzen auch auspflanzen. Der Rübensamen wurde mitunter von den Blattläusen sehr beschädigt. In den letzten Jahren waren wir aber davon verschont geblieben. Es war auch neuerdings ein Bekämpfungsmittel (Gesasol) erzeugt, ich habe es aber nicht mehr ausprobiert. Als Neuerung war auch der Anbau von Leinsamen, Mais und Süßlupinen hinzugekommen, wovon der Erstere hauptsächlich seines Samens wegen angebaut wurde, aber in der Kriegszeit war auch das Stroh gut abzusetzen. Mais brachte kolossale Ernten, wurde aber im Kriege so niedrig im Preise angesetzt, daß sich der Anbau in größerem Umfang von selbst verbot.
Mit Süßlupinen war der Sandboden gut auszunützen u. waren außerdem eine gute Vorfrucht für Kartoffeln, Mohrrüben u. Roggen, die Erträge waren zunächst noch nicht sehr groß, u. außerdem geben Lupinen leicht Schnecken ins Land, aber wenn man Kartoffeln dahinter baute, konnte man der Schnecken schon Herr werden. Senf hatte in Friedenszeiten einen so geringen Preis, daß man ihn zumeist nur als Notnagel benutzte, wenn mal was umgepflügt werden mußte. Er konnte spätere Aussaat ertragen. Im Kriege war auch Senf sehr begehrt. Auch Rotkleesamen (ein und zweischnittiger) u. Grassamen (Wiesenschwingel) wurde von mir in meiner langen 52jährigen Wirtschaftszeit zeitweise angebaut u. Raps (nur in Brodsack). Von all diesen vielen Früchten meiner ganzen Wirtschaftszeit war der 2schnittige Rotklee die unsicherste Frucht. Sonst wurde im Gr. Werder auch zeitweise Kümmel u. Spinatsamen u. im Kriege viel Gemüse angebaut. Ich habe Pflückerbsen, frühen Weißkohl u. rote Mohrrüben angebaut, die alle hohe Erträge brachten. Mit Mohrrüben habe ich auf meinem Sandboden weit höhere Einnahmen erzielt, wie von meinem besten Weizen. Dieser umfangreiche Hackfruchtbau an Rüben u. Rübensamen, ev. Kartoffeln u. Gemüse aller Art, war natürlich nur möglich, wenn ein guter Preis u. restlose Abnahme garantiert wurden u. die vielen dazu benötigten Arbeitskräfte beschafft werden konnten. In der Hauptsache bestanden diese Arbeitskräfte aus polnischen Saisonarbeitern, die vor dem Kriege regelmäßig zum Winter in die Heimat entlassen werden mußten u. zum 1.April wieder eingestellt werden konnten. Während des Krieges mußten wir die Polen auch über Winter halten, was bei Arbeitnehmern u. Arbeitgebern heftigen Unwillen erregte. Im letzten Kriegsjahr, als der Krieg immer mehr Menschen aus der Wirtschaft abzog, wurden uns Judenfrauen aus dem K.Z. Lager Stutthof zugewiesen; das war dann schon der Anfang vom Zusammenbruch.
Die Weichsel
Unser Schicksalsstrom, die Weichsel, soll in diesem Abschnitt noch besonders behandelt werden.
Von der Eindeichung der Weichsel u. ihres zweiten Mündungsarmes, der Nogat, durch den Ritterorden, habe ich schon gesprochen u. aus dem Zustand in dem sich die Deiche bei Beendigung der Ordenszeit befanden, hat sich während der 300 Jahre Polenzeit kaum etwas geändert. Erst Friedrich der Große nahm den ersten Eingriff in die Stromverhältnisse vor, als er bei seinem Liebeswerben um die schöne reiche Stadt Danzig auf Widerstand bei den selbstherrlichen Danzigern stieß. Da ließ er an der Abzweigung der Nogat die dort befindlichen Bäume, die bisher ein natürliches Eiswehr gebildet hatten, fällen, um dem Weichselwasser den Zugang zur Nogat zu erleichtern u. es den Danzigern zu entziehen. Das gelang auch in gewissem Umfang, aber ohne nennenswerten Schaden für Danzig. Umso größer waren die Schäden für das Große Werder. Es ging nunmehr nicht nur mehr Wasser in die Nogat, sondern auch mehr Eis, das sich in dem verhältnismäßig engen Strombett leicht festsetzte u. zu vielen verheerenden Deichbrüchen führte. In den etwa 100 Jahren vom Beginn der preußischen Zeit bis 1888 brach der Deich bei Halbstadt, bei Schadwalde, bei Schönau 2x, bei Wernersdorf u. 1888 bei Jonasdorf, rechts der Nogat. In dieser ganzen Zeit hat nur ein Dammbruch aus der Weichsel bei Gr. Montau stattgefunden.
Als die Napoleonischen Kriegswirren vorüber waren, war der preußische Staat wohl so erschöpft, daß er für die Verbesserung der Stromverhältnisse der Weichsel einstweilen nichts tun konnte, als Weichselregulierung zu planen. Zunächst versuchte er den unerwünschten Wasser und Eiszufluß zur Nogat dadurch zu mindern, daß er den Einlauf des Weichselwassers in die Nogat etwa 3 klm weiter nach unten verlegte u. dort einen Kanal anlegte, der nicht mehr im spitzen sondern im rechten Winkel von der Weichsel abzweigte. Als auch dieses Mittel nichts half, baute man in den Kanal aus starken Baumstämmen ein Eiswehr ein, welches das Eis festhalten u. das Wasser durchlassen sollte. Aber das nächste Hochwasser nahm das ganze Wehr mit. Das war etwa im Jahre 1840, zu der Zeit, als die Weichsel von sich aus zu regulieren begann und bei Neufähr die Düne durchbrach und sich selbst eine neue Mündung schaffte. Damit waren die Regulierungsarbeiten einstweilen beendet. Bei Plehnendorf wurde kurz oberhalb des Dünenbruches die bisherige Danziger Weichsel koupirt u. eine Schiffahrtsschleuse eingebaut, u. damit war nun die sogenannte tote Weichsel geschaffen, die nunmehr vom Stande des Wassers in der Stromweichsel unabhängig war und als Holzhafen benutzt wurde. 1855 brach dann bei sehr hohem Wasser der Damm bei Gr. Montau. Es war der verheerendste Deichbruch, den das Große Werder erlebt hatte, aber auch er brachte die lange gehegten Regulierungspläne nicht zur Reife. Es wurden zwar von der Regierung bald nachdem Eisbrecher gebaut u. die Weichsel, meistens schon im Februar, bis Thorn aufgebrochen, wenn der Wasserstand es zuließ, u. einige Eisbrecher, die nicht vor Ort arbeiteten, patroullierten ständig im unteren Weichsellauf u. verhinderten ein erneutes Festsetzen des Eises. Aber es war doch kein Radikalmittel u. besonders in der Nogat garnicht anzuwenden, weil das Haff beim Eisgang der Weichsel noch immer fest zugefroren war u. damit das Abschwimmen des losgebrochenen Eises unmöglich machte. Außerdem war die Nogat damals auch schon so versandet u. flach geworden, daß ein Eisaufbruch mit Eisbrechern auch deswegen nicht in Frage kam. Erst die jüngste Katastrophe, der Dammbruch bei Jonasdorf, brachte den lange gehegten Weichsel Regulierungsplan zur Reife. Zunächst wurde in den Jahren 1890-94 der Weichsel zwischen Nickelswalde u.Schiewenhorst eine neue Mündung geschaffen, die bei Eislage durch eine neue Schiffahrtsschleuse mit der nunmehr wieder koupierten Danziger Weichsel verbunden wurde. Dann wurden die Deiche an der Weichsel stromauf, zu beiden Seiten des Stromes, wo es notwendig war, so verlegt, daß ein gleichmäßig 1000m breites Hochwasserstrombett entstand. Dazu war es notwendig, daß die Deiche stellenweise näher an den Strom herangerückt u. stellenweise weiter abgelegt werden mußten. Eine Heidenarbeit! Im Laufe von weiteren 20 Jahren, also 1912, war diese Arbeit bis oberhalb der Nogatabzweigung beendet u. auch die Regulierung der Nogat durch Ausbaggerung u. Einbau von 4 Schiffahrtsschleusen bei Weissenberg, bei Schönau, beim Galgenberg u. bei Horsterbusch, wodurch der Wasserstand in der Nogat reguliert werden konnte, denn etwas Wasser aus der Weichsel sollte der Nogat auch ferner zugeführt werden.
1912 begann man dann in Liessau mit dem Schlußstück des Weichselregulierungsprojektes, das war die Verlängerung der beiden Brücken zwischen Dirschau u. Liessau, die von 750 auf 1000m verlängert wurden und in der Zurückverlegung der angrenzenden Dammenden. Die Erde dazu mußten die großen Aussendeichweiden bei Liessau, unsere Hauptviehweiden, hergeben. Die Außendeiche wurden planmäßig etwa 1m abgegraben, der obere Stich aber zurückgeworfen u. nach Beendigung der ganzen Arbeiten wurden die jetzt rohen Aussendeichländer wiederangesät. Es war eine erhebliche Wirtschaftsbehinderung für uns, aber einige Verbesserungen fanden auch insoweit statt, daß die bisher im Aussendeich vorhandenen Löcher in der Nähe des Dammes zugemacht wurden. Der am 1. Aug. 1914 ausbrechende 1. Weltkrieg fand zwar schon die verlängerten Brücken fertig vor, aber die schon begonnene Abtragung der alten Dämme, die ja jetzt als Hindernis im Aussendeich lagen, sowie die schon begonnene Abschließung der Nogat, mußten unterbrochen werden, konnten aber 1915 zu Ende geführt werden. So war denn in 25 Jahren die Weichselregulierung in großzügiger Weise durchgeführt und nach weiteren 30 Jahren, als wir auch mit der Regulierung der Binnenentwässerung fertig waren, mußten wir davon!
Das große Marienburger Werder, das bis 1920 ein Teil des Kreises Marienburg gewesen war, wurde bei Gründung der Freien Stadt Danzig ein Teil dieses kleinen Staatsgebietes u. bildete in diesem zunächst den Kreis Gr. Werder, scharf umgrenzt von der Danziger Weichsel, der Elbinger Weichsel, dem frischen Haff u. der Nogat. Von diesem scharf abgegrenzten Gebiet war allerdings bis 1920 eine wesentliche Ecke, im Nordosten des Deltas gelegen, Elbinger Kreisgebiet gewesen, das bis hart an die neue Kreisstadt Tiegenhof heranreichte. Die Dörfer Gr. Mausdorf, Kl. Mausdorf, Krebsfelde, Lupushorst, Lakendorf, Fürstenau, Rosenort, -Rheinland, Walldorf, Jungfer u.die Elbinger Einlage mit den Dörfern Robach,Einlage u. Zeyer u. den Kampen Zeyersvorderkampe u. Schlangenhaken waren bis dahin Elbinger Kreisgebiet. In der nationalsozialistischen Zeit war dann der Kreis Danzig-Höhe u. Danzig Niederung zusammengelegt, aber der östlich der neuen Stromweichsel gelegene Teil, die sogenannte Nehrung u. die Kampen der Elbinger Weichsel waren dem Kreis Gr. Werder zugeteilt, so daß der neue Kreis Gr. Werder bis an die Ostsee reichte u. etwa folgende Dörfer umfaßte: Schönbaum, Prinzlaff, Freienhuben, Nickelswalde, Steegnerwerder, Steegen Stutthof,Junkerstroyl, Fischerbabke, Poppau u. die Kampen der Elbinger Weichsel sowie Grenzdorf a. P.Diese Kampen der Elbinger Weichsel u. der Nogat, waren wohl das jüngste Siedlungsgebiet u. fast ausschließlich von Mennoniten holländer Abstammung bewohnt. Ein eigenes Entwässerungsgebiet mit eigenem Deichhauptmann bildete die Elbinger Einlage, die ich vorseitig schon erwähnte. Über ihre Entstehung bin ich mir nicht ganz klar. Sie lag auf einer Strecke von etwa 10 klm. zwischen dem Nogatdamm u. dem sogenannten Werderdamm u. diente der Entlastung der Nogat, deren Strombett hier von den beiderseitigen Nogatdämmen stark eingeengt wurde u. mußte sich im Winter u. Frühjahr die Überschwemmung durch das Nogatwasser gefallen lassen. Ob nun der Nogatdamm zuerst geschüttet u. die Einlage erst später durch Schüttung des Werderdammes gebildet wurde, oder ob der Werderdamm zuerst geschüttet wurde u. dann zur Gewinnung von Siedlungsland der Nogatdamm, weiß ich nicht. Ich möchte aber das letztere annehmen. Es befanden sich in dem Nogatdamm 3 Überfälle, das waren Strecken im Damm von etwa 100 m. die im Winter offen waren u. zum Sommer nach Beendigung des Eisganges u. Frühjahrshochwasser wieder geschlossen wurden, um das Sommerhochwasser fernzuhalten. Diese Arbeiten wurden von der Regierung ausgeführt; sie garantierte aber nicht für die Haltbarkeit der Sommerdeiche. Und so kam es doch gelegentlich vor, daß die Überfälle bei besonders hohem Sommerwasser brachen und erhebliche Teile der Einlage überschwemmten. Es war ein schöner milder, etwas kaltgründiger Boden, der naturgemäß zum großen Teil als Wiese genutzt wurde. Aber es gab auch ganz erhebliche Ackerflächen u. viele stattliche Höfe, die ausschließlich alle am Nogatdamm entlang lagen u. ihre Stallungen schon so hoch gestellt hatten, daß bei normalem Frühjahrshochwasser, alles Vieh im Stall bleiben konnte. Solche Katastrophen, wie der Eisgang 1888 waren einmalig u. jetzt nach dem Abschluß der Nogat ausgeschlossen.
Der Winter 1887/88 und seine Folgen für die Weichselniederungen
Es sind nur noch wenig Menschen am Leben, die sich des grimmigen Winters 87/88 u. seiner Folgen erinnern können, deshalb will ich dieses Ereignis eingehend schildern.
Der Winter war bis Ende Januar nicht außergewöhnlich. Von Weihnachten bis Ende Januar war leichter Frost u. flache Schlittenbahn, aber Ende Januar bis Ende März folgte ein Schneesturm nach dem andern, so daß bald überall 1m Schnee auf den Feldern lag u. die Schlittenbahnen auf den Chausseen u. viel befahrenen Landwegen zu richtigen schmalen Dämmen auswuchsen, auf denen sich die Pferde drängten und schließlich ein Fahren mit 2 Pferden fast unmöglich wurde. Dabei oft 20-25° Kälte. Unter solchen Verhältnissen war der halbe März vergangen, als man bei uns munkelte, im oberen Weichsellauf wäre Eisgang eingetreten. Da wir dauernd 20-25° Kälte hatten, wollte kein Mensch daran glauben u. wir nahmen an, wenn schon oben Eisgang eingetreten sein sollte, so würde das Eis bei diesem Frost schnell wieder zum stehen kommen. Das mußte auch unser Deichamt angenommen haben, denn es wurden keine Vorbereitungen für eine Eiswache an den Strömen angeordnet. Da überraschte uns am Montag d. 19. März 1888 in Irrgang, wie überall bei 20° Frost, die Nachricht, die Nogat wäre in der vergangenen Nacht aufgebrochen u. der Eisgang auf der Nogat, nicht aber auf der Weichsel, wäre in vollem Gange. Befehl: „alle Mann an die Deiche“! Und nun entwickelte sich das ganze Drama mit rasender Schnelligkeit. Die Weichsel hatte sich kurz unterhalb der Nogatabzweigung bis auf den Grund verstopft u. ließ weder Wasser noch Eis durch, so daß sich der ganze Eisgang durch die viel zu enge Nogat abspielen mußte, die doch in das frische Haff mündete, das mit einer 1m starken Eisschicht bedeckt war. Zunächst ging alles verhältnismäßig gut, aber nach 1-2 Tagen war die Elblinger Einlage mit Eis vollgestopft, das Wasser in der Einlage stieg u. stieg, die Ställe genügten längst nicht mehr, das Vieh wurde durch das Wasser an den Nogatdeich geschwommen u. auf dem Deich zunächst vor dem Ertrinken gerettet, aber manches schöne Tier ertrank doch in den eisigen Fluten u. am Werderdamm beim Koll wehrten sich die Werderbauern mit ihren Leuten verzweifelt gegen einen Bruch ihres Dammes, unter Leitung ihres Deichgeschworenen VollerthunFürstenau (des späteren Deichhauptmanns). Unseres Irrganger Schmiedemeisters Schwiegermutter wohnte am Koll, wo die Bruchgefahr groß war, u. fuhr mit Schlitten hin, die alte Frau zu holen. Aber da kam er schlecht an, wenn er glaubte, die alte Frau würde sofort bereitwillig mitfahren: „Beschiet ju man nichwegen dem bät Woater“! [Bescheiß dich man nicht wegen dem bisschen Wasser], damit fertigte sie den besorgten Schwiegersohn ab. Eine weitere Gefahrenstelle ergab sich bei Halbstadt, bis wohin vom Haff durch die Einlage u. Nogat die Eisverstopfung reichte. Aber gegen Ende der Woche ließ der Wasser u. Eiszufluß von oben nach u. man atmete etwas auf. Am Koll tat einstweilen Vollerthun weiter seine Pflicht, unterstützt von dem Deichinspektor Götter, der neben vielen guten Eigenschaften, auch die üble Eigenschaft des stotterns besaß. Deichgeschworener und Deichinspektor konnten aber natürlich nicht ununterbrochen arbeiten, sie mußten zwischendurch auch mal was essen, u. das war an dem abgelegenen Koll in der einsamen Wachbude etwas schwierig. Vollerthun verhandelte also mit der Frau des Wachbüdners, natürlich auf Plattdeutsch, über ein warmes Mittagessen u. Götter hörte interessiert zu: „Fruke, käne se ons nicht wat warmet to Möddag moake? Ick häw blos Kielke möt Speck! Na dat es joa uck en schönet Ete, also moake se nur moal föx twe Portione.“ [Frauchen, können Sie uns nicht was Warmes zu Mittag machen? Ich hab bloß Keilchen mit Speck! Na, das ist ja auch ein schönes Essen, also machen Sie nur mal fix zwei Portionen].Worauf Götter empört ausrief:„K’K’Keilchen freß ich nicht!“
Aber bald mußten Deichgeschworener u. Deichinspector das Feld ihrer Tätigkeit nach Halbstadt verlegen, das ebenfalls zum Revier Vollerthuns gehörte. Die augenblickliche Erleichterung in der Mitte der Woche, wich am Sonnabend d. 24. März einer weit größeren Gefahr. Wie allgemein üblich, kam auch jetzt, nachdem am 19. März das Weichselwasser u. Eis heruntergekommen war, etwa eine Woche später das Eis u. Wasser aus den großen Nebenflüssen der Weichsel, dem Bug u. dem Narew, am 24./25 März (Palmsonntag) herunter, und die Eisversetzung in der Weichsel, dicht unterhalb der Nogatabzweigung, war u. war nicht zu beseitigen, trotzdem Danziger Pioniere schon seit dem 19. März in Tag u. Nachtschichten daran gearbeitet hatten. Nun sollte die total verstopfte Nogat auch noch diese neuen Wasser u. Eismassen aufnehmen. Das mußte unweigerlich zu einem Dammbruch führen; es war nur noch die Frage nach welcher Seite. So kam der Palmsonntag heran. Bei dem schönen, jetzt auch milder gewordenen Wetter, bekam ich zum erstenmal nach meiner Erkrankung an Gelenkrheumatismus, der mich seit Ende Januar an das Bett u. zuletzt nur noch an das Zimmer gefesselt hatte, die Erlaubnis, mit meinen Brüdern Hans u. Otto (Peter war auf Eiswache) per Schlitten nach Schadwalde an die Nogat zu fahren u. mal nachzuschauen, wie es dort u. besonders in Halbstadt stände, von wo sehr bedrohliche Nachrichten zu mir gedrungen waren. Als wir ein paar Kilometer hinter Gr. Lesewitz u. etwa noch 3 klm von der Nogat entfernt waren, sahen wir bei Schadwalde ein zweimastiges Schiff mit voller Takelung auf dem Nogatdamm stehen. Wir rieben uns die Augen, weil wir an eine Luftspiegelung glaubten, denn, wie sollte ein großes Schiff auf den Nogatdamm kommen!? Aber es blieb dabei! auf dem Damm stand ein Zweimaster u. streckte seine Maste kerzengerade in den blauen Frühlingshimmel. Und dann sahen wir noch etwas anderes, was wir uns nicht erklären konnten. An dem schneeweißen Nogatdamm führten in unregelmäßigen Abständen von 20-50 m schwarze Striche von 2-4 m. Breite in genau senkrechter Linie an den Fuß des Deiches. Es sah aus, als ob dort der Schnee bis auf den schwarzen Erdboden weggeschaufelt wäre. Jedenfalls konnten wir uns auch dieses Phänomen nicht erklären. Wie wir noch bei der Betrachtung dieser „Wunder“ waren, hatten wir inzwischen, so bei Herrenhagen, den alten Gastwirt Jantzen aus Gr. Lesewitz eingeholt, der nun eine kurze Strecke vor uns herfuhr, als wir plötzlich auf einen großen Troß von Menschen, Wagen u. Pferden stießen, die vom Nogatdamm herkamen u. die Gr. Lesewitzer Eiswache bildeten, die auf Befehl ihrer Regenten Döhring Gr. Lesewitz vom Nogatdamm bei Schadwalde nach Hause floh, weil nach Döhrings Ansicht doch nichts mehr zu helfen war. Wir mußten ausweichen, um den Troß vorbei zu lassen u. erfuhren nun auch die Erklärung für das Schiff auf dem Nogatdamm u. die Furchen in der Schneedecke des Nogatdammes. Das Wasser in der Nogat war nämlich so hoch gestiegen, daß es vielfach überfloß u. den Schnee auf diesen Stellen weggespült hatte. Da der Damm überall gleich hoch war, hätte er eigentlich überall überfließen müssen, da sich aber vielfach gewaltige, meterdicke Eisschollen auf den Damm geschoben hatten, so stellten sie vielfach eine Erhöhung des Dammes vor. Zuweilen rollten auch Eisschollen über den Damm hinweg u. fielen auf der Landseite herunter. Das machte die stellenweise am Damm entlang führenden Wege höchst unsicher. Zunächst waren wir aber noch auf dem Wege nach Schadwalde u. hörten, wie der alte Janzen seine Gr. Lesewitzer Landsleute ausschimpfte für ihre Flucht. „Öss dat ne Genehmigung förr eene Iswacht, vom Damm wegtorenne,wenn et en bät äwerrennt!An de achtunvörtig he[?]wtet 2 Doage äwer den Damm gerennt, on wie häwe den Damm doch gehole“! [Ist das eine Genehmigung für eine Eiswacht, vom Damm wegzurennen, wenn es ein bisschen überläuft! Im Jahr 1848 ist es zwei Tage über den Damm geflossen, und wir haben den Damm doch gehalten!].Diese Fahnenflucht trug dem Regenten Döhring auch ein Strafmandat u. vor allen Dingen recht kühle Behandlung durch seine Landsleute ein. Auch das Wunder mit dem Schiff auf dem Nogatdamm hatte sich nun gelöst. Das Schiff war im Herbst bei Schadwalde eingefroren u. nun von dem riesigen Hochwasser zwar nicht auf den Damm gehoben aber dicht an den Damm herangetrieben, so daß es aus der Ferne den Eindruck machte, als stände es auf dem Damm. Aber solche Fälle von Fahnenflucht waren doch sehr vereinzelt. Bei Halbstadt, wo es viel gefährlicher war, wie bei Schadwalde, wurde weiter um die Erhaltung des Dammes gekämpft. Sandsack auf Sandsack wurde herangeschleppt u. an der kritischen Stelle versenkt. Baumstämme wurden an der Stromseite des Nogatdammes angebracht, um das Eis abzuwehren, das den Deichkörper wegscheuern wollte. Und die fast übermenschliche Anstrengung hatte Erfolg – für uns im Gr. Werder. Denn der Damm auf der rechten Nogatseite brach fast genau unserer Gefahrenstelle bei Halbstadt gegenüber, bei Jonasdorf, u. das Wasser ergoß sich nun ungehindert in das kleine Marienburger Werder u. schaffte uns bei Halbstadt sofort Erleichterung. Das war etwa 3 Uhr Nachmittag. Aber inzwischen hatten die Gr. Werderschen u. besonders die Anwohner der Nogat viele Stunden in großer Angst verlebt. In Schadwalde, hart am Nogatdamm, wohnte Bauer Hahn, dessen Sohn Arzt geworden war u. sich mit einem Frl. Friedrich aus Blumstein verlobt hatte. Das Brautpaar wollte bei dem Vater in Schadwalde einen gemütlichen Palmsonntag verleben. Aber als das Wasser in der Nogat an diesem Tage erst so weit stieg, daß es über den Damm lief u. die Eisschollen über den Damm u. vor Vaters Haustür kollerten, da hörte sich die Gemütlichkeit auf und das junge Paar floh entsetzt nach Blumstein zu den Eltern der Braut, etwa 3 klm stromauf von Schadwalde, wo es aber auch nicht besser war. Und so lief das Wasser von Halbstadt bis Wernersdorf, also etwas 20 klm über den Damm. Wir 3 Brüder hatten aber kurz vor Schadwalde kehrtgemacht, weil wir doch auch nicht von dem unvermeidlichen Dammbruch unterwegs überrascht werden wollten u. waren etwa um 4 Uhr wieder zu Hause. Da war der Vater eben mit meinem späteren Schwager Bernhard Penner aus Kalthof zurückgekehrt, wo die Mutter des Letzteren damals, ganz in der Nähe der Nogat, wohnte und sich nach Gerüchten von dort in Gefahr befinden sollte. Die Besorgnisse des Sohnes um seine Mutter waren auch nicht unberechtigt, denn 100 Schritt von ihrer Wohnung entfernt befand sich ein weiterer ganz böser Gefahrenherd, das sogenannte Schlapploch im Nogatdamm, das die Zufahrt zur Schiffbrücke Kalthof-Marienburg erleichtern sollte. Aber es erleichterte mit seinem 1-2m. tiefen Einschnitt in den Nogatdamm auch dem Nogatwasser den Eintritt in das Werder, und dagegen wehrten sich an diesem denkwürdigen Palmsonntag die Werderaner unter Führung ihres zuständigen Deichgeschworenen Theodor Tornier Tragheim buchstäblich mit Händen u. Füßen. Als Vater nun, wie vorseitig erwähnt, von Kalthof zurückkam, u. wir von unserm Ausflug nach Schadwalde, da sagte er: „Jungens, jetzt fahrt sofort nach Kalthof u. Marienburg u. bevor ihr nach Kalthof einfahrt, macht noch einen Abstecher in Kaminke an den Nogatdamm u. geht den Damm hinauf, da werdet ihr was sehen, was ihr in eurem Leben wahrscheinlich nicht mehr sehen werdet“! Und als wir nun an den Nogatdamm gekommen waren, stiegen mit uns die beiden Tannsee’er Großbauern Bielfeld u. Schröter, beide von riesigem Körperbau, den Damm hinauf. Der Anblick, der sich uns bot, war allerdings unvergeßlich u. entlockte dem Einen den Ausruf: „Na joa, de Komm es voll, et kanngeläpelt ware!“ (Na ja, die Schüssel ist voll, es kann gelöffelt werden). Und der Vergleich mit einer bis zum Rande gefüllten Schüssel mit Brotbrocken darin, war garnicht so abwegig. Vor uns das Wasser, noch immer bis zur Dammkrone u. in dem Wasser, von dem eigentlich nur am Rande etwas zu sehen war, Eisscholle an Eisscholle fast unabsehbar u. in star[r]er Ruhe. Der Bruch bei Jonasdorf war soeben erfolgt u. die Räumung der Weichsel von ihrer Eisversetzung an der Nogatabzweigung auch, so daß das Nogatwasser nun nach 2 Seiten abfließen konnte, aber das wirkte sich nicht so schnell u. augenscheinlich aus. Als wir dann nach Kalthof kamen, war Deichgeschworener Tornier noch immer im Dienst u. stand, bis zum halben Knie im Wasser u. ließ Sandsack auf Sandsack an die bedrohten Stellen verpacken u. hatte sich schon ganz heiser geschrieen. Das war so gegen 6 Uhr u. die Gefahrenstelle schon so ziemlich abgedichtet, aber es muß einige Stunden vorher sehr kritisch ausgesehen haben, als schon soviel Wasser durchkam, daß meterdicke Eisschollen durch die Hauptstrasse von Kalthof geschwemmt wurden u. Kalthof von der Zivilbevölkerung geräumt war. Wir gingen dann noch über die Eisenbahnbrücke nach Marienburg u. konnten dort eigentlich zuerst feststellen, daß der Wasserstand der Nogat merklich gefallen war. Das Denkmal Friedrichs des Großen stand zwar immer noch in seichtem Wasser, aber an den Gittern zeichnete sich der erhöhte Wasserstand sehr deutlich ab. An dem obersten Lauf der Nogat trat der einmalige Zustand ein, daß die Nogat wegen der plötzlich geschaffenen Vorfluth, durch Räumung der Eisverstopfung in der Weichsel, rückwärts floß. Das war der Palmsonntag 1888, der das Weichselregulierungsprojekt nun endlich zur Reife u. zur Ausführung brachte. Die Probe auf das Exempel hat die Weichsel dann in den Tagen um den 1. April 1924 bestanden, als das gesamte Hochwasser von Weichsel, Bug u. Narew zugleich herunter kam u. das gesamte Eis in 2 Tagen die Dirschauer Brücken passierte, bei einem Wasserstand von 8,70 am Liessauer Pegel. Das war ein Triumph der deutschen Strombaukunst!
Der große Werder war nun zunächst der Wassersgefahr aus Weichsel u. Nogat überhoben, aber unsere Landsleute im Kleinen Werder hatten jetzt die Not. Der Bruchstelle gegenüber standen 3 Hausbauten der Gemeinde Jonasdorf, deren Besitzer Arnst, Sönke (der 3te Name ist mir entfallen, ich glaube er hieß Krüger) hießen, etwa 200-300 m. vom Damm entfernt. Am Tage nach dem Bruch stand ich mit vielen Anderen bei Halbstadt auf dem Nogatdamm und schaute durch die Bruchstelle ins kleine Werder, in das die Wasser der Nogat in furchtbarem Strudel hineinstürzten. Von den Gebäuden der 3 Höfe waren nur noch Wohnhaus u. Stall von dem Soen[n]ke’schen Hof zu sehen, auf denen Notflaggen wehten. Aber es konnte von unserer Seite an diesem Tage noch Niemand hinüber, u. so waren wir im unklaren, ob dort drüben in den tobenden Wassermassen noch Jemand am Leben wäre. Für die Angehörigen u. Freunde der betroffenen 3 Familien, die sich unter uns auf dem Nogatdamm bei Halbstadt befanden, natürlich schmerzliche Stunden. Nun ich schon einmal in Halbstadt war, besah ich mir auch die, ein paar hundert m. entfernte Stelle in unserem Deich, an der tagelang so verzweifelt gekämpft worden war. Das Wasser war hier, so nahe an der Bruchstelle, natürlich schon viele Meter abgesunken, so daß man den Damm u. die schlechte Stelle im Damm sehr genau betrachten konnte. Und wenn man sich diesen fast von reinem Sand geschütteten Damm ansah und ihn mit dem gegenüber liegenden u. eben gebrochenen Damm verglich, der sehr deutlich als reiner Lehmdamm zu erkennen war, dann mußte man auf den Gedanken kommen, ob die Eiswachen aus dem kleinen Werder auch ihre Pflicht getan hatten?! Diese Frage wurde damals auch viel erörtert u. dabei immer sehr anerkennend der Mannschaft aus dem großen Werder gedacht, die diesen erbärmlichen Damm gehalten hatte. Die größte Hilfe dabei, das konnte man an diesem Tage schon feststellen, war der Umstand, daß die Dämme, allerdings auf beiden Seiten u. auch in ihrer ganzen Länge mehrere Meter tief gefroren waren, und da Sand bekanntlich noch leichter friert, wie Lehm, so könnte das vielleicht eine Erklärung für die Standhaftigkeit unseres Dammes in Halbstadt sein. Jedenfalls stürzte die, von der Wasserseite aufgeweichte Dammhälfte sofort in sich zusammen, als das Wasser wegfiel.
Einen grandiosen Anblick bot die etwa 10 m. hohe Eiswand in der Nogat, kurz unterhalb der Bruchstelle. Und über dieses Eis wagten sich am nächsten Tage tollkühne Fischer unter Mitnahme ihres Kahnes u. erreichten auch glücklich die auf dem Soennke’schen Hof eingeschlossenen 3 Bauernfamilien, von denen alle Mitglieder am Leben waren. Ich bin dann im Sommer 1888, während der Widerherstellungsarbeiten für den Damm, noch einigemale an der Bruchstelle gewesen u. habe auch die Ruinen des Soennke’schen Hofes besucht. Das sehr gute, massive Wohnhaus war besonders stark beschädigt, wo es unterkellert war; die Keller waren eingestürzt. Der übrige, größere Teil war gut erhalten u. hatte den 3 Familien das Leben gerettet. Der massive Stall war auch stehen geblieben, aber bis zur halben Höhe voll Sand geschüttet, aus dem die Tierkadaver ab u. zu hervorragten. Die Scheune wie auch die Holzgebäude der 2 Nachbarhöfe waren verschwunden, aber sonderbarerweise war der Soennke’sche große Strohhaufen fast unbeschädigt stehen geblieben. Das ganze versandete Gelände wurde nach einigen Jahren aufgeforstet u. das Soennke’sche Wohnhaus Försterei. Die 3 Bauern Soennke, Arndt u. Krüger wurden vom Stadtgut entschädigt, wie auch die vielen andern Geschädigten. Ja, die öffentlichen Sammlungen im ganzen deutschen Reich ergaben zusätzlich so große Summen, daß böse Zungen behaupteten, die Leute aus dem kleinen Werder hätten ihr Gebet dahin abgeändert: „Herr, gieb uns unser täglich Brot u. alle Jahr eine Wassernot“! Jedenfalls war es ein Ereigniß, das im ganzen deutschen Vaterlande großes Aufsehen erregte u. auch die Künstler (Maler) anlockte u. manches naturgetreue Ölbild zeigte nachdem noch viele Jahre Motive aus dieser überschwemmten Landschaft. Auch die Kaiserin Friederike [Kaiserin Friedrich?]kam am 9. Juni nach Marienburg u. machte eine Wagenfahrt von Marienburg nach Elbing durch das soeben passierbar gewordene Überschwemmungsgebiet.
Auch ich habe mit meinem Vater, mit meinem Onkel Gerhard Wiebe Gr. Lesewitz u. dessen Söhnen Hermann u. Rudolf, zu denen noch 2 von Vaters Leuten kamen, eine solche Kahnfahrt auf dem Überschwemmungswasser von Altfelde nach Elbing u. zurück mitgemacht. Nachdem der große Kahn in Irrgang, der schon über 30 Jahre auf dem Schweinsstallboden gestanden hatte u. natürlich total undicht war, heruntergeholt u. gut abgedichtet u. geteert war und nachdem die benötigte landrätliche Genehmigung beschafft war, traten wir am 9. April 1888 in aller Frühe unsere Reise an. Der Kahn war auf einen Arbeitswagen gesetzt, Vater u. ich sowie die mitzunehmenden Rudersleute stiegen in den Kahn, 4 Pferde wurden vorgespannt u. los ging’s, zuerst nach Gr. Lesewitz, um unsere Verwandten abzuholen u. dann über Tragheim, Marienburg u. Altfelde, bis wir etwa 1 klm. hinter Altfelde schon soviel Wasser vorfanden, daß wir unsern Kahn vom Wagen nehmen u. aufs Wasser setzen konnten. Dann wurde der Wagen nach Altfelde in’s Gasthaus geschickt, mit der Ordre, dort so lange zu warten, bis wir zurückkämen. Mein Vater, der ja in jungen Jahren genügend diesbezügliche Erfahrungen gesammelt hatte, übernahm das Kommando u. das Steuer u. los ging´s, zuerst in Richtung Ellerwald zu 2 verwandten Familien, Suckau u. Klaaßen, beide an der 1ten Trift wohnhaft. Die große Wasserfläche, auf der wir uns jetzt befanden, schien ganz stromlos zu sein, dann aber, als wir nach kurzer Fahrt in die Nähe, der vom Wasser halb zerstörten Posthalterei Fischau u. an den Wall der Fischau kamen, sahen wir schon aus einiger Entfernung, daß das Wasser schäumend über den Fischauwall stürzte, den wir überqueren mußten. Mein Vater hatte schnell eine stillere Stelle erspäht, wo das Wasser offenbar tiefer war, u. ehe wir es uns recht versahen, waren wir mit einem kurzen Ruck über das Hindernis hinweggekommen; die Rückfahrt ging an dieser Stelle nicht so gut. Wir kamen nun schnell vorwärts, da wir ja doch offenbar mit Strom fuhren. Die vielen, im Wasser stehenden Höfe, auf dem einen wurde gerade Heu auf einen in der Scheune schwimmenden Prahm verladen. Viele Landwirte hatten ihre Tiere auf die benachbarten Stuhmer Höhen gebracht u. holten nun Futter aus den Scheunen, soweit es noch brauchbar war. Um 11 Uhr machten wir die erste Station bei Klaaßen, dessen Gebäude so hoch lagen, daß man das Vieh alles in den Ställen lassen konnte. Zur Mittagszeit waren wir dann bei Suckau’s. Der alte Ohm, ein lebenslustiger Mann, der, in kinderloser Ehe lebend, sich wohl selten einen Wunsch versagte, war gerade per Kahn nach Elbing zu einem oder auch einigen Glas Grog gefahren, aber seine nicht weniger lebenslustige Frau u. deren Nichte empfingen uns mit Hallo u. offensichtlicher Freude u. spielten absolut nicht die geknickten, unglücklichen Leute. Das Wasser war etwa 60 cm von seinem höchsten Stande gefallen u. sie dachten wohl schon daran, bald herunterzuziehen, aber erst mußte der aufgetriebene Fußboden neu gemacht u. sonstige Ausbesserungsarbeiten an den Gebäuden ausgeführt werden. Sie befanden sich in ihrem warmen Oberstübchen scheinbar auch sehr wohl u. das Vieh auf dem Stallboden auch, zu dem aus dem Stallgang eine bequeme Treppe hinaufführte. Sie erzählten, daß sie in keiner Weise auf solch hohen Bruchwasserstand vorbereitet gewesen wären. Am Palmsonntag, als sie die Nachricht vom Deichbruch erhalten hätten, hätten sie sofort mit einem Elbinger Zimmermeister die Legung eines neuen Fußbodens auf dem Stallboden u. den Bau von Krippen u. dieser Treppe zu diesem Stallboden vereinbart. Das wurde Montag vorgenommen u. das Vieh wäre auch einigermaßen vernünftig hinaufgegangen, nur eine Kuh wäre störrisch gewesen u. wollte absolut nicht die Treppe hinauf. Aber als ihr das Euter erst durch das dauernd steigende Wasser naß wurde, hatte auch sie den Widerstand aufgegeben. Und so hätten sich Mensch u. Tier recht wohl u. geborgen gefühlt, bis auf einige Sturmtage. Da hatte der Wind das vorbeischwimmende Eis so furchtbar gegen die alten Gebäude geschleudert, daß ihnen doch Himmelangst geworden wäre. Sie erzählten auch, daß öfter Polizeiboote vorbeikämen u. sich nach ihren Wünschen erkundigten u. auch vielen mit allerlei Bedarf aushalfen. Aber Suckaus waren mit allem notwendigen versorgt u. die meisten, zumeist wohlhabenden Nachbarn auch, u. als das Polizeiboot wieder einmal vorbei kam u. nach ihren Bedürfnissen fragte u. sie sich nur ein bisschen Petroleum wünschten, da wurde der Polizeihäuptling grob u. schrie ihnen zu: „Die ganze Trift bin ich schon entlang gefahren u. habe gefragt u. kein Mensch braucht etwas, da werde ich wegen Ihrem Petroleum auch schon nicht herkommen“! Man kann also auch zu bescheiden sein. Nach ein paar Stunden machten wir uns wieder auf den Weg oder auf das Wasser, da wir doch den Ohm Suckau auch besuchen wollten u. trafen ihn denn auch im Hotel zur Hoffnung am Elbingfluß, wo wir mit unserm Boot glatt vorfahren konnten. Aber lange konnte der Aufenthalt hier auch nicht dauern, da unsere alten Herren, sehr gegen unsern Wunsch, sich entschlossen hatten, noch an demselben Abend nach Hause zu fahren. Da wurde denn kräftig gerudert. Wir 3 Vettern lösten die Rudersleute öfter ab, u. da es auf dem Wasser länger hell bleibt, wie auf dem Lande, so kamen wir bei leidlicher Dämmerung bis an den Fischauwall, aber trotz mehrfacher Versuche, nicht hinüber; wir saßen immer auf dem Wall fest, so daß unsere Bootsleute schon unruhig wurden, besonders, als wir auf der Suche nach einer Stelle zum überqueren des Walles unter die vorhin erwähnte zertrümmerte Posthalterei mit ihren verdächtig herabhängenden Balken trieben. Aber da sahen wir auch, daß die an der Posthalterei vorbeiführende Chaussee nur ganz flach mit Wasser bedeckt war, stiegen an der Chaussee aus dem Boot u. schleppten es an 30 m. auf der Chaussee, dann waren wir an der gewünschten oberen Seite des Fischauwalles u. konnten das Boot wieder auf das Wasser setzen u. nach einer weiteren Viertelstunde unsere Kahnpartie glücklich beenden. Unsere alten Herren gingen nach Altfelde u. schickten uns den Wagen. Der Kahn wurde schleunigst aufgeladen u. gegen Mitternacht waren wir von unserer Fahrt auf dem Überschwemmungswasser im kleinen Werder wieder zu Hause. Hier war zwar kein Dammbruch, aber weitgehend überschwemmt wurden unsere Ländereien doch beim auftauen der riesigen Schneemassen, die zudem auch die Abflußgraben vielfach verstopft hatten. Erst am 26. April konnten wir mit der Frühjahrsbestellung beginnen. Nun sagt eine alte Bauernregel: „auf einen harten Winter folgt auch ein sehr schöner warmer Sommer“! Aber dieses Jahr 1888, das auch das 3 Kaiserjahr genannt wurde, war auch in seinem Sommer eine Ausnahme: kalt u. naß. Im August hatten wir mitunter nur 5° Wärme, folgedessen reifte die Ernte spät u. begann erst Mitte August, u. als dann Anfang September das sämtliche Getreide in Stiegen stand u. eingefahren werden sollte, dann regnete es, fast Tag für Tag, u. erst Mitte September hatten wir schönes Wetter bekommen u. konnten dann die Ernte trocken aber etwas ausgewachsen hereinbringen. Solche abnormen Jahre sind mir aus meinem langen Leben einige in Erinnerung geblieben. Sie mögen hier folgen:
1890 war ein sehr früher u. schöner Frühling. Im März u. April war die ganze Bestellung beendet u. am 1. Mai alles grün u. die Viehweiden schon teilweise im April mit sämtlichem Weidevieh beschickt.
1898 hatten wir einen Wintereinbruch schon Mitte Oktober, so daß das Vieh wegen der Kälte vielfach hereingenommen wurde.
1903 hatten wir wieder einen sehr frühen Frühling u. im März das wonnigste Frühlingswetter, so daß die Frühjahrsbestellung außer Rüben bis 1.4. beendet war. Aber dann setzte eine 6-7 wöchentliche Regenzeit ein, so daß erst in der 2ten Maihälfte die Zuckerrüben gesät werden konnten. In einigen Dörfern war den Bauern der März zu früh zur Bestellung; sie bestellten dann erst in der 2ten Maihälfte u. dann noch meistens zu naß und wenn wir, die früh gesät hatten, eine mäßige Ernte hatten, so hatten die spät Bestellenden eine schlechte Ernte.
1908 u. 1909 waren wieder sehr frühe Wintereinbrüche. 1909 trat der Winter noch nicht einmal so aussergewöhnlich früh d.h. Mitte November ein, aber er war andauernd u. mit viel Schnee verbunden, der bis zu den Weihnachtsfeiertagen liegen blieb. Dann begann Tauwetter u. nach Neujahr konnten wir in Ruhe die noch fehlenden Felder pflügen. Der Winter war beendet, nur noch einige Nachtfröste im Februar.
1912 hatten wir, mitten im Oktober anfangend, mehrfach Frost, daß die Rübenernte unterbrochen werden mußte, u. danach Regen. Es war eine schreckliche Rübenernte für Mensch u. Tier, u. erst Mitte November konnten wir die letzten Rüben ernten, die teilweise angefroren in die Abnahme Depots kamen, dort schnell verfaulten u. den Fabriken riesigen Schaden verursachten. Von Mitte November hatten wir mildes trockenes Wetter u. konnten bis Weihnachten alle Felder pflügen.
1924 hatten wir einen ziemlich kalten u. sehr schneereichen Winter u. späten Frühlingsanfang, am 26. Apr. begann die Frühjahrsbestellung, aber wir hatten einen sehr schönen Sommer u. eine gute Ernte. In diesem Frühjahr 1924 war es auch, als die Weichsel am 1. April am Liessauer Pegel den ganz ungewöhnlichen Wasserstand von 8,70 m. zeigte (3 m. unter der Dammkrone) und das ganze Eis von Weichsel, Bug u. Narew innerhalb 48 Stunden unter den Liessauer Brücken durchkam. Wenn die Weichsel Regulierung nicht gewesen wäre, hätte es unfehlbar wieder einen oder mehrere Deichbrüche gegeben.
1929 war in ganz Deutschland ein sehr kalter Winter, in dem zum erstenmal seit Menschendenken viele Obstbäume in den Gärten u. viel Wild in den Wäldern erfroren.
Dann hatten wir 1939/40 u. 41/42 zwei sehr kalte Winter, wie 1928/29 mit oft über 30° Kälte.
Der letztere Winter war so verhängnisvoll für unsere Soldaten in Rußland.
Politisches und kulturelles Allerlei
Der Name „Westpreußen“ ist wohl zum erstenmal aufgetaucht, als Friedrich II das Land bei der 1.Teilung Polens annectierte. Bis dahin hieß es „das polnische Preußen“ Ob die neue Provinz damals sofort eine eigene Verwaltung bekam, oder von Königsberg aus verwaltet wurde, weiß ich nicht. Danzig wurde damals jedenfalls noch nicht Provinzialhauptstadt, denn es kam ja erst bei der 3ten Teilung Polens 1795 an Preußen u. wurde wenige Jahre später 1806 durch Napoleon zur „Freien Stadt“ erklärt u. von ihm bis 1814 besetzt gehalten. Nach der Franzosenzeit wurde das frühere polnische Preußen dann, wohl aus Ersparnisgründen, mit dem früheren Ordensland Preußen zusammengelegt u. führte, bis 1878 den Namen „Provinz Preußen“. Als solche habe ich sie aus meinem ersten Atlas in Erinnerung.
1878 wurde Westpreußen unter diesem Namen dann selbständige preußische Provinz u. erhielt in Herrn von Ernsthausen ihren ersten Oberpräsidenten. Von seinen Nachfolgern sind mir nur die Namen v. Goßler, der vordem schon Staatsminister gewesen war u. v. Delbrück, der vordem Oberbürgermeister von Danzig gewesen war, in Erinnerung. Die Revolution von 1848 hatte auch ein wenig ihre Wellen in meinem Heimatkreis geschlagen. Die Bevölkerung von Gr. Lichtenau rebellierte gegen die Staatsgewalt u. schickte sich an, gen Neuteich zu ziehen, um dort „Ordnung“ zu schaffen. Davon hatten die Neuteicher Wind bekommen u. der Ältermann der Schützengilde, der Jude Jacobi, bewaffnete seine Mannschaft mit den Schützenflinten u. zog den Gr. Lichtenauern entgegen. Als sich die „Heerhaufen“ etwa auf der Mitte des Weges trafen, fiel plötzlich aus den Reihen der Neuteicher ein Schuß; ein Mann von den Gr. Lichtenauern fiel tot um, und jeder Haufen lief schleunigst – 126 – nach Hause. Damit war für diesen Kreisteil wohl die Revolution beendet. Ich weiß aber von meinem Vater, daß er mit andern jungen Leuten Nachts durch die Ladekopper Feldmark patrouilieren mußte; von Zusammenstößen hat er aber nie erzählt. Aber daß damals u. auch vor dem und nach dem viel gestohlen wurde, habe ich von ihm u. meinen älteren Verwandten oft gehört. Die Lage der Bauern hatte sich um die Mitte des 19ten Jahrhunderts sehr gebessert, aber die Löhne der Arbeiter waren nicht gefolgt u. daher wohl die vielen Diebereien landwirtschaftlicher Produkte u. daher auch die revolutionäre Spannung. Die Leibeigenschaft war um 1809 in Preußen aufgehoben. Das berührte die Weichselniederungen kaum, da in diesen Gebieten kein Großgrundbesitz bestand u. daher auch nie Leibeigenschaft eingeführt war. Die vom Ritterorden angesetzten Bauern hatten wohl kaum einen größeren Besitz als 1-2 culm. Hufen = 16 ½ -33ha. Sie mußten aber im Notfall Scharwerks u. Kriegsdienst für den Orden übernehmen. Diese Verpflichtung war bei Beginn der polnischen Herrschaft auf die Krone Polen übergegangen. Aber die mennonitischen Holländer hatte bei ihrer Kolonisationsarbeit im 16. Jahrhundert auch diese Verpflichtung abgelehnt, u. es wurde ihnen ausdrücklich durch königl. Privileg garantiert, daß sie den Gottesdienst nach ihrem Glauben ausüben durften u. frei von allen Kriegsdiensten u. Scharwerk auch von Dammarbeiten wären.
Seit 1870 begann dann fast allgemein eine Zerschlagung des Grundbesitzes. Es wurden aber nicht, oder nur in wenigen Fällen, neue Bauernhöfe gebildet, sondern die zerschlagenen Grundstücke von benachbarten Bauern aufgekauft, die damit ihren Grundbesitz vergrößerten, u. so konnte man 70 Jahre später fast in jedem Dorf der Weichselniederungen mehrere wüste Höfe sehen, wo allenfalls noch ein altes Wohngebäude einen früheren Hof verriet, die Hintergebäude waren aber längst abgebrochen. Und auf der Höhe war dieses Bauernlegen schon früher u. noch gründlicher durchgeführt, sehr zum Nachteil der allgemeinen Volkswohlfahrt.
Die 48ger Revolution hatte auch in Preußen einen Landtag u. ein sehr beschränktes Wahlrecht gezeitigt, aber ein Versammlungsrecht bestand auf dem Lande wohl kaum. Jedenfalls war namentlich die Jugend ungenügend beschäftigt u. die überschüssige Kraft brach sich in mehr oder weniger harmlosen Streichen Bahn. Meine älteren Verwandten u. Bekannten sprachen sich manchmal mit Behagen über diesen u. jenen Streich aus, den sie in Jugendtagen einander oder dem lieben Nachbarn gespielt hätten. In Tiegenhof hatte ein biederer Bäckermeister am Markt, sich einige schöne Enten gemästet u. als ihr Schlachttag bestimmt war, waren die Enten spurlos verschwunden. Einige Tage später wurde der Meister von lieben Freunden zu einem Abendessen eingeladen. Es gab Entenbraten. Das kam dem Meister schon etwas verdächtig vor, wurde aber noch stillschweigend hingenommen. Am nächsten Tag sah der Bäckermeister, still vergnügt u. schon halb getröstet, aus der Tür seines Hauses auf die Straße u. wunderte sich nur, daß die Leute, die bei ihm vorbeikamen, immer so vergnügt nach seinem Hausgiebel über seiner Tür sahen. Der Meister denkt, du mußt doch mal sehen, was an deinem Haus denn so erfreuliches zu sehen ist u. ging auf die Straße. Da sah er denn bald die erfreuliche Bescheerung. Über seiner Haustür waren nämlich genau soviel Entengerippe angenagelt, wie ihm Enten gestohlen waren. Darauf der Meister resigniert: „Uck dat nock!!“ [Auch das noch!].
In der damaligen Zeit u. auch noch in meiner ersten Wirtschaftszeit waren die Schweineschlachtfeste in der Martinizeit sehr üblich. Da kamen die jüngeren Verwandten schon recht früh zu Hilfe, denn es handelte sich immer um mehrere Schweine. Und damit denn auch recht früh angefangen werden konnte, mußte das Brühwasser kochen, wenn die Hilfskräfte eintrafen. Da kam es nicht zu selten vor, daß gerade an diesem Tage der Schornstein gar nicht ziehen wollte u. folgedessen die Brühe nicht rechtzeitig fertig war. Nachdem man sich längere Zeit mit dem rauchigen Schornstein abgequält hatte, sah man sich den Schornstein einmal näher an u. mußte zu seinem Ärger feststellen, daß liebe Nachbarn den Schornstein fein säuberlich mit einem passenden Brett zugedeckt hatten.
Die jungen Arbeiter neckten auch wohl ihren Bauern damit, daß sie ihm seinen auf dem Hof stehenden Arbeitswagen auseinander nahmen, den Vorderwagen, nachdem die Räder abgezogen waren, mit der Deichsel voran in den Hofbrunnen gesteckt u. die übrigen Teile des Wagens auf der Strohdachfirst des Stallgebäudes wieder aufgebaut hatten.
Die Stadt Tiegenhof, die bis 1878 Marktflecken war, hatte bis zum Bahnbau Simonsdorf, Neuteich-Tiegenhof, gegenüber der Stadt Neuteich eine bevorzugte Lage. Sie lag an dem schiffbaren Tiegefluß u. hatte durch den, schon früher erwähnten Weichsel Haffkanal, Schiffsverbindung nach Danzig, Elbing u. Königsberg u. seit den siebziger Jahren auch nach Neuteich. Letzteres aber war bis dahin ausschließlich auf den Fuhrwerksverkehr angewiesen, der zudem vor den Chausseebauten bei schlechten Landwegen oft unmöglich war. Aus diesen u. auch noch andern Gründen hatte sich in Tiegenhof schon allerlei Verkehr entwickelt, als es in Neuteich noch sehr still war. Da war in Tiegenhof eine gute Mittelschule, 2 Likörfabriken, eine Brauerei für einfach Bier u. Essigfabrikation, wozu neuerdings noch eine große Molkerei und für eine Reihe von Jahren auch eine Zuckerfabrik kam. Am häufigsten aber wurde Tiegenhof mit seiner Stobbeschen Machandelfabrik in Verbindung genannt. Die Bahn Simonsdorf-Tiegenhof führte im Volksmund auch den Namen: Machandelbahn. Auch als Ruhesitz suchten die Rentner aus der Umgegend von Tiegenhof das Städtchen gerne auf. Das Amtsgericht in Tiegenhof bestand auch schon an dem Anfang des 19. Jahrhunderts, u. als dann 1920 das große Werder von seinem Mutterland abgetrennt u. selbständiger Kreis im Bezirk der freien Stadt Danzig wurde, kam auch das Landratsamt nach Tiegenhof, u. die Mittelschule wurde zu einer Oberrealschule mit Abiturabschluß ausgebaut. Über den Sitzungssaal des neuen Landratsamtes aber schrieb man den plattdeutschen Spruch:
„Lewer önn de Neddering versupe, als op
de Hög verdröge.“ [Lieber in der Niederung versaufen, als auf der Höhe vertrocknen]. [bei Max Halbe heißt es: Lieber hier unten versaufen als bei euch da oben verhungern].
Neuteich hat sich dann nach dem Bau der Zuckerfabrik u. dem Ausbau der Schwente (Tiege), besonders aber durch die Bahn u. Chausseebauten sehr erholt u. hatte als Centrum des oberen Kreisteiles u. seines hauptsächlichen Ackerbaugebietes einige gutgehende Getreidegeschäfte. Aber die größere Betriebsamkeit blieb in Tiegenhof. Beide Städtchen hatten 3-4000 Einwohner. Nach dem glänzend beendeten Kriege mit Frankreich war Bismar[c]k auf der Höhe seines Ruhmes u. fast alle Parteien des neuen deutschen Reichstages, auch die ihn zuvor bekämpft hatten, waren vorübergehend seine Gefolgschaft, mit Ausnahme der damals noch sehr kleinen Sozialdemokratie – von Kommunisten war noch keine Rede. Aber bald kam Bismarck mit den Katholiken, die in der Centrumspartei zusammengefaßt waren, in Konflickt. Es waren natürlich von beiden Seiten Machtansprüche, die zu einem viele Jahre langen Streit mit dem Centrum, geführt von dem kleinen Windhorst, führten, der unter dem Namen „Kulturkampf“ in die Geschichte eingegangen ist. Etwa 1877 gab Bismarck weitgehend nach, u. der Streit wurde beendet. Bismarck stand wohl als märkischer Junker u. Großgrundbesitzer den Konservativen am nächsten, scheute sich aber durchaus nicht, auch gegen die Konservativen seine Pläne durchzusetzen, wenn ihm von Centrum u. Nationalliberalen eine Mehrheit geboten wurde. So besonders in den 60iger Jahren, als er bei seinen Reichsgründungsplänen oft auf den Widerstand der Konservativen u. auch der Krone Preußens stieß. Kaiser Friedrich III, vormals Kronprinz Friedrich Wilhelm, mußte ab u. zu zwischen seinem Vater u. Bismarck intervenieren. Die Landwirtschaft, auch meines Heimatkreises, stand größtenteils bei den Konservativen, aber mein Vater, u. erst recht mein Großvater, standen aus der Zeit der 60iger Jahre immer noch den Nationalliberalen näher. Meinen Großvater konnte man wohl mit einigem Recht einen waschechten Demokraten nennen, u. es hat bis in die 80iger Jahre gedauert, bevor der konservative Wahlzettel bei uns Eingang fand. Die wirtschaftliche Not dieser Zeit zwang ihn ohne rechte Sympathie zu den Konservativen, welche die Belange der Landwirtschaft doch am meisten vertraten.
Im Jahre 1890 wurde der 75jährige Kanzler Fürst Bismar[c]k dann in einer wenig feinen Art u. Weise von Wilhelm d. II entlassen. Er wollte selbst regieren u. sein eigener Kanzler sein. Bismarck aber zog sich grollend auf sein Gut Friedrichsruh bei Hamburg zurück, wo er 1898 dann auch gestorben ist, äußerlich ausgesöhnt mit Wilhelm II, der nun auf eigene Faust los regierte u. viele Reden ins unreine hielt, die besser unterblieben wären. Natürlich hatte er dabei immer seinen verfassungsmäßigen Reichskanzler, aber er konnte nur den brauchen, der seinen Willen tat. Und solche gefälligen Männer hat er immer gefunden. Aber unter den Völkern Europas besaß er schließlich nur noch Österreich, mit seinem 86jährigen Kaiser u. dessen schon in Auflösung befindlicher vielsprachiger Monarchie als Freund. S.M. Wilhelm II litt, wie Hitler, am Größenwahn u. hielt sich u. sein Heer für unbesiegbar. Und das beste Heer der Welt haben beide wohl auch gehabt, aber gegen solcheÜbermacht zusiegen, wie unsere Truppen im ersten auch zweiten Weltkrieg kämpfen mußten, sind auch die besten Soldaten nicht im Stande. Wilhelm dem II. kann man es noch zu gute halten, daß er, abgesehen von seiner Großmäuligkeit, wohl garnicht den Krieg, sondern nur bluffen wollte. Hitler aber ging mit voller Absicht daran, ganz Europa seiner Dictatur zu unterwerfen. Wohin Dictaturenführen, das haben wir ja nun hinlänglich erlebt u. wollen hoffen, daß auch der größte Dictator der bisherigen Welt in Moskau recht bald stranden wird.
Aber nun will ich mich nach dieser Abschweifung wieder mit meinem Heimatkreis befassen. 9. November 1918 brach an vielen Stellen Deutschlands die Revolution aus, so auch bei uns in unserer Kreisstadt Marienburg, wo es zu Plünderungen der Lebensmittel u. Konfectionsgeschäfte kam, wobei die Soldaten schon vielfach kräftig mitmachten. Wilhelm d.II. hatte sich schleunigst nach Holland abgesetzt, wie es neuerdings so nett heißt, wenn man geflohen ist u. hat dieses Land bis zu seinem Tode etwa 1942 nicht mehr verlassen. Er wurde auf Schloß Doorn, der Kronprinz in Wieringen interniert. Letzterer bekam von der neuen republikanischen Regierung aber bald die Genehmigung nach Deutschland zurückzukehren u. hat bis 1945 unangefochten auf seiner Herrschaft Öls in Schlesien gelebt.
Die Plünderungen in Marienburg setzten sich in Form von nächtlichen Diebstählen dann auch auf vielen Stellen im Kreise fort; auch mir haben Langfinger einmal den Fleischkeller ausgeräumt u. einmal ein paar Schafe aus dem Stall geholt u. abgeschlachtet, aber zu Tötung von Menschen ist es, soviel ich weiß, nicht gekommen. Die Gemeindevorsteher blieben einstweilen auf ihrem Posten, mußten es sich aber gefallen lassen, daß Sozialdemokraten sich während der Amtsstunden in ihren Büroräumen aufhielten u. aufpaßten, daß auch alles ordnungsgemäß vor sich ging. Na, das war im ganzen eine harmlose Angelegenheit, u. als nach kurzer Zeit Sozialdemokraten zum Gemeindevorsteher gewählt wurden, schoben sich diese die unerwünschten Gäste bald ab. 1919 konnten wir schon wieder in Ruhe unsere Felder bestellen. Die polnischen Saisonarbeiter, die doch zum großen Teil auch den Krieg auf unserer Seite mitgemacht hatten, waren in diesem Jahr noch etwas schwierig u. kam es zuweilen zu Schlägereien zwischen ihnen u. der Aufsicht. 1920 kam dann die große Umstellung für uns. Wir wurden von unserm alten Heimatkreis Marienburg abgetrennt u. dem neuen Freistaat Danzig zugeteilt. Das war uns schmerzlich u. der Stadt Marienburg wohl noch mehr, die einen großen Kundenkreis verschwinden sah, aber es war immer noch besser, wie zu Polen kommen, gleich fast dem ganzen übrigen Teil Westpreußens westlich der Weichsel. Der nun neu gebildete Kreis Gr. Werder erhielt in Tiegenhof seine Kreisstadt u. in Dr. Cramer seinen ersten Landrat, der später Präsident der ev. Kirchensynode in Königsberg wurde. Sein Nachfolger war Landrat Poll, der bis zur nationalsozialistischen Zeit 1933 amtierte. Polen hatte aber in dem neuen Staat von vorneherein einige Rechte bekommen, die den Danzigern garnicht paßten u. den Grund zu den Verstimmungen legten, unter denen das gegenseitige Verhältnis oft gelitten hat. Man muß sich immer vergegenwärtigen, daß Polen bei der neuen Grenzfestlegung die Stadt Danzig mit ihrem etwa 1700 qklm. großen Gebiet uneingeschränkt beansprucht hatte u. diese Rechte auch jetzt alle zu erlangen, sich dauernd bemühte. Zunächst war Polen nur die Vertretung Danzigs im Ausland u. die uneingeschränkte Benutzung des Danziger Hafens vom Völkerbund zugesprochen worden. Aber es wußte seine Rechte sehr bald zu erweitern. Da war die Eisenbahn und die anteilige Unterhaltung der beiden Weichselbrücken Dirschau-Liessau, die den neuen kleinen Staat derart belasteten, daß er freiwillig die Eisenbahnen u. ihre Unterhaltung u. den Betrieb an Polen abtrat. Das war die erste Gelegenheit in die inneren Verhältnisse Danzigs einzudringen. Polen hatte sich dabei zwar verpflichtet, nur Eisenbahnbeamte einzustellen, welche die Danziger Staatsangehörigkeit besaßen u. im Danziger Gebiet nur die Danziger Währung als gültiges Zahlungsmittel zu benutzen. Aber nun suchte es mit allen möglichen Künsten polnisch gesinnte Danziger Staatsangehörige in die Beamten u. Arbeiterstellen der Bahn u. der Bahnhöfe auf Danziger Gebiet herein zu bringen. Dabei hatten kinderreiche Beamte den Vorzug. Polen hatte nämlich das weitere Recht bekommen, polnische Schulen einzurichten, wenn in einem Dorf mehr als 15 polnische schulpflichtige Kinder vorhanden wären. Das gleiche Recht besaßen die Deutschen allerdings auch in Dirschau u. Graudenz. Auf diese Weise waren wir auch in meinem Heimatkreis Gr. Werder zu einer polnischen Schule in Simonsdorf gekommen. Aber die kinderreichen polnischen Beamten Danziger Staatsangehörigkeit folgten durchaus nicht immer den polnischen Lockungen, für ihre Kinder eine polnische Schule oder wenigstens Klasse zu beantragen u. so waren wir in Liessau, das der Gefahr der Polonisierung doch mit am meisten ausgesetzt war, bis 1945 ohne poln. Schule. Ein weiterer Zankapfel war das Postregal. Danzig hatte seine eigene Post, aber sehr bald brachten die Polen eigene Briefkästen in den Danziger Strassen an u. erhielten vom Völkerbund auch die Berechtigung in Danzig ein polnisches Postamt einrichten zu dürfen. Auch polnische Polizei durfte zunächst nicht im Danziger Gebiet stationiert werden. Aber nach jahrelangem Wühlen beim Völkerbund, mußte ihnen von Danzig gestattet werden, in dem Fort Weichselmünde, wo ihnen eine Warenniederlage eingeräumt war, eine kleine Wachtruppe zu halten, mit dem Erfolg, daß die Polen das Fort außerordentlich stark befestigten u. eine starke Garnison hineinlegten.
Das Schlimmste aber, was sie der Handelsstadt Danzig antun konnten, war der Bau des Konkurrenzhafens Gdingen, das während des Krieges Gotenhafen hieß, und der Bau der Kohlenbahn von Oberschlesien nach Gotenhafen, welche das Danziger Gebiet umging u. den ganzen polnischen Handel von Danzig abzog. Damit war eigentlich schon 1939 bei Kriegsausbruch das Schicksal Danzigs besiegelt u. alle Hilfe, die von Deutschland in der ganzen Freistadt Zeit geleistet wurde, konnte das Schicksal Danzigs nicht ändern. Wegen Danzig ist angeblich der zweite Weltkrieg entbrannt, aber Danzig wäre auch nicht zu helfen gewesen, wenn es wirklich, aber ohne das polnische Hinterland zu Deutschland zurückgekommen wäre. Danzig ist einmal durch rein polnisches Hinterland groß geworden u. kann ohne einen freien uneingeschränkten Handel mit diesem nicht bestehen. Die Weichsel war der Schicksalsstrom Danzigs bis zum Bau der Eisenbahnen. Bis dahin gab es für Polen keinen andern Zugang zum Ausland, als die Weichsel entlang über Danzig. Und wenn der Strom seit der Gründung Danzigs wohl schon immer unter Versandung gelitten hat u. nur zeitweise für größere Schiffe benutzbar war, so genügte der primitiven Zeit vor den Bahnbauten, auch die primitive Beförderung der gewaltigen, nach Ausfuhr drängenden polnischen Kornmassen auf Flößen, die aus, zum Teil riesigen Baumstämmen gebildet waren. Auf diesen Flößen war von dünnen Brettern eine dichte Lage aufgenagelt u. mit Korn aller Art beladen u. dann ging das Floß auf Fahrt, stromabwärts nach Danzig. Bei dem geringen Tiefgang von 30-50 cm konnten diese Flöße fast bei jedem Wasserstand stromab nach Danzig treiben, wo das Korn in die riesigen Speicher der Danziger Handelsherren gebracht u. die Flöße an den Holzhändler verkauft wurden. Von dem Getreide wurde auch oft etwas naß. Das wurde dann gleich am Strom aussortiert u. auf Pläne [Planen] geschüttet u. geschaufelt, bis es trocken war. Gegen Tau u. Regen schützten imprägnierte Pläne, mit denen das Getreide nach Bedarf zugedeckt werden konnte. Die Flissaken (Führer der Flöße) gingen dann nach Ablieferung ihrer Waren zu Fuße wieder Stromauf in ihre Heimat. Die Flöße brachten auch andere Waren mit nach Danzig, u. mit diesem Handel sind die Danziger Handelsherren einmal reich geworden. Aus meiner Jugendzeit kann ich mich der vielen Flöße noch erinnern, aber der Verkehr auf der Weichsel nahm damals schon sehr ab. Die Bahnen waren eine zu starke Konkurrenz für den versandeten Strom. Zwar wurden mit der Mlawka’er Bahn über Marienburg-Dt. Eylau nach Mlawa an der polnischen Grenze u. durch die sogenannte Weichselstädtebahn über Marienburg-Marienwerder-Graudenz u. auch die Bahn Dirschau-Bromberg Zufahrtsstrassen nach Danzig gebaut, aber der westliche Teil Polens schielte doch schon seit Beginn der Bahnbauten nach dem Hamburger u. Stettiner Hafen, die ihnen näher u. wirtschaftlich günstiger lagen, wie Danzig. Und so war Danzig seit der Mitte des 19. Jahrhunderts schon immer ein Sorgenkind Preußens zur Stützung des Deutschtums im Osten. Es wurden allerlei Industrien nach Danzig gelegt u. ihnen auf jede mögliche Weise der Bezug der weit abgelegenen Rohstoffe, namentlich Kohle u. Eisen verbilligt. Die Schichauwerft wurde Ende des vorigen Jahrhunderts in Danzig erbaut u. ungefähr zu derselben Zeit die techn. Hochschule. Das Spielcasino in Zoppot wurde als wesentlicher Geldzubringer neben dem neu erbauten Kurhaus in Zoppot bei Beginn der Freistadtzeit errichtet u. lockte viele Ausländer nach Zoppot. Auch manch bekannter Landsmann hat sein bisschen Vermögen dorthin getragen. Natürlich hatten wir auch einen Volkstag u. einen Senatspräsidenten, der erste seiner Art war der baumlange Sahm, der später noch kurze Zeit Oberbürgermeister von Berlin war. Unser kleines Staatswesen wurde denn auch bald Sahmland genannt. Minister gab es bei uns noch nicht, wie sie jetzt schockweise in unserm armen Vaterland herumlaufen, aber wir hatten Senatoren, die vielleicht auch nicht viel billiger waren, wie Minister. Die Landwirtschaft hatte nach Beendigung der Inflationszeit bis 1930 gute Jahre, soweit sie auf ihrem Besitz geblieben war u. denselben in Ordnung gehalten hatte. Fast instinktiv klammerten sich die meisten Landwirte an ihre Produkte u. verkauften nur, wenn sie das Geld unbedingt z.B. zu Löhnen u. Anschaffungen in der Wirtschaft brauchten. Aber ein kleiner Teil verkaufte nach alter Vorkriegssitte sofort nach der Ernte sein Getreide u. brachte den Erlös zur Bank. Diese gerieten nach der rasend fortschreitenden Geldentwertung in große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Aber ganz schlecht ging es denen, die in den Jahren 1920-23 ihre Höfe verkauften u. sich mit dem „vielen“ Geld zur Ruhe setzen wollten, die waren bis Ende 1923 restlos pleite. Besonders gut schnitten aber die jungen Landwirte ab, die während der Inflationszeit ihre Wirtschaften gekauft hatten u. nach wenigen Jahren schuldenfrei waren. Auch von ihnen gerieten manche noch nach Beendigung der Inflation, die sie schuldenfrei gemacht hatte, in Schwierigkeiten. Der unverhoffte schnelle Gewinn hatte manch einen übermütig gemacht u. zum leichtsinnigen Geldausgeben verführt, was er sich nach Beendigung der Inflation nicht gleich abgewöhnen konnte. Die neue Währung (bei uns der Danziger Gulden, im deutschen Reich die R.mark) war anfänglich knapp u. ließ unsere landwirtschaftlichen Produkte rasend sinken. Auch diesesmal war es besser, seine Produkte zu halten u. die weitere Entwickelung abzuwarten. Es dauerte auch nicht lange, dann renkten sich die neuen Währungen ein, aber inzwischen waren doch wieder einige in Zahlungsschwierigkeiten geraten u. diesesmal erlöste keinen Leichtsinnigen eine Inflation von seinen leichtfertig angesammelten Schulden.
Da wir nun einen Volkstag hatten, brauchten wir auch Parteien, die sich anfänglich nach deutschem Muster in Deutschnationale (früher Konservative), Sozialdemokraten u. einige kleinere Splitterparteien gliederten, unter denen die Deutschnationalen die absolute Mehrheit hatten. Bis zum Jahre 1930 ging das mit diesem Volkstag auch ganz gut. Er fand gegen polnische Übergriffe, denen unsere „Hohen Kommissare“, die uns vom Völkerbund als Schlichter im Streit mit Polen eingesetzt waren und oft auf poln. Seite standen, bei der deutschen Regierung immer Unterstützung. Das machte sich bei der Versorgung mit Lebensmitteln, besonders mit Schweinen, die zu 60% aus Polen bezogen werden mußten, sehr fühlbar. Polen versuchte ab und zu durch diese Abhängigkeit von Polen, einen Druck auf die Danziger Regierung auszuüben u. drohte die Schweineeinfuhr zu sperren oder wenigstens zu droßeln. Aber da griff Deutschland sofort ein u. drohte, die Grenzen nach Ostpreußen für Danzig zu öffnen, wenn die Polen ihre Drohung wahr machen sollten u. die Schweineeinfuhr aus Polen ging weiter. Und nun versuchten es die Polen andersherum u. warfen soviel billige Schweine u. Rinder u. Getreide auf den Danziger Markt, um die Danziger Landwirtschaft zu ruinieren. Man wußte sich in Danzig kaum dagegen zu wehren, weil den Polen vertragsmäßig der Handel mit Danzig freistand. Aber da kamen die Danziger auf einen rettenden Gedanken, ohne den Vertrag mit Polen zu verletzen. Sie kontingentierten den einzelnen Schlachtern die Zahl der Tiere, die sie aus Polen einführen durften, wenn die Danziger Produktion an Schlachtvieh nicht genügte, und mit diesem Verfahren wurde bis Kriegsausbruch gewirtschaftet.
Bei Gründung des Staates „Freie Stadt Danzig“ war vom Völkerbund in Genf ein „Hoher Kommissar“ eingesetzt, den ich schon erwähnte u. der die Aufgabe hatte, Streitigkeiten zwischen Danzig u. Polen zu schlichten. Es war eine ganze Anzahl dieser hohen Herren, die uns in Danzig beglückten u. die sich nicht alle der Zuneigung der Danziger erfreuten. Die Namen sind mir nicht alle in Erinnerung geblieben. Den Danzigern am sympathischsten war wohl der italienische Graf Gravina, über seine Mutter ein Enkel Richard Wagners, u. der unsympathischste auf jeden Fall der Holländer „van Hamel“, der von rechtswegen u. nach seinem Auftreten in Danzig „van Bock“ hätte heißen müssen. Jedenfalls sah er es augenscheinlich als seine Hauptaufgabe an, in die Familien angesehener Danziger einzubrechen u. Ehen zu zerstören. Aber er war ja hoher Kommissar u. konnte von dem Beleidigten nicht vor die Pistole gefordert werden. Aber wenigstens erlöste uns der Völkerbund bald von diesem Bock, der zu unrecht Hamel hieß.
Der Graf Gravina starb übrigens in Danzig u. wurde auf seinen Wunsch bis zur Überführung der Leiche in der Kirche St. Albrecht bei Danzig beigesetzt. Allmählig wurde die Lage der Danziger Regierung immer schwieriger. Die wirtschaftliche Lage war in Danzig, wie in fast allen europäischen Staaten, auch in Nordamerika, um das Jahr 1930 immer schlechter geworden u. bot den Wühlereien des Nationalsozialismus in Deutschland u. auch in Danzig immer mehr Angriffspunkte. Das Elend der viele Millionen Arbeitslosen kam dem Nationalsozialismus wie gerufen. Und wie er sich vor Erlangung der Macht in Deutschland gebärdete, konnte man ihm kaum etwas vorwerfen. Er ging streng gesetzlich u. nur durch Propaganda vor. Aber er schulte seine Anhänger militärisch, wenn auch ohne Schußwaffen u. hielt auf strenge Disziplin u. wußte sie so zu begeistern, daß die S.A. u. S.S. bald der Schrecken von radaulustigen Elementen in öffentlichen Veranstaltungen war. Und öffentliche Versammlungen wurden unendlich viele abgehalten. Die braunen u. schwarzen Mannschaften hatten ja viel Zeit, da sie sich größtenteils aus Arbeitslosen zusammensetzten. Bei jeder Versammlung waren die Gruppen dieser Formationen schon so im Versammlungsraum postiert, daß sie die Menge einkreisten u. sobald radaulustige Elemente tätlich wurden, prügelten sie die besser organisierten Nazileute regelmäßig zum Saal hinaus. Dabei hat auch manch begeisterter Nationalsozialist den Tod gefunden. Das Parteiwesen in Danzig war durch die Nationalsozialisten, die hier natürlich auch viel Anhänger hatten, immer verworrener geworden. Von den 4 oder 5 Parteien, die bei Gründung Danzigs den ersten Volkstag bildeten, waren 10 oder 12 geworden. Also vollständige Auflösung u. als dann im Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde u. sofort Neuwahlen anordnete, die ihm auch die erhoffte absolute Majorität im Reichstag brachte, da ließ er auch sofort die Maske fallen u. begann diktatorisch zu regieren, u. sein überwiegend aus Nationalsozialisten gebildeter Reichstag bewilligte ihm alle Machtmittel, die er sich wünschte. Und Danzig folgte sofort. Am 1. Juli waren auch bei uns Volkstagswahlen erfolgt u. hatten ebenfalls eine absolute nationalsozialistische Mehrheit gebracht. Und nun ging zuerst die Hetze gegen die Juden los, die dem deutschen Menschen als Hauptfeind gezeigt wurden. Ihre Synagogen wurden verbrannt, die Schaufenster ihrer Geschäfte eingeschlagen, ihr Vermögen beschlagnahmt. Sie wurden mit dem Judenstern dekoriert, den sie gut sichtbar tragen mußten u. weitgehend von der Benutzung der Verkehrsmittel ausgeschlossen. Wieviel von den späteren Anklagen gegen die N.S.D.A.P. wegen vorsätzlicher Tötung von Juden wahr ist u. etwa im Bezirk Danzig ausgeführt wurde, weiß ich nicht, in Polen sind jedenfalls später viele tausende ermordet u. verbrannt worden. In meinem Heimatkreis waren die Juden wenig zahlreich, auf dem platten Lande gar nicht vorhanden. In den beiden Städtchen Neuteich u. Tiegenhof gab es einige Kaufleute, aber ich glaube, daß im ganzen Kreise nicht 100 Juden ansässig waren, die mir z.T. persönlich bekannt waren. Sie sind größtenteils ausgewandert. Mir persönlich ist von ihnen keine Unbill zugefügt worden. Daß sie wucherische Zinsen nahmen, ist mir bekannt, woran sich aber auch gute Christen beteiligten. Daß einer von diesen Juden aus dem großen Werder getötet wurde, ist mir nicht bekannt, wohl aber, daß einige in das KZ Lager nach Stutthof kamen, dessen Insassen aber hauptsächlich Christen waren, die den Mund nicht halten konnten. Denn Maul halten u. „der treue deutsche Blick“, war auch bei uns bald die Losung des Tages. Ich muß aber zugeben, daß namentlich die Landwirtschaft von der N.S.D.A.P. sehr pfleglich behandelt wurde u. daher auch viele Anhänger unter ihnen hatte. Die schlechte Wirtschaftslage, die um 1930 begann, hatte auch in der Landwirtschaft die Verschuldung wieder stark anschwellen lassen, u. da kam es manchem Landwirt recht gelegen, als die N.S.D.A.P. einfach dekretierte: „Alle Schulden des Bauern sind ab sofort unkündbar u. dürfen nicht mehr als 4% Zinsen pro Jahr kosten.“ Dann fand eine großzügige Schuldenregelung in der Landwirtschaft statt. Der Zinsfuß für die hinteren Hypotheken wurde auf 2% Zinsen heruntergesetzt u. sogenannte Kleckerschulden glatt gestrichen. Dann wurde der Bauerngrundbesitz bis zur Größe von 125 ha. befestigt, d.h. er war unverkäuflich u. unbelastbar u. mußte auf eines der Kinder, in erster Linie der Söhne übergehen. Der größere Besitz war verkäuflich u. nicht gegen Pfändungen geschützt, wie der befestigte Bauernbesitz, aber eine Schuldenregulierung fand auch hier statt. Diese Regelung im landwirtschaftlichen Besitz, die doch dem Hoferben außerordentliche Vorteile auf Kosten der anderen Kinder zubog, war natürlich sehr umstritten, wurde aber im allgemeinen nicht ungünstig aufgenommen. Zur Auswirkung ist sie nie gekommen.
Das waren so einige Lichtseiten des autoritären Regimes, denen große Schattenseiten gegenüberstanden. Der furchtbare Terror, die Maßlosigkeit u. die Kompromißlosigkeit der N.S.D.A.P. haben das Regime zu Fall gebracht. Nachdem erst einmal eine nationalsozialistische Mehrheit bei der Reichstagswahl erreicht war und dieser Reichstag, der nie mehr aufgelöst, oder durch Neuwahlen ergänzt wurde, gehorsam alles bewilligte, was der Diktator wünschte, durfte nur noch von oben befohlen werden. Und dieses „oben“ setzte sich bis ins kleinste Dorf fort, u. jeder Hitlerjugendführer war schon so ein kleiner Hitler, der immer recht hatte, wenn er mit Andersdenkenden außerhalb der Partei Stehenden Differenzen hatte. In Danzig war der Gauleiter Forster der allmächtige Mann und in unserm Kreise der Landrat u. Kreisleiter Andres. Seine Berufung zu diesem Amt war schon die Veranlassung zu einem grandiosen Fackelzug, den der neue Kreisdiktator, auf der Treppe des Kreishauses stehend, huldvoll entgegennahm. Und dann ging das Bauen los, nicht nur in Nürnberg u. Berlin u. Danzig, sondern auch in Tiegenhof. Neue Versammlungsräume mußten geschaffen werden: ein Millionenobjekt für eine so kleine Stadt!
in Danzig hielt man nun fernerhin den Hohen Kommissar des Völkerbundes für überflüssig u. schickte ihn nach Hause, was sich der Völkerbund auch ruhig gefallen ließ. Deutschland hatte nun das Protektorat über Danzig aus eigener Machtvollkommenheit übernommen u. Forster regierte in Danzig. Jetzt wurde „antreten“ geübt. Von S.A. u. S.S. war man es schon gewöhnt, etwas ungewöhnlich war schon „antreten“ beim Bund deutscher Mädel, aber „antreten“ der Hochschulprofessoren war eine Sehenswürdigkeit. Eine besondere Rolle spielten im Danzig der Nat. S.P. noch Dr. Rauschni[n]g u. Greiser. In Danzig war der Volkstag noch nicht so ohne weiteres zu suspendieren, wie der Reichstag in Berlin. Die Danziger Staatseinrichtungen standen unter der Garantie des Völkerbundes, u. man wagte doch nicht, so ohne weiteres, den Volkstag abzuschaffen u. mußte er wenigstens der Form nach bestehen bleiben u. sein erster nationalsozialistischer Präsident war Dr. Rauschni[n]g aus Warnau b. Marienburg, der zunächst ein gegeisterter Nazi u. glänzender Redner war. Er wurde mit großer Mehrheit von den N.S.D.A.P. zum Senatspräsidenten gewählt u. glaubte nun auch, als solcher die „Freie Stadt“ regieren zu können. Aber dabei hatte er sich außerordentlich getäuscht. Das Regieren machte Forster, u. da kam es denn bald zu derartigen Zerwürfnissen zwischen den beiden, daß Rauschni[n]g nach einigen Jahren nach Polen zu seinem in Graudenz wohnenden Schwiegervater floh u. von dort nach Amerika, als der Krieg gegen Polen ausbrach. Rauschni[n]gs Nachfolger war der alte Danziger Nationalsozialist Greiser. Aber auch dieser konnte gegen Forster nicht aufkommen u. lagen sich die beiden P.G.’s dauernd in den Haaren u. beschwerten sich abwechselnd bei ihrem Meister „Hitler“ in Berlin. Letzterer trennte die beiden feindlichen Brüder bei Kriegsausbruch u. versetzte Greiser als Gauleiter nach Posen für den neugebildeten Wartegau. Forster hatte also wieder gesiegt. Greiser war im Wartegau geboren u. übernahm die Verwaltung seiner Heimat wohl nicht ungern u. residierte nun im Schloß in Posen u. verbreitete gelegentlich das Gerücht, daß seine neuen Landsleute ihn sehr schätzten. Die Liebe seiner Landeskinder muß aber wohl nicht so groß gewesen sein, wie Greiser annahm oder wenigstens verbreitete, denn wie der Krieg verloren war, wurde Greiser an die Polen ausgeliefert, die ihn zum Tode verurteilten u. nach ekelhaften Verunglimpfungen (Er wurde tagelang in einem Käfig durch die Stadt gefahren u. von dem Pöbel verhöhnt, angespien u. mit faulen Eiern beworfen) gehengt. Forster ist diesem Schicksal bisher entgangen, weil er nachweisen konnte, daß er seinen verehrten Meister u. Beschützer Hitler schon lange vor Kriegsende verraten habe. Ein wirklich sympathischer Mensch! Was aus seinem letzten Stellvertreter Andres, unserm ersten nationalsozialistischen Landrat in Tiegenhof, geworden ist, weiß ich nicht. Mit Forster war er aber schon lange vor Kriegsende in heftigem Streit u. von seinem Stellvertreterposten entfernt. Dieses Bild von der Einigkeit der führenden P.G.’s untereinander deckt sich einigermaßen mit dem, was wir durch die vielen Kriegsverbrecher Prozesse der letzten 6 Jahre von der Umgebung Hitlers erfahren haben, der ja selbst auch garnicht lange fackelte, sich seiner Freunde, wenn sie ihm nicht mehr paßten, durch den Henker zu entledigen.
Im Jahre 1924 hat sich, als erste Gemeinde im großen Werder, Liessau elektrisch eingerichtet. Der Strom wurde uns vom städtischen Elektrizitätswerk Dirschau, das ja nun polnisch war u. T[c]zew hieß, geliefert, aber wir mußten den ganzen Bau einschließlich des 1000m. langen, armdicken Kabels über die Fuhrwerksbrücke Liessau-Dirschau bezahlen. Die Sache war recht teuer. Es bestanden damals in einigen Dörfern kleine Stromerzeugungsanlagen, bei Molkereien oder auch privat, die Strom für Licht erzeugten, aber das war noch viel teurer, u. als im Laufe der Zeit die Dörfer u. Städte des Kreises Gr. Werder elektrifiziert wurden, gingen die kleinen Stromerzeugungsanlagen sofort ein. Das große Ostpreußen Elektrizitätswerk lieferte nun den Strom in Verbindung mit dem städtischen Elektrizitätswerk Dirschau (T[c]zew). Das war auch für uns in Liessau von großer Bedeutung, denn unsere Strombelieferung von Dirschau aus, wurde durch die Sprengung der beiden Weichselbrücken am 1.9.1939 (Kriegsausbruch) nicht beeinträchtigt. Die Landwirtschaft im Gr. Werder hatte, wie in allen deutschen Landesteilen, zwischen den beiden Weltkriegen gute Fortschritte gemacht. Da wir in Liessau schon seit Ende der 1870ger Jahre eine Dampfpflug Gesellschaft mit 2 kompletten Pflugsätzen u. einer Reparaturwerkstatt besaßen, waren wir in der Kultur, besonders der schweren Werderböden, den andern Werderdörfern ein Stück voraus. Die Pflüge wurden auch an Nichtmitglieder ausgeliehen, wenn sie von den Mitgliedern nicht beansprucht wurden. Es waren aber immer doch nur wenige, die sich ein so notwendiges tiefes pflügen leisten konnten. Zwar hatten sich in weiten Abständen noch 2 oder 3 Dampfpflug Gesellschaften im Werder gebildet, sie gingen aber alle nach wenigen Jahren ein. Oft wurde auch schon ein Motorpflug angeschafft u. einzelne junge Bauern, die wohl nicht die Mittel hatten, sich einen Hof zu kaufen, kauften sich einen Motorpflug u. versuchten sich mit Lohnpflügen ihren Unterhalt zu verdienen. Aber alle diese Unternehmen gediehen nicht recht. Wahrscheinlich fehlte es an der genügenden Motorenkenntnis, die eine zu schnelle Abnutzung der Motoren herbeiführte. Daran krankte auch die viel umfangreichere Motorisierung, die in den 30iger Jahren u. besonders nach Ausbruch des 2ten Weltkrieges vorgenommen wurde u. die auch unsere alte Dampfpflug Gesellschaft in Liessau zum Verkauf ihrer sämtlichen Apparate veranlaßte, weil sich jedes Mitglied schon einen oder mehrere Traktoren angeschafft hatte. Die Reparaturwerkstatt aber blieb bestehen u. hatte auch fernerhin viel Arbeit mit den vielen Traktoren u. allen landwirtschaftlichen Maschinen der Umgebung.
Unsere Währung war, wie ich schon erwähnte, seit Herbst 1923 der Danziger Gulden, der sich anfänglich auf das englische Pfund stützte u. zwar im Wert von 25 Gulden für 1 Pfund Sterling. Aber als die Engländer zum ersten mal eine Pfundabwertung vornahmen, ich glaube es war so um 1930, da löste Danzig seine Verbindung zum Pfund u. wurde auf Grund angesammelter Goldvorräte selbständig. Diese gute Grundlage für die Danziger Währung hatten die Nationalsozialisten aber bald verwirtschaftet u. 1935 senkten sie den Wert des Guldens, der bisher hoch über dem Zloty (der polnischen Währung) gestanden hatte, um 30Pf. pro Gulden, womit er dem polnischen Zloty gleich stand. Das wurde natürlich nicht mit der Verschwendungssucht der Nationalsozialisten, sondern mit der günstigeren Stellung zu Polen motiviert, wo man nun günstiger einkaufen konnte. Wo die Vergünstigung lag, habe ich nicht einmal begriffen, aber daß ein großer Teil der Danziger Sparer um einen großen Teil ihres Barvermögens betrogen wurden, war mir klar. Dazu kam noch, daß an Gehältern u. Löhnen nichts geändert werden durfte, was uns Landwirte[n] zunächst die Feindschaft unserer polnischen Arbeiter zuzog, die bisher doch immer ihren Guldenverdienst in der Heimat sehr vorteilhaft gegen Zloty einwechseln konnten. Den Danzigern wurde diese Vermögenskonfiscation am 1.9.1939 bei Beginn des 2ten Weltkrieges, als Danzig von einem Tag zum andern wieder deutsch geworden war, etwas vergütet, indem der Danziger Gulden mit 70 Reichsmarkpfennige u. der polnische Zloty mit 50 Pfennige von der deutschen Währung übernommen wurde. Aber die Geschädigten von 1935 waren wohl selten dabei.
An dieser Stelle sei mir ein kurzer Rückblick auf den Beginn des zweiten Weltkrieges gestattet. Die Spannungen zwischen Danzig u. Polen hatten schon fast den ganzen Sommer 1939 hindurch angehalten; wahrscheinlich geschürt von Deutschland. Schon am 1. Juli wurden die Reservisten, die während der nationalsozialistischen Zeit freiwillig in Deutschland gedient hatten, eingezogen u. aus ihnen Danziger Regimenter gebildet. Unter diesen jungen Leuten war auch mein landw. Beamter Woelke.
In den letzten Wochen vor dem September 39 waren die Reibereien an den Grenzen immer heftiger geworden. Da[ß] Liessau, seiner beiden Weichselbrücken wegen, irgendwie den ersten Stoß würde aushalten müssen, war uns klar u. noch klarer, als von Liessauer Seite unter militärischer Leitung allerlei Verkehrshindernisse im Dorf vor meiner Tür eingerichtet u. Maschinengewehrnester zur Verteidigung dieser Hindernisse eingegraben wurden. Die Saisonarbeiter hatten uns in den letzten Tagen vor dem 1.9. heimlich verlassen u. waren (doch wohl auf polnischen Befehl) in ihre Heimat zurückgekehrt. Am 1. Sept. 39 ging ich, wie gewöhnlich um ½ 5Uhr in den Stall, um nach dem füttern zu sehen u. kam dann gegen 5 Uhr wieder zurück in mein Schlafzimmer, als ich bei der Toilette war, entstand plötzlich ein furchtbares brausen in der Luft, über meinem Wohnhaus, das ich mir zunächst nicht erklären konnte, zumal die dicht belaubten Bäume vor meinen Fenstern, mir keinen Blick nach dem Himmel gestatteten. Ich eilte hinaus u. sah noch die letzten Flugzeuge, die den Lärm verursacht hatten, dicht über dem Weichseldamm hinweg nach Dirschau fliegen. Kurz darauf erfolgten auch von Dirschau her Detonationen von abgeworfenen Fliegerbomben, u. fast gleichzeitig setzte Kanonendonner ein u. wir retirierten in den Keller. Die Leute, die beim Pferde putzen waren liefen nach Hause u. kamen bald mit ihren Angehörigen u. einigem Hausrat zurück u. verlangten Fuhrwerk, um sich u. ihre Familien in Sicherheit bringen zu können. Da, wider Erwarten, keine Kanoneneinschläge bei uns bisher erfolgt waren, nahm ich an, daß der Kanonendonner von deutschen Geschützen herrühre u. wollte meine Leute damit beruhigen. Aber da war nichts zu machen. Jeder riß sich ein paar Pferde aus dem Stall, spannte sie vor einen der auf dem Hof stehenden Arbeitswagen u. fuhr davon, auch der Melkermeister, der erst die Hälfte der Kühe ausgemolken hatte. So war ich denn mit meiner Familie und den Hausmädchen allein auf dem Hof u. sah mich vorsichtig draußen um, und konnte dann bald feststellen, daß der Kanonendonner von deutscher Artillerie herrührte, die in Kl. Lichtenau stand u. über unsere Köpfe hinweg nach Dirschau schoß. Ausserdem standen 2 deutsche Eisenbahngeschütze auf dem Eisenbahndamm und schossen gegen das Portal der Eisenbahnbrücke, was von dort aus mit Maschinengewehren erwiedert wurde. Die deutschen Militärbefehlshaber hatten zuerst versucht, mit einem Eisenbahnzug das eiserne Tor einzurammen, mit dem die Polen schon seit einigen Tagen den Zugang zur Eisenbahnbrücke versperrt hatten. Das war ihnen aber nicht gelungen, u. nun sollte das Tor eingeschossen werden. Bevor es aber soweit kam, sprengten die Polen beide Brücken, etwa um 6 Uhr früh. Viele Werderaner, die 10-15 klm. ab wohnten, wollen die Sprengung der Brücken, als eine besonders starke Detonation wahrgenommen haben. Wir haben das wegen dem starken Artilleriedonner nicht gehört, aber ich konnte aus meinem Garten um 6 Uhr feststellen, daß aus jeder der Brücken ein paar Joche fehlten. Wir konnten uns nicht erklären, daß bei uns keine Artillerieeinschläge zu sehen waren. Daß die Polen in Dirschau oder dessen Nähe kein einziges Geschütz haben könnten, darauf kamen wir garnicht. Und deshalb waren wir auch den ganzen Tag über in Sorgen, daß die Artillerie aus Polen antworten würde u. daß wir dann die Leidtragenden sein würden. Die Fenster waren in unsern Häusern weit geöffnet, um nicht vom Luftdruck unseres Artilleriefeuers eingedrückt zu werden. Aber gegen Abend war es dann klar, daß wir von Dirschau nichts zu befürchten hätten. Danziger Truppen waren schon gegen geringen Widerstand in Dirschau eingerückt. Gegen Abend kam auch ein Sohn meines Melkermeisters, der im benachbarten Damerau in der Schmiedelehre stand, u. erbot sich, die Kühe zu melken, was mir u. besonders den Kühen sehr willkommen war. 6 brave deutsche Soldaten hatten den Kampf um die Weichselbrücken mit ihrem Leben bezahlt u. 12 waren verwundet. Die Gefallenen wurden am nächsten Tage zu Füßen unseres Kriegerdenkmals beigesetzt.
Das war der Kriegsbeginn 1939 von meinem Heimatkreis aus. Es war ein Überfall auf den Gegner, ohne Kriegserklärung, wie es bei Hitler Mode war.
Der Krieg mit seinen anfänglichen Thriumphen der deutschen Wehrmacht, mit seiner Begeisterung, mit der die deutsche Jugend zu den Fahnen drängten, die auch im Laufe der ersten drei Kriegsjahre immer erneuten Auftrieb durch die Niederwerfung fast ganz Europa’s erhielt, war an meinem Heimatkreis fast spurlos vorübergegangen. Die Stadt Danzig hatte allerdings 1942 einen Luftangriff auszuhalten, der sie etwa 80 Tote u. eine Anzahl beschädigter Gebäude kostete. Unter diesen Toten waren etwa 60 Kinder, weil eine Bombe in ein Kinderkrankenhaus gefallen war. Ihr Hauptziel, den Bahnhof u. die Werften, hatten die Angreifer aber nicht getroffen. Der Angriff erfolgte an einem Sommersonntag, bei schönstem Wetter, auf eine so ahnungslose Stadt, daß die feindlichen Bomber in aller Ruhe erst über der Stadt kreuzen u. sich ihre Ziele aussuchen konnten, da die nach oben grüßende Menschenmenge sie für deutsche Flieger hielt u. die Fliegerabwehrgeschütze ihre Mannschaft z. T. auf Sonntagsurlaub geschickt hatte. Das war aber bis 1. Januar 1945 auch der einzige größere Angriff auf die Stadt u. von den furchtbaren Bombennächten, welche die Städte Westdeutschlands so furchtbar mitgenommen hatten, hat auch Danzig bis 1. Januar 45 nichts gespürt. Es kamen allerdings öfter einzelne Flugzeuge über unsern Heimatkreis, die in der Richtung auf Danzig flogen; sie hatten aber im allgemeinen wohl die Aufgabe, die See vor der Hafeneinfahrt zu verminen. Aber an den Familien der Heimat war der Krieg nicht so spurlos vorübergegangen. Fast jede Familie hatte Tote, Schwerverwundete oder Vermißte zu beklagen. Und diese Verluste häuften sich, je länger der Krieg dauerte. Im Herbst 1944 hatten die Russen die deutsche Grenze in Ostpreußen überschritten u. die östlichsten Kreise Ostpreußens besetzt. Dort blieben sie einstweilen stehen u. wir ahnten Anfang Januar 45 noch nicht, daß auch wir kurz vor unserer Flucht standen. Mitte Januar gab dann endlich unsere Regierung zu, daß eine Räumung unseres Kreises nicht ausgeschlossen sei und wir uns darauf vorbereiten sollten. Die Fuhrwerksbrücke Liessau-Dirschau (ehemalige Eisenbahnbrücke) war, wie ich schon erwähnte, 1939 mit der Eisenbahnbrücke zusammen gesprengt, aber nicht wieder hergestellt, wie die Eisenbahnbrücke. Es war aber während des Krieges etwa 3 klm. aufwärts eine neue große Fuhrwerksbrücke mit Zufuhrstrassen nach beiden Seiten gebaut. Zu deren Unterstützung war 1 klm. unterhalb der Eisenbahnbrücke im Laufe des Winters 44/45 eine provisorische Fähre mit behelfsmässigen Zufuhrstrassen von Liessau aus eingerichtet. Diese waren auch kaum fertig, als in der Nacht vom 23. zum 24. Jan. 1945 der Befehl kam: sofort abrücken!
Da begann dann auch für uns das Flüchtlingselend, das heute noch längst nicht beendet ist. Von meinem Hof fuhren 5 zweispännige u. ein 4 spänniger Arbeitswagen u. ein zweispänniger Kutschwagen herunter, hauptsächlich beladen mit Menschen u. ihrer notwendigsten Habe. Von all den schönen Möbeln, die wir in unserem 50jährigen Ehestand angesammelt hatten, konnte kein Stück mitgenommen werden, da doch zuerst Beförderungsmöglichkeit für die zahlreichen Arbeiterfamilien des Dorfes geschaffen werden mußte u. auch Futter für die Pferde. Die Rinder, Fohlen, Schweine u. Geflügel blieben damals noch alle zurück u. waren mit allen Speicher u. Hausvorräten der Einquartierung u. einem, wenig zuverlässigen Melkermeister übergeben, der sich erst im letzten Augenblick mit der Einquartierung zurückziehen sollte. Das Übersetzen mit der Fähre ging sehr langsam vorwärts u. auch ohne Unfall. Damals wußten wir noch nichts von dem furchtbaren Martyrium unserer ostpreußischen Landsleute, die vielfach keinen freien Weg mehr hatten, als über das Eis des frischen Haffs. Was da an Menschen u. Tieren umgekommen ist, wird wohl nie bekannt werden.
Außer den beiden obengenannten Übergangsstellen waren noch 2 Fähren, in Schöneberg u. Nickelswalde zur Verfügung, aber bei dem Andrang, der durch ostpreußische Flüchtlinge noch verstärkt wurde, dauernd verstopft. Wir sind dann nach einigen Tagen, die uns schon durch die eigenen Landsleute jenseits der Weichsel über unser Flüchtlingsschicksal belehrten, auf der Danziger Höhe bei Praust in gute Quartiere gekommen u. wollten dort die weitere Entwickelung der Dinge abwarten.
Einstweilen war der Russe an der zugefrorenen Nogat stehengeblieben u. schickte nur Recognoszierungstruppen über das Eis in die, in der Nähe der Nogat gelegenen Werderdörfer, wobei auch einige zurückgebliebene Menschen getötet u. einige Gebäude niedergebrannt wurden.
Durch die scheinbare Ruhe u. auf Ermunterung durch die Behörden fingen wir Anfang Februar an, ein paarmal in der Woche mit Arbeitswagen zu unsern Höfen zu fahren, um Vorräte zu holen u. schließlich blieben einige Nachbarn u. auch meine Töchter Lena u. Christel vollständig dort u. räumten in der, hauptsächlich durch ostpr. Flüchtlinge u. die Einquartierung verschmutzten Wohnung, u. auf dem ebenso verschmutzten Hofe gründlich auf u. als ich am 6. März 1945, dem Tag nach meinem 76. Geburtstag noch einmal persönlich nach Liessau fuhr, da hatten die Mädels mit den Saisonarbeitern, die auch schon wieder vollständig in Liessau waren, alles sauber gemacht u. auch die eingemieteten 1200 Ztr. Mohrrüben auf der Kleinbahn verladen. Viele Werderaner waren auch vollständig in die Heimat zurückgekehrt, weil sie auf der Danziger Höhe so erbärmliche Quartiere hatten. Da kam am 7. März plötzlich der Befehl für alle zurückgekehrten Werderaner, sofort das noch vorhandene Vieh über die Weichselbrücken (die Eisenbahnbrücke war provisorisch mit Bohlen belegt u. für Fuhrwerke benutzbar gemacht worden) nach Dirschau zu treiben, die Brücke würde am Abend gesprengt werden. So waren denn am 8. März meine Töchter Lena u. Christel wieder in Danzig, wohin wir, meine Frau u. ich, unsern Wohnsitz schon Anfang März verlegt hatten, als es auf der Danziger Höhe schon der ausrückenden Russen wegen brenzlich wurde. Unsere Gespanne konnten wir nicht nach Danzig mitnehmen, wurden auch bald von der deutschen Wehrmacht eingezogen. Aber bald wurde auch nach Zoppot hereingeschossen u. wir gingen nach Langfuhr u. am 22. März nach Neufahrwasser, wo wir auf ein paar Nächte bei unserm Neffen Gustav Penner Unterkunft fanden. Am 24. März lösten wir uns endgültig von der Heimat u. stiegen in einen Frachtdampfer, der uns in 4tägiger Fahrt, bei spiegelglatter See, unbeschädigt nach Warnemünde brachte. Und so, wie wir, versuchten viele, viele Landsleute u. Nachbarn mit Schiff zu entkommen, der Landweg über die Oder war schon längst von den Russen abgeschnitten. Aber nicht Allen gelang die Flucht über See nach Westdeutschland oder Dänemark. So manches Schiff ist untergegangen, torpediert oder auf Minen gelaufen, und viel Tausende sind noch umgekommen, nachdem sie sich schon auf dem Schiff in Sicherheit glaubten. Von den Landsleuten aus dem großen Werder, die, wie ich schon erwähnte, von den schlechten Quartieren auf der Danziger Höhe in die Heimat zurückgegangen waren, gerieten auch lange nicht alle, auf ein Schiff zu kommen. Sie haben Furchtbares in der Heimat erdulden müssen. Mord u. Schändung waren an der Tagesordnung u. Mißhandlungen, die oft zum Selbstmord führten.
Allmählig fanden sich die einzelnen Familienmitglieder, aber große Lücken hatte der Tod zumeist in ihre Reihen gerissen. Eine Anzahl der nirgend gern gesehenen Flüchtlinge ist in Westdeutschland allmählig auch wieder in seinen alten Beruf zurückgekehrt; am wenigsten ist dieses den ehemaligen selbständigen Landwirten gelungen. Eine Anzahl derselben ist auch schon nach Nord oder Südamerika ausgewandert. Die anderen warten auf den Lastenausgleich, der auch nichts anderes zu werden verspricht, als ein Almosen.
Schluß
Und wenn wir nun die eigene Lage u. die Weltlage betrachten, dann muß man sagen: Schwarz u. unheildrohend steht die Zukunft vor uns! Zwar, der Faschismus in der deutschen u. italienischen Form ist niedergekämpft, aber nicht tot. Seine Begründer Hitler u. Mussolini sind tot. Der Erstere mit seiner Geliebten Eva Braun, nach verübtem Selbstmord, auf dem Hofe der Reichskanzlei verbrannt, der Letztere, angeblich auf der Flucht, erschossen. Die hauptsächlichsten Anhänger Hitlers sind als Kriegsverbrecher gehenkt oder haben Selbstmord verübt. Einige sitzen auch noch, zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt, in Gefängnissen. Die Sieger haben ihr Mütchen kühlen können u. haben nach menschlichem Empfinden zumeist richtig geurteilt, allerdings nach Gesetzen, die sie erst nach beendetem Kriege geschaffen haben. Bleibt nur nach demokratischen Grundsätzen übrig, daß auch die Kriegsverbrecher der andern Nationen zur Rechenschaft gezogen werden. Kein Mensch, u. wenn er noch so demokratisch denkt, wird behaupten wollen, daß das Engel gewesen wären, die im demokratischen u. kommunistischen Lager gekämpft haben. Wenn man so ein bisschen durch die Lande fährt u. in das zerstörte Ruhrgebiet kommt, so muß man dem Gegner zugestehen, daß es sich hier um die Waffenschmiede des deutschen Reiches handelt, die zu zerstören, des Gegners Recht ist. Wenn man aber nach Dresden kommt, wo 40000 Menschen in einer Nacht in der Innenstadt getötet wurden, oder das kleine Zerbst in seiner Innenstadt vollkommen zerstört wurde, da wird man wohl von dem Verdacht eines Kriegsverbrechens nicht so leicht loskommen, u. erst recht nicht, wenn man sich die russischen Taten ein bisschen näher ansieht. Vielleicht ist es garnicht so fern, daß dieses Kapitel zwischen Ost u. West einmal gründlich aufgerollt wird. Aus dem lieben Kamerad Rußki ist inzwischen ein bestgehaßter Gegner geworden. Dessen Kriegsverbrechen abzuurteilen müßte den westlichen Demokratien eine Wonne sein, wenn sie die Macht dazu hätten. Ich bin auch überzeugt, daß im andern Fall die Russen zu Gegendiensten gerne bereit wären.
Seit 2 Jahren, nachdem die Westmächte den lieben Kamerad Rußki erst richtig erkannt hatten, wird auf allen Seiten gerüstet, wie in den ganzen 6 Kriegsjahren nicht gerüstet wurde. So stark wird gerüstet, daß sich sogar Engländer u. Amerikaner eine Verschlechterung ihres Lebensstandarts gefallen lassen müssen, um Waffen, Waffen, Waffen zu schaffen, von denen man annehmen müßte, daß aus dem vorigen langen Kriege noch eine Masse vorhanden sein müßte. Aber die Waffen aus der Zeit vor 10 Jahren genügen längst nicht mehr. Die harmlosen Bomben, die 20, 30 oder auf Kraft 100 Menschen umbringen können, sind total veraltet. Atombomben müssen es sein die mehrere 100000 umbringen können u. Flugzeuge mit 900 klm. Geschwindigkeit, welche diese netten Scherze in 12 Stunden an jeden beliebigen Punkt unseres Planeten tragen können. Was sonst noch so an Überraschungen in Vorbereitung ist, wissen wir gewöhnlichen Sterblichen nicht, aber das wissen wir Deutschen, daß sich auf unserm Grund u. Boden die Entscheidung abspielen wird.
Ein gutes hat diese Entwickelung der Weltgeschichte für uns gehabt. Wir sind wieder ein einigermassen freies Volk geworden u. wir sind in der ganzen Nachkriegszeit von den Amerikanern in einem Umfang mit Lebensmitteln unterstützt worden, wie das von Seiten eines Siegers in der ganzen Weltgeschichte wohl noch nicht vorgekommen ist. Viele sagen: „das haben die Amerikaner in ihrem eigenen Interesse getan“! Mag sein, daß auch sie darunter gelitten hätten, wenn sie das deutsche Volk hätten verkommen lassen. Aber sie hätten doch nur mehr oder weniger gelitten u. die Deutschen wären zu Millionen verhungert.
Und nun bemühen sich die Amerikaner, das nichtkommunistische Europa zu einem Staatenbund zusammenzuschließen; auch wieder nicht ganz selbstlos. Es sollen die Vorposten der Amerikaner gegen ihren früheren lieben Kamerad Rußki sein, der sein kommunistisches Gesicht denn doch gar zu deutlich enthüllt hat. Und man muß zugeben, daß sich der Kommunismus in einer stärkeren Position befindet, wie die Demokratie. Zwar glaubt ein großer Teil der heutigen Kommunisten durchaus nicht an das Recht ihrer Sache, aber der Terror durch die herrschenden Kreise u. ihre aus dem Proletariat hervorgegangenen überzeugten Anhänger ist so groß, daß die Ablehnung des Kommunismus von obengenanntem Teil nicht laut wird. Auch die echten Proletarier, und das ist wohl der größere Teil der Erdenbewohner, finden manches an dem Kommunismus auszusetzen, denn sie werden doch nach der Klafter geschunden, aber sie stellen immer wieder triumphierend fest: „Den früheren Reichen geht es wenigstens auch nicht besser.“ Und wie sehr solche Erkenntnis den Menschen befriedigt, konnte man zu allen Zeiten, besonders aber nach dem Kriege bei uns Flüchtlingen selbst feststellen.
Von den, vor dem II. Weltkrieg selbständigen Staaten Europas sind Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien u. Albanien vollständig u. Deutschland u. Österreich zur Hälfte unter kommunistische Diktatur gekommen, auch Tschecho-Slowakei ist ganz kommunistisch geworden. Alle diese Staaten (von Deutschland ist es das Land Thüringen, früheres Königreich Sachsen, Provinz Sachsen Anhalt, Provinz Brandenburg u. Mecklenburg), dazu alle deutschen Länder östlich der Oder-Neiße Linie, die den Polen zugefallen, aber wie alle andern vorher genannten Länder der kommunistischen Oberherrschaft unterstehen, haben wahrscheinlich [unleserlicher Nachtrag].An unsern Landsleuten in der Ostzone aber merkt man es so recht, welchen verheerenden Einfluß die kommunistische Herrschaft, besonders an der deutschen Jugend ausgeübt hat, der nur noch Rußland als der große Gönner hingestellt wird.
Eine weitere Verstärkung der kommunistischen Weltposition ist es, daß jedes Land dieser Erde eine kleinere oder größere kommunistische Partei hat u. da werden die demokratischen Staaten aus dem Selbsterhaltungstrieb heraus wohl nicht darum herum kommen, mit schärferen Mitteln, wie bisher, gegen den Kommunismus vorzugehen. In dem „freien“ Rußland läßt man solche Störenfriede in die Uran u. Kohlebergwerke verschwinden. Es riecht zwar nach Diktatur aber es hilft. – Dem von Amerika gewünschten europäischen Staatenbund steht u.a. noch immer die alte Feindschaft Frankreichs u. zum Teil auch Englands gegenüber. Wenn es bei England wohl in der Hauptsache der alte Handelsneid ist, der die Beziehungen der beiden Staaten zueinander immer wieder gefährdet, so sind es bei Frankreich territoriale Ansprüche (Saargebiet) u. die Furcht, dem wieder erstarkenden Deutschland auch wirtschaftlich u. zuletzt auch militairisch zu unterliegen. Da steht nun die Forderung Amerikas an seinen Schützling Deutschland, schleunigst u. energisch aufzurüsten, gegen die noch dringendere Forderung seines andern Schützlings Frankreich, die deutsche Wiederbewaffnung zu verhindern. Augenblicklich scheinen die Franzosen also noch mehr die Deutschen, als die Russen zu fürchten. Und das bei einer sehr starken kommunistischen Partei im eigenen Lande!
Das wäre so ein kleiner Abriß aus den Verhältnissen, unter denen augenblicklich an den vereinigten Staaten von Europa in Paris von den Aussenministern Frankreichs, Italiens, Westdeutschlands, Luxemburgs, Belgiens u. der Niederlande gearbeitet wird.
England will sich seiner splendieden Isolation noch immer nicht begeben, trotzdem auch England in recht umfangreichem Maße die Hilfe Amerikas in Anspruch genommen hat. Es hat auch, entgegen den Wünschen Amerikas, mit der Sozialisierungseiner Grundindustrien Kohle u. Eisen begonnen u. die Krankenfürsorge auf das ganze Volk und unbeschränkt ausgedehnt. In diesem Falle scheinen die Ansprüche der Patienten aller Art aber doch über das Leistungsvermögen Englands hinauszugehen. Die Ansprüche, die z.B. bei künstlichen Gebissen u. Brillen an die Kassen gestellt werden, sind augenblicklich einfach nicht zu erfüllen u. haben eine neue Verordnung gezeitigt, daß jeder Patient die Hälfte der entstehenden Kosten selbst tragen muß. Die Sozialisierung, die doch fraglos ein Vorbeugungsmittel gegen den Kommunismus sein sollte, scheint also in der englischen Form noch nicht durchführbar. Vielleicht nützt die geplante neue außerordentlich hohe Luxussteuer für die deutsche Bundesrepublik, mehr. Und an diese Steuerquelle müßte der Staat noch erheblich schärfer herangehen, bis den unvernünftigen reichen Leuten die Lust vergeht, mit ihrem Aufwand zu protzen u. immer wieder u. wohl ganz absichtlich den Neid des Proletariats zu reizen.
Es ist heute kaum noch denkbar, daß die Gegensätze zwischen Ost u. West noch einmal auf friedlichem Wege ausgetragen werden können. Aber in jedem Falle ist eine neue Einteilung der Erde notwendig. Es geht nicht an, daß Rußland zu seinem bisherigen riesigen Landbesitz noch halb Europa einsteckt u. die bisherigen Bewohner dieser Länder, wenigstens die Deutschen aus ihren Wohnsitzen vertreibt u. sie im Restdeutschland zusammenpreßt, daß sie sich kaum rühren können. Es geht auch nicht an, daß die Japaner mit ihren 90000000 Menschen auf ihre kleine Insel beschränkt werden, wo klimatisch geeignete fast menschenleere Gebiete in der Nähe vorhanden sind.
Und nun will ich meine Ausführungen schließen u. würde mich freuen, wenn Kinder u. Enkel etwas Unterhaltung daran gefunden hätten.
Unser Hof in Liessau
Am 1. Juni 1909 haben wir Hermann Wiebe u. Ehefrau Helene geb. Wiens, in gütergemeinschaftlicher Ehe lebend, von Gustav Mierau den Hof Liessau Grundbuchblatt 31 im Grundbuchamt Marienburg Westpr. in Größe von rnd.95,5 ha für 206 000 Mark gekauft u. 50 000 Mark darauf angezahlt. Bei dem Hof war eine Pachtung des Grundstückes Liessau 84, dem Gastwirt Neumann in Liessau gehörig. Diese Pachtung mußte mit 700 M. jährlichem Pachtzins bezahlt werden, wurde 1916 von dem Verpächter für 20 000 Mark (13,3 ha) gekauft [d.h. dem Verpächter abgekauft ] u. dem Hauptgrundstück zugeschrieben, das nun insgesamtrnd.108.8 ha groß war, die Grundbuch Nr. 31/84 Liessau trug u. insgesamt 226000 M. gekostet hatte. Von dem Neumann seinem Grundstück lagen etwa 1,8 ha auf Kl. Lichtenauer Feldmark, hingen aber vollständig mit dem Liessauer Anteil zusammen. Zuletzt etwa 1943 war der gesamte Hof zu einem Einheitswert von 216000 M. veranlagt.