Hilde Fieguth
Vorbemerkung
Im Frühjahr 2018 bekam ich von André Dieball vier Hefte mit Aufzeichnungen seines Großvaters Hermann Wiebe, die ich im Sommer abgetippt habe. Die Hefte haben folgende Titel:
1. Aus den ersten fünf Jahren unseres Flüchtlingslebens 24.Januar 1945-1950, Leeste bei Bremen, 2. Februar 1950
2. Meine Heimat, Leeste b. Bremen, 18.April 1951
3. Für meine Enkel, Hannover im Jahre 1954
4. Meine Heimat II. Ausfert[igung], Hannover, 3. März 1955
Der zeitlich letzte Band, Meine Heimat II. Ausfert[igung], 1955, ist die ausführlichste Darstellung des Themas “Meine Heimat“, und wird deshalb als erstes Dokument platziert. Daran schließt sich die erste Ausfertigung an, “Meine Heimat“, 1951, in der einige Episoden bereits erzählt werden, die aber auch mancherlei andere Details enthält. Es folgen die Hefte “ Aus den ersten fünf Jahren unseres Flüchtlingslebens“, 1950, und “Für meine Enkel“, 1954.
Beim Abschreiben der im Allgemeinen gut leserlichen Texte (in lateinischer Schrift) habe ich die manchmal eigenwillige Orthographie Hermann Wiebes (z.B. allmählig, paralel, erndten etc.) sowie die Groß- und Kleinschreibung (z.B. das auspumpen) und die zusammengesetzten Wörter ohne Bindestrich (z.B. die Weichsel und Nogatdämme) beibehalten; fehlende Kommas (vor daß oder bei Relativsätzen) der besseren Lesbarkeit wegen stillschweigend ergänzt, manche seiner Kommas auch weggelassen; offensichtliche Flüchtigkeitsfehler wie das Fehlen der Pünktchen auf ä ö ü beseitigt. Unverändert beibehalten habe ich die Kombination der Personennamen mit den Ortsnamen. Alle Ortsnamen wurden auch anhand der Internetseite www.westpreussen.de/cms/ct/ortsverzeichnis/details.php
überprüft. Durch Hinzufügungen in eckigen Klammern habe ich gelegentlich fehlende Teile seiner nicht immer perfekten Satzkonstruktionen ergänzt.
Alle meine Anmerkungen einschließlich der [?] zu unleserlichen Stellen, der [] bei Tilgung versehentlicher Wortwiederholungen sowie der hochdeutschen Übersetzungen plattdeutscher Textstücke (von Rolf übersetzt) stehen in eckigen Klammern und Kursivschrift. Alles habe ich mit Rolf gründlich besprochen.
Fotos und Scans habe ich beigefügt.
In: „Meine Heimat II“ erwähnt Hermann Wiebe frühere Aufzeichnungen:
S. 250: Über meine Jugend habe ich in einem Buch „Aus der Jugendzeit“, meiner Tochter Margarete geschenkt, und aus unserm gemeinsamen Lebensweg unter dem Titel „Von der grünen bis zur goldenen Hochzeit“ berichtet.
Aus der Schrift “Aus meiner Jugendzeit“ zitiert Egon Klaaßen in den “Tiegenhöfer Nachrichten“ 2006. Der Text stimmt oft fast wörtlich mit dem Band – „Meine Heimat II Ausfert[igung]“ überein.
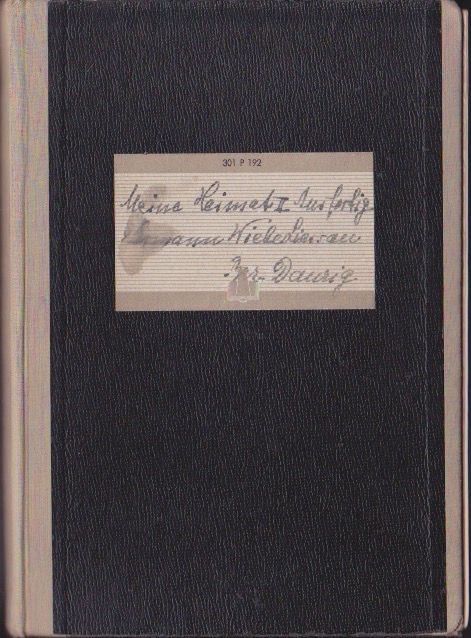
aus: Deutsches Geschlechterbuch, Band 132, Westpreußisches Geschlechterbuch, 1963
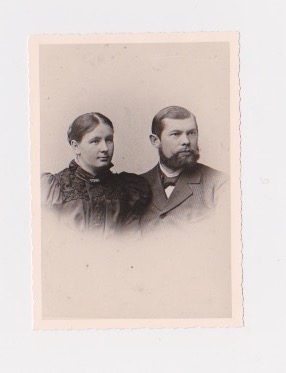
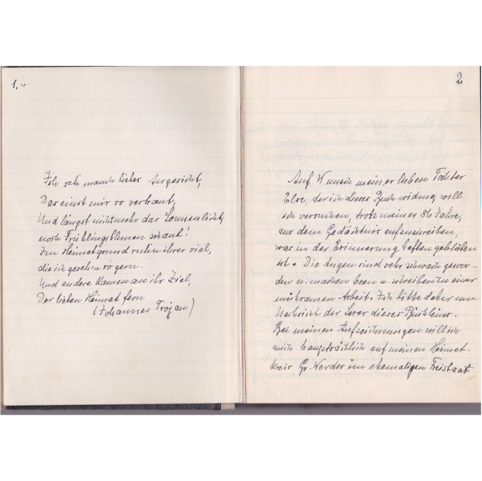
Meine Heimat II.Ausfertig[ung].
[beendigt am 3.März 1955, in seinem 86. Jahr geschrieben, s. S. 2 und S. 134]
Hermann Wiebe Liessau Bez.- Danzig
Ich sah manch liebes Angesicht,
Das einst mir so vertraut,
Und längst nicht mehr das Sonnenlicht
noch Frühlingsblumen schaut!
Im Heimatgrund ruh’n ihrer viel,
die ich geseh’n so gern.
Und andere kamen an ihr Ziel,
Der lieben Heimat fern
(Johannes Trojan)
Auf Wunsch meiner lieben Tochter Else, der ich dieses Buch widme, will ich versuchen, trotz meiner 86 Jahre, aus dem Gedächtnis aufzuschreiben, was in der Erinnerung haften geblieben ist. Die Augen sind sehr schwach geworden u. machen lesen u. schreiben zu einer mühsamen Arbeit. Ich bitte daher um Nachsicht der Leser dieses Büchleins. Bei meinen Aufzeichnungen will ich mich hauptsächlich auf meinen Heimatkreis Gr. Werder im ehemaligen Freistaat Danzig u. auf die Vorgänge in den letzten 100 Jahren vor unserer Vertreibung im Jahre 1945 beschränken, die ich zu ¾ miterlebt u. zu ¼ von meinem 1825 geborenen Vater u. seinen Altersgenossen erfahren habe.
Um Irrtümer zu vermeiden, bemerke ich noch, daß sich Namen u. Umfang des Kreisgebietes in den letzten 25 Jahren vor unserer Vertreibung mehrfach geändert hat. Von Beginn der preußischen Geschichte in diesem Kolonialgebiet bis 1920 war das große Marienburger Werder ein Teil des Kreises Marienburg Westpreußen. Er umfaßte vor 1920 aber nicht das ganze Delta zwischen Weichsel u. Nogat, sondern ein größeres Stück des Deltas, begrenzt von einer geraden Linie von Tiegenhof nach der Nogat bei Wiedau u. einer ebenfalls geraden Grenze von Tiegenhof nach Jungfer am frischen Haff, gehörte zum Landkreis Elbing. Dieses Elbinger Gebiet ist wahrscheinlich in der polnischen Zeit einmal mit dem übrigen Elbinger Gebiet von dem immer in Geldnöten befindlichen Polenkönig an den Preußenkönig verkauft worden. In Deich u. Entwässerungsangelegenheiten bildete es aber immer eine Einheit mit dem großen Marienburger Werder u. wurde 1920 bei Gründung des Freistaates Danzig, auch wieder politisch demselben zugeteilt. Eine weitere Veränderung erfolgte in den letzten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft, als die sogenannte Stromweichsel bis zur Ostsee als westliche Grenze des Kreises Gr. Werder erklärt wurde u. dadurch alles ehemalig zum Kreis Danzig-Niederung gehörige Land, östlich der Stromweichsel, an den Kreis Gr. Werder fiel. Dazu gehörte alles Land zwischen Ostsee u. Elbinger Weichsel u. dem frischen Haff und die Nehrung bis zur ostpreußischen Grenze. Das kleine Städtchen Tiegenhof wurde 1920 zur Kreisstadt gemacht, war Sitz des Landratsamtes, des Amtsgerichts, der Deichämter u. anderer Ämter. Es wurde dadurch gegenüber den andern, etwa gleich großen Städtchen Neuteich erheblich bevorzugt. An der polnischen Verwaltung hatte sich dadurch nichts geändert. – Wenn ich vorhin gesagt habe, daß ich mich auf die letzten 100 Jahre unserer Kreisgeschichte beschränken will, so wird es doch zum bessern Verständnis meiner Aufzeichnungen zwischendurch notwendig sein, auch auf weiter zurückliegende Ereignisse, auch außerhalb unseres Kreises einzugehen.
Die Besiedlung des Kreises Gr. Werder durch den Orden geschah nach culm. Recht und die culmische Hufe (16,6 ha) u. der culm. Morgen (0,56 ha) waren die Grundlagen bei der Verteilung des Landes, von dem wohl kaum Jemand mehr als bis 2 Hufen bekommen hat. Güter und Rittergüter waren keine vorhanden u. die Bezeichnung „Bauer“ für alle Grundbesitzer üblich. Aber im Laufe der Jahrhunderte hatte sich durch Zusammenlegung allmählig ein größerer Grundbesitz herangebildet, für den die Bezeichnung „Bauer“ eigentlich nicht mehr paßte. Diese Bezeichnung war zudem im 19ten Jahrhundert auch etwas in Mißkredit gekommen. Die kleineren Grundbesitzer nannten sich lieber „Hofbesitzer“ u. die größeren „Gutsbesitzer“. Da brachte der Nationalsozialismus für die kurze Zeit seiner Herrschaft die Bezeichnung „Bauer“ noch einmal zu Ehren u. nannte alle Grundbesitzer, ob groß oder klein, Bauern. Aber damit war der Unterschied in der Wirtschaftsführung u. Lebenshaltung nicht beseitigt. Es gab etwa 10 Bauern mit einem Wirtschaftsareal von 250-350 ha. u. etwa 50 Bauern mit einem Wirtschaftsareal von 150-250 ha. Die ließen sich unter der Rubrik „Bauern“ schlecht unterbringen.
H. Wiebe
Kap.I
Entwässerung u. Besiedlung
Als der deutsche Ritterorden 1228 bei Kulm über die Weichsel ging u. daran ging, das Gebiet, östlich der Weichsel von Thorn bis zur Abzweigung der Elbinger Weichsel, das im Norden von diesem Strom begrenzt wurde zu erobern, zu kolonisieren u. die Prußen zum Christentum zu bekehren, da war die Stromweichsel, auch Danziger Weichsel genannt u. im Westen die Elbinger Weichsel u. das frische Haff im Norden die Grenze des Ordensstaates im Kreise Gr. Werder. Der Orden muß schnell den Wert der Weichselniederungen erkannt haben, denn er ging sehr bald an die Eindeichung der Niederungen östlich der Weichsel, die bis 1300 schon vorläufig beendet war, trotz aller Kämpfe u. Aufbauarbeiten in den andern Teilen seiner Gebieter.
Es erregt wohl heute noch das Staunen der Fachleute über diese Leistungen des Ordens, dessen sich, wenn auch in kleinerem Umfang, fast gleichwertig die Trockenlegung der nördlichen, an das frische Haff u. den Drausensee grenzenden, teilweise unter dem Meeresspiegel liegenden Sumpfländereien durch die mennonitischen Holländer, die etwa ab 1550 ins Land kamen, [anschlossen]. Sie brachten aus ihrer Heimat die Kunst mit, durch Windschöpfwerke das Wasser bis 2 m. hoch zu heben. Dazu mußten natürlich erst Dämme an der Haffküste u. den ins Haff mündenden Flüssen gebaut u. Wasserschöpfwerke (Windmühlen) errichtet werden. Und wenn dann das Land gegen Haffstauund Überwässerung von dem oberhalb gelegenen großen Werder einigermassen geschützt u. trockengelegt war, dann begann die Herstellung von vielen, eng beieinanderliegenden Wassergräben, u. die Fortschaffung des Grabenaushubs auf die zukünftigen Baustellen der zukünftigen Bauernhöfe. An der Nordseeküste wurden diese Hügel „Wurten“ genannt; im Gr. Werder war diese Bezeichnung nicht üblich. Mir ist auch nicht bekannt, daß diese 2-3 m. hohen Hügel einen besonderen Namen getragen haben. Sie waren aber sehr notwendig, denn zur Zeit der Schneeschmelze u. auch bei starken Regenfällen waren die sehr ebenen Ländereien oft unter Wasser. Jedes neu angelegte Dorf war wieder ein Entwässerungspolder für sich, war rundum eingewallt u. besaß seine eigene Wassermühle. Das war ein charakteristisches Bild der Niederung mit den vielen Windmühlen, wenn sie im Betrieb waren. Die weißleuchtenden Leinwandsegel leuchteten bis auf viele Kilometer Entfernung. Das auspumpen konnte auch nicht beliebig vorgenommen werden. Es konnte damit erst begonnen werden, wenn der Haffwasserstand bis auf eine gewisse Höhe gesunken war, was im Frühjahr u. oft auch bei großen Regenfällen im Sommer oder bei Haffstau die Geduld der Niederungsbewohner oft auf eine harte Probe stellt. Bei allen solchen widrigen Verhältnissen waren die Hügel, auf denen die Bauern aus Holland hausten, ein sicherer u. trockener Zufluchtsort. Nicht so trocken ging es aber bei den verhältnismäßig vielen Deichbrüchen zu. Dann ging das Wasser über alle Wälle, u. Wälle, die zu hoch aufgeschüttet waren, mußten auf gewissen Stellen durchstochen werden, um dem Wasser schnellen Abfluß zu ermöglichen. Aber auch jetzt mußte mit dem Ausschöpfen des restlichen Bruchwassers gewartet werden, bis die Markmühle an der Linau das Zeichen gab, das ganz einfach darin bestand, daß diese Mühle in Betrieb genommen wurde. Darauf paßten die andern Mühlen schon auf. Weniger genau paßten sie auf, wenn die Markmühle wegen zu hoher Vorwasser stillgelegt wurde. Das war ein hartes Brot, das diese Holländer u. noch viele Generationen ihrer Nachkommen assen. Aber Wasserkatastrophen konnten diese Menschen nicht so leicht aus der Fassung bringen. Ich erinnere mich noch gern jener Bootsfahrt im Jahre 1888, die mich, als Begleiter meines Vaters, mit andern Verwandten auf dem Überschwemmungswasser des kleinen Marienburger Werders u. a. auch nach Ellerwald bei Elbing zu entfernten Verwandten brachte. Da war, trotzdem sie schon 3 Wochen im Oberstübchen des Wohnhauses saßen, keine Spur von Gram oder Trauer zu merken. Doch darauf komme ich noch später zurück. Es ist hier vielleicht die richtige Stelle, die Bezeichnungen Marienburger Werder u. Niederung zu erläutern: Werder nannte man den oberen, höher gelegenen Teil des Deltas, der frei auswässerte, u. Niederung den tiefer gelegenen Teil, der mit Schöpfwerken trocken gelegt werden mußte u. zunächst überwiegend von Holländern besiedelt war. Um dem Werder einen freien Abfluß seines Wassers in das frische Haff zu garantieren, andererseits aber die Niederungen vor Überflutung durch das Wasser zu schützen, mußten die 3 Hauptentwässerungsflüsse Linau, Schwente u. Jungfersche Lake ebenfalls von den Holländern bis weit in das Werder hinein eingewallt werden, wodurch die niedrigen Teile des Werders, die bis zur Ankunft der Holländer häufigen Überschwemmungen durch Stauwasser aus dem Haff ausgesetzt waren, erheblichen Nutzen [?] hatten. Möglich, daß das Deichamt zu diesen Einwallungen im Gr. Werder beigetragen hat, aber anfänglich hielten beide Teile eigensinnig an ihren Gerechtsamen fest, wobei die Holländer durch diesbezügl. Privilegien des Königs von Polen längere Zeit geschützt waren. Die Holländer behaupteten: sie hätten die ganzen Wallarbeiten auf eigene Kosten ausgeführt u. würden sie auch unterhalten, aber die Weichsel u. Nogatdämme u. die Entwässerung im Werder ginge sie nichts an. Schließlich einigten sich beide Parteien dahin, daß das Gr. Werder-Deichamt, die Unterhaltung der Haffdämme übernahm u. die Holländer sich wie die andern Deichpflichtigen an der Unterhaltung der Weichsel u. Nogatdeiche beteiligten.
Die Besiedlung des Werders durch den Orden begann schon im 13. Jahrhundert, wahrscheinlich entsprechend den Fortschritten der Eindeichung. Auch die Herstellung der Binnenentwässerungsanlagen lief wohl damit parallel. Ausser den schon genannten 3 Hauptentwässerungsanlagen Linau, Schwente u. Jungfersche Lake werden an der Haffküste noch viele kleine Rinnsale bestanden haben, die aber von den Holländern bei ihrer Einwallung des frischen Haffes sämtlich zugeschüttet wurden. Die Hauptentwässerungsader war die Schwente, die das ganze Werder von der Südspitze b. Kl. Montau bis zur Mündung in das Haff bei Stobbendorf durchfloß u. in ihrem untern Teil von dem Dorf Tiege ab Tiege genannt wurde. Sie entwässerte die ganze südliche Spitze des Deltas südlich der Eisenbahnstrecke Dirschau-Marienburg u. von den nördlich dieser Linie gelegenen Ländereien die folgenden Dörfer: Liessau, Kl. Lichtenau, Altenau, Heubuden, Warnau, Kaminke, Tragheim, Irrgang, Tannsee, Brodsack, Eichwalde, Leske, Trampenau (zu einem kleinen Teil), Trappenfelde, Tralau, die Hälfte von Gr. Lichtenau, Stadt Neuteich, Mierau, Tiege u. einen kleinen Teil von Marienau u. Rückenau u. die Stadt Tiegenhof.
Alles, was westlich dieser Dörfer bis zur Danziger u. Elbinger Weichsel lag, gehörte zum Linau Gebiet.
Alles, was östlich dieser Dörfer bis zur Nogat lag, gehörte zum Gebiet der Jungferschen Lake.
Die Kolonisten im Gr. Werder werden hauptsächlich aus Westfalen u. Niedersachsen gekommen sein. Auch sie werden sich zuerst mit den Entwässerungsanlagen beschäftigt haben, wobei allerdings die Gräben nicht mehr so eng beieinander liegen durften, wie in der Niederung. Die Linau war ein etwa 10 klm. langer u. 200-300m. breiter Binnensee, der Überrest eines Haffwinkels, das durch den Preesnick, unweit der Elbinger Weichsel, mit dem Haff verbunden war. Die Linau war das Auffangebassin für das [Wasser] aus den Vorfluten (Lichtenauer, Schönseer u. Schöneberger Vorflut), aber auch für das Wasser, das durch die vielen Mühlen ihrem Ufer hineingepumpt resp. geschöpft wurde. Die Vorfluten erstreckten sich bis in die höchst gelegenen Dörfer ihres Polders u. nahmen von beiden Seiten die Hauptwassergänge der einzelnen Dörfer auf u. so verästelte sich das ganze Grabennetz über das gesamte Delta, denn bei den beiden andern Poldern lagen die Verhältnisse ähnlich, nur wurden im Gebiet der Jungferschen Lake die Hauptzuleitungsgräben „Laken“ genannt, die aber dieselbe Aufgabe hatten, wie die Vorfluten oder die Hauptwassergänge an der Schwente.
Bewundern muß man die Sorgfalt der Ordenswasserbaumeister, daß keinem der Untertanen Unrecht geschah. Und so ist vielfach noch heute der Grundsatz, daß kein oberhalb gelegener Entwässerungsbezirk, der sich meistens mit der politischen Gemeinde deckte, den tiefer gelegenen Nachbar überwässern durfte. Solche tiefer gelegenen Ländereien mußten sorgfältig umgangen werden, auch wenn die Entwässerung bei dem höher gelegenen dadurch schlechter wurde, als bei dem tiefer gelegenen. Daß diese Auffassung irrig war, habe ich schon als junger Mensch bei meinem Vater in Irrgang feststellen können, wo in den 80ger Jahren des vorigen Jahrhunderts die zuständige Entwässerung, die Tannsee, Irrgang, Tragheimer Vorflut, gründlich ausgebaut u. auf weite Strecken ein vollkommen neues Flußbett geschaffen wurde. Auch hier war man, schon von der Ordenszeit her, ängstlich um die tieferen Ländereien herumgegangen. Das damalige Deichbauamt konnte die Bauern der genannten Dörfer überzeugen, daß eine gute Entwässerung nur möglich ist, wenn der Hauptwassergang auf die tiefsten Stellen des Polders verlegt würde. Dementsprechend wurde die Vorflut ausgebaut u. die Bauern sind gut dabei gefahren. Ich hab dann 16 Jahre in Brodsack u. 36 Jahre in Liessau gewohnt, wo ich dieselben Zustände vorfand, wie in Irrgang. Es ist mir weder in Brodsack noch in Liessau gelungen, die tiefer gelegene Gemeinde Kl. Lichtenau, trotz der augenscheinlichen Erfolge in Irrgang, von meiner Auffassung, die übrigens auch die Auffassung des Deichamtes war, zu überzeugen. Ich glaube, der Standpunkt der tiefer gelegenen Dörfer entsprang weniger der eigenen Überzeugung, als dem menschlich verständlichen Neidgefühl, daß der Nachbar einen Vorteil von einer Sache habe, auch wenn er ihm selbst keinen Schaden bringt.
Als Illustration zu meinen obigen Ausführungen möge noch die Tatsache dienen, daß die Gemeinde Kl. Lichtenau durch den Hohengraben, den Entwässerungsgraben der Gemeinde Liessau, in Bezug auf die Entwässerung in 2 Teile zerschnitten war. Um eine einheitliche Entwässerung für Kl. Lichtenau aufrecht zu erhalten, mußte das Wasser des höher gelegenen Teils mittels eines sogenannten „Dyckers“ unter der Sohle des hohen Grabens quer hindurch geführt werden. Das gab natürlich oft Differenzen zwischen den beiden Gemeinden. In den Jahren 1919/22 mußte der Dycker bei einer gründlichen Instandsetzung das hohen Grabens vorübergehend entfernt werden. Der Wiedereinbau des Dyckers verzögerte sich wegen der Inflation um einige Jahre. Derweil wässerten die Kl. Lichtenauer ganz bequem in unsern neu ausgebauten hohen Graben u. Liessau war auch bereit, den fraglichen Teil Kl. Lichtenaus gegen angemessenen Anteil an den Unterhaltungskosten des hohen Grabens bei sich aufzunehmen, aber es kam zu keiner Einigung, ja nicht einmal zu diesbezügl. Verhandlungen. Die Kl. Lichtenauer bestanden starr darauf, daß ihnen ihr geliebter Dycker wieder hergestellt würde, was denn auch geschah. Auch dieser hohe Graben hatte schon einmal 30 Jahre früher eine radikale Verlegung u. Verkürzung des Flußlaufes, ähnlich wie in Irrgang-Tannsee erfahren, u. vereinigte sich in seinem Unterlauf, kurz vor seiner Einmündung in die Schwente bei Altenau, mit der Entwässerung von Kl. Lichtenau, dem Schmerblockgraben u. bildeten nun beide Wasserläufe den Hohen u. Schmerblockgrabenverband.
Wenn man sich die alten stillgelegten Wasserläufe des hohen Grabens u. der Tannsee-Irrganger Vorflut ansah, die beide viele Kilometer durch hohes Land geführt waren, um tiefer gelegene Ländereien zu umgehen, dann konnte man nur den Kopf schütteln.
Ähnliche Gefühle bewegen uns wohl, wenn wir die Anlage der Weichsel u. Nogatdeiche betrachten. Man kann wohl annehmen, daß einstmals zur Zeit der Anlage der Dämme die beiden Ströme sich oft gespalten u. größere oder kleinere Inseln gebildet haben. Man kann nicht recht verstehen, weshalb der Orden diese Nebenarme der beiden Ströme nicht einfach koupiert hat, anstatt oft recht große Verlängerungen der Dämme in Kauf zu nehmen. Bei der vielfach bewiesenen Baukunst, auch der Wasserbaukunst des Ordens, kann ihm die Kunst des Koupierens von Strömen kaum fremd gewesen sein. Diese Unterlassungssünde[n] des Ordens haben 600 Jahre lang den Niederungsbewohnern großen Schaden zugefügt. An diesen unnatürlich verbreiterten Stromstellen kam das Eis oft zum Stehen u. verstopfte den Strom u. da mußte denn oberhalb der Stopfung unweigerlich nach einer, manchmal sogar nach beiden Seiten, der Damm brechen.
Zu einer weiteren Quelle des Leides für die Niederungsbewohner wirkte sich eine Maßnahme des großen Friedrichs aus, als er 1772 bei der ersten Teilung Polens zwar das ganze Westpreußen, aber nicht die schöne Stadt Danzig erhielt, nach der er große Sehnsucht hatte. Die Liebe zu Danzig war ganz einseitig, denn die stolzen Danziger hatten keine Sehnsucht nach der preußischen Herrschaft u. wollten sich ihre Freistaats Herrlichkeit bewahren. Da verfiel König Friedrich auf den Gedanken, den Danzigern das Weichselwasser abzugraben, um sie in ihrem Handel mit Polen zu schädigen. Das geschah auf die Weise, daß er den Wasserabfluß in die Nogat verbesserte. Zu dieser Verbesserung gehörte auch die Beseitigung einer Anzahl Bäume, die hart an der damals engen Stromverbindung standen u. bis dahin gewissermassen eine Eiswehr gebildet hatten. Die Nogat erhielt auch tatsächlich einen etwas stärkeren Wasserzufluß, aber leider auch einen erheblich stärkeren Anteil am Weichseleis. Das wirkte sich in vermehrten Eisverstopfungen u. Deichbrüchen aus, welche dem großen Werder gewaltige Schäden zufügten. Die Danziger haben wenig unter dieser Maßnahme gelitten.
Im übrigen möchte ich noch bemerken, daß, nach den Anlandungen an der Mündung dieser beiden Ströme zu urteilen, in vorgeschichtlicher Zeit Nogat u. Elbinger Weichsel die Hauptmündungen der Weichsel gewesen sind, und daß die Weichsel schon einmal im Jahre 1840 sich selbständig einen kürzeren Weg zum Meer gesucht hat, indem sie bei Neufähr die Düne durchbrach. Das war den Danzigern sehr willkommen, denn nun konnte der bisherige Weichselstrom kurz unterhalb der Durchbruchstelle koupiert u. eine Schiffahrtsschleuse eingebaut werden u. der nun stillgelegte untere Weichselteil, die tote Weichsel genannt, diente den Danziger Holzhändlern als Liegeplatz für ihre vielen, aus Polen bezogenen Holzflöße u. zu andern gewerblichen Zwecken. Auch waren die Danziger nun die Sorgen bei den jährlichen Eisgängen u. den gelegentlichen Hochwasserwellen der Weichsel los.
Das waren so etwa in großen Umrissen die Zustände im großen Werder im Jahre 1840. Für den Verkehr war noch recht wenig getan. Eine einzige feste Straße durch das große Werder in einer Länge von 20 Klm durchschnitt die obere Spitze des Deltas von Dirschau nach Marienburg, ein Teil der Staatschaussee Berlin-Königsberg. Der übrige Teil des großen Werders mit seinen durchweg lehmigen Böden, war in den langen Wintermonaten, wenn nicht gerade Schlittenbahn, für Fuhrwerke unpassierbar, desgleichen im Sommer bei lang anhaltenden Regenperioden. Da war dann das Reitpferd das einzige zuverlässige Verkehrsmittel und wurde auch viel benutzt. In den Niederungen mit ihren vielen Wassergräben gab es zusätzlich noch die Verkehrsgelegenheit auf Schlittschuhen, die besonders von der Jugend eifrig benutzt wurde. Das war, wenigstens in den Niederungen, die einzige Sportmöglichkeit, die auch den Frauen offenstand. Sonst beschränkte man sich auf den Nachbarschaftsverkehr, der denn auch eifrig gepflegt wurde. Die erste weitere Verkehrsverbesserung bestand in der Anlage des Weichsel-Haffkanals, der um 1840 angelegt wurde u. die Danziger Weichsel von Rotebude aus, wo eine Schiffahrtsschleuse in den Weichseldamm eingebaut wurde, über die Linau nach Platenhof bei Tiegenhof u. dann über Tiege u. Müllerlandskanal, ins frische Haff führte. Es war jahrzehntelang die günstigste Verbindung von Tiegenhof nach Danzig u. kam hauptsächlich dem Verkehr von Tiegenhof u. Umgegend zugute. Dann wurde 1858 die Ostbahn von Berlin nach Königsberg in Betrieb genommen. Da dieselbe fast parallel mit der Staatschaussee von Dirschau nach Marienburg verlief, so war sie einstweilen keine wesentliche weitere Verkehrsverbesserung. Inzwischen war um 1840 auch der Kanal bei Pieckel gegraben u. in Betrieb genommen. Es war eine neu geschaffene Verbindung zwischen Weichsel u. Nogat, die nicht mehr im spitzen Winkel, wie die alte Nogatabzweigung von der Weichsel in die Nogat führte, sondern im rechten Winkel, was nach Ansicht der Sachverständigen den Eiszufluß zur Nogat verringern sollte. Außerdem wurde noch als zusätzliche Verbesserung dieses Plans ein hölzernes Eiswehr in den neuen Kanal eingebaut. Aber die Sachverständigen hatten sich getäuscht. Bei dem nächsten Eisgang warf das Eis das ganze Eiswehr über den Haufen u. schwemmte es fort u. Eis u. Wasser hielten nach alter Weise ihren Einzug in die Nogat. Die preußische Regierung hatte sich offenbar wohl schon längere Zeit mit dem Weichselregulierungsprojekt beschäftigt, aber mit solchen kleinen Mitteln war dem Übel nicht beizukommen u. für eine gründliche Regulierung fehlte immer das Geld. Auch als nach 1848 das preußische Abgeordneten Haus für die Bewilligung der Mittel für eine solche Regulierung zuständig war, konnte eine solche Vorlage, die fraglos viele Millionen kosten würde, nicht durchgebracht werden. Selbst die verheerendste Dammbruch-Katastrophe vom 28. März 1855, die das Gr. Werder je erlebt hatte, konnte das Abgeordnetenhaus nicht umstimmen. Es bedurfte erst noch einer ähnlichen Katastrophe vom 25. März 1888, als der Damm bei Jonasdorf brach u. 30-40 000 ha bestes Land unter Wasser gesetzt, 3 Höfe total weggerissen wurden u. viel Vieh in den Fluten umkam u. große Landflächen versandeten. Jetzt war das Abgeordnetenhaus endlich bereit, die Mittel für eine gründliche Weichselregulierung zu bewilligen. Es war ein großes Unternehmen, das 1890 in Angriff genommen u. 1915 beendet wurde. Es sah so aus:
1. Daß dem Strom eine neue Mündung zwischen Nickelswalde u. Schiewenhorst in die Ostsee geschaffen würde.
2. daß die gesamten beiderseitigen Weichseldämme von der Ostsee bis einige Kilometer oberhalb der Nogatabzweigung auf eine Strombreite von 1000 m. verlegt, das heist, entweder näher an den Strom herangelegt oder von ihm zurückgezogen wurden.
3. daß die beiden Weichselbrücken bei Dirschau-Liessau um je 250 m., also auf 1000 m., verlängert würden.
4. daß Nogat u. Elbinger Weichsel abgeschlossen u. mit Schiffahrtsschleusen versehen werden u. eine dritte Schiffahrtsschleuse aus dem neuen Mündungsgebiet in die verlängerte tote Weichsel führte.
5.daß Elbinger Weichsel u. Nogat ausgebaggert u. kanalisiert u. letztere mit 3 Stauschleusen u. zugleich Schiffahrtsschleusen versehen würden.
25 Jahre ist ununterbrochen an diesem großen Werk gearbeitet worden u. als es fertig war, da war der verlorene Krieg u. der Verlust Westpreußens das erste Warnungszeichen für uns, daß wir hier keine bleibende Stadt haben.
Zwar drohte dem ganzen Werk resp. seinem Schlußstück 1914 durch den am 1. Aug. 1914 ausgebrochenen ersten Weltkrieg eine große Gefahr. Die schon begonnene Koupierung der Nogat mußte im Interesse der Landesverteidigung wieder geöffnet werden. Die ganzen Dammarbeiten wurden sofort eingestellt. Die Russen waren bis zu einer Linie Königsberg-Allenstein in Ostpreußen vorgedrungen u. die östlich der Weichsel wohnenden Bauern hatten schon Befehl, sich auf eine Räumung bis zur Weichsel vorzubereiten, als es Ende August dem Generalfeldmarschall v. Hindenburg u. seinem Generalstabschef General Ludendorf[f] durch ihre geniale Führung gelang, mit 250 000 Mann deutscher Truppen ein doppelt so starkes russisches Heer zu schlagen u. sie aus Ostpreußen zu vertreiben. Zwar kehrten sie noch einmal bis zur sogenannten Angerapplinie zurück, aber die sogenannte Winterschlacht in Masuren befreite uns endgültig von der russischen Gefahr u. brachte uns soviel Kriegsgefangene, daß neben der Versorgung der Landwirtschaft mit Arbeitskräften auch noch Menschen übrig waren, die 1915 die restlichen Teile der Weichselregulierung ausführen konnten.
Da ich mit meiner Familie seit 1909 in Liessau 1 klm. unterhalb der beiden Brücken wohnte u. zu der Kriegszeit Amts- u. Gemeindevorsteher in Liessau war, so habe ich die letzte Phase der Weichselregulierung von 1912-15 aus allernächster Nähe miterleben können. Wir saßen nun hinter unsern starken Deichen u. warteten neugierig auf den Tag, wo die Weichsel die Probe auf das Exempel ablegen würde. Die erste Probe brachte uns ein großes Sommerhochwasser im Jahre 1917. Es fiel nicht sehr erfreulich für uns aus! Wir Angrenzer an die Weichsel hatten zwar immer etwas unter Quellwasser zu leiden, aber in diesem Jahr waren die Quellschäden besonders stark, was wir mit dem durch Nogatabschluß um 1 m. erhöhten Wasserstand der Weichsel in Verbindung brachten. Dann dauerte es Jahre bis zur Generalprobe am 1.4.1924. Da trafen möglichst alle ungünstigen Umstände für einen Weichsel Eisgang zusammen. Einmal war es ein sehr schneereicher Winter im ganzen Weichselgebiet gewesen, der viel Frühjahrswasser brachte u. dann kam das Wasser u. Eis aus den großen Nebenflüssen Bug u. Narew, das erfahrungsgemäß 1 Woche nach dem Weichseleis herunter zu kommen pflegte u. in diesem Jahr gleichzeitig mit dem Weichseleis in Bewegung kam. Nach alten Erfahrungen wäre totsicher wieder ein Dammbruch bei uns fällig gewesen, aber in diesem Jahr war überhaupt kein Mensch auf Eiswache, außer dem Deichhauptmann u. seinem Sekretär, die vom Hauptquartier in Liessau den Eisgang beobachteten. Bei einem Wasserstand von 8,70 m. am Liessauer Pegel vollzog sich der ganze Eisgang in 2 Tagen. Es war ein überwältigender Anblick, wie die dicht gedrängten Eisschollen, die kaum einmal etwas Wasser erblicken liessen, in sausender Fahrt u. die ganze Strombreite bedeckend, zum Meer hinunterschwammen. Das Eis war in 2 Tagen weg, aber der Wasserstand fiel nur langsam. Und trotzdem hatten wir in diesem u. auch den folgenden 20 Jahren wenig Quellwasser. Das Weichselbett hatte sich durch die gewaltigen Wassermassen bis zu 10 m vertieft. Vielleicht war das der Grund dafür.
Inzwischen hatten wir nun im Jan. 1920, sehr gegen unsern Willen, unsere Staatsangehörigkeit geändert; wir waren Bürger der Freien Stadt Danzig geworden. Die Nogat wurde die Ostgrenze dieses Staates u. auch des Kreises „Großer Marienburger Werder“, der fortan den Namen “Gr. Werder“ führte, u. von den 2 kleinen, im Kreisgebiet gelegenen Städtchen Neuteich u. Tiegenhof, je etwa 4000 Einwohner, wurde Tiegenhof zur Kreisstadt erhoben, wie ich auch schon einmal ausgeführt habe.
Um noch bei der Entwässerung zu bleiben, so kann ich feststellen, daß sich der Wunsch nach besserer Entwässerung, angespornt durch diesbezügliche Arbeiten im Nachbarkreis Danziger Werder unter seinem regen Deichinspektor Bertram u. gefördert von der neuen Regierung in Danzig, mächtig regte. Zuerst ging der sogenannte Linauverband, der den westlichen, nach der Weichsel gelegenen Teil des Werders, u. diesesmal gemeinsam mit der Niederung entwässern sollte. Der neu gewählte Deichinspektor Weiß hatte anfänglich noch nicht das volle Vertrauen der Mitglieder dieses Verbandes. Der Deichinspektor des Danziger Werders, Bertram, wurde als höchste Instanz bei den Beratungen der Voranschläge zugezogen. Weiß hatte sich aber bald das Vertrauen der Gr. Werderaner erworben u. Bertram wurde nicht mehr benötigt. Der Plan ging dahin, das gesamte Linaugebiet in Größe von etwa 20000 ha. durch ein einziges großes, an der Elbinger Weichsel bei Kalteherberge zu erbauendes Pumpwerk zu entwässern. Dieser Plan wurde in 5jähriger Arbeit ausgeführt. Er sah den Bau des oben erwähnten großen mit 3 Durchlaßrohren von je 2 m. Durchmesser versehenen Pumpwerkes vor, das mit Elektrizität u. auch mit Dieselmotoren betrieben werden konnte. Gleichzeitig wurde ein etwa 2 klm langer Kanal von dem äußersten Zipfel der Linau zum Pumpwerk gebaut. Als Sammelbecken diente die Linau, deren Wasserspiegel um 1 ½ -2 m gesenkt wurde. Als das geschehen war, konnte man an den Ausbau der vielen u. langen Vorfluten u. Entwässerungsgräben gehen, die ebenfalls um 1 ½ m vertieft wurden. Die Hubkraft des Pumpwerkes war so groß, daß nur 2 Rohre gebraucht wurden, auch bei der Schneeschmelze u. großen Regenfällen im Sommer. Das dritte Rohr konnte fast ständig in Reserve bleiben. Auch die Hubhöhe war bei diesem Werk nicht begrenßt, wie bei den Windschöpfwerken. Das Wasser mußte ja über den Damm der Elbinger Weichsel gepumpt werden. Als ich nach Jahren wieder einmal in die Niederung kam, da erkannte ich dieselbe kaum wieder. Das Wasser aus den Gräben war verschwunden u. aus den früheren schiffbaren Kannälen waren armselige Wassergräben geworden, die kaum etwas Wasser führten u. das schöne Bild der rastlos sich drehenden Windmühlenflügel war auch verschwunden. Die Mühlen waren abgebrochen bis auf einige, die unter Denkmalschutz standen. Ja, manche Bauern, die bisher unter zuviel Wasser litten, mußten sich jetzt ihr Koch u. Trinkwasser aus den Käsereien mitbringen lassen, weil die Brunnen nur salziges Wasser hergaben.
Ähnlich wie bei dem Linauverband wurde später auch bei dem Verband der Jungferschen Lake vorgegangen. Auch das Pumpwerk dieses Verbandes, der etwa das gleich große Areal entwässern sollte, wie der Linauverband, stand an der Elbinger Weichsel u. zwar ganz hart an der Mündung in das Haff. Als Sammelbassin hatte man eine Haffbucht vor der Mündung der Jungferschen Lake eingedeicht.
Die Jungfersche Lake hatte übrigens viele Jahre früher einige einschneidende Veränderungen erfahren. Mitte der achtziger Jahre war in die Mündung der Jungferschen Lake dicht bei dem Dorf Jungfer eine Stauschleuse eingebaut worden, die den Haffstau von der Lake u. ihren Zuleitungsgräben abhielt. Im Anschluß daran wurde die obere Jungfersche Lake schiffbar gemacht u. durch einen Schiffahrtskanal mit dem Dorfe Lindenau verbunden. Ein erheblicher Schiffsverkehr hat sich aber auf diesem Kanal nicht entwickeln können, besonders, als in den neunziger Jahren die Kleinbahnen des Kreises immer mehr ausgebaut wurden u. auch in diesen Gegenden den Kannälen erhebliche Konkurrenz machten.
Bleibt noch der Schwenteverband zu schildern, der einzige, der bis auf einige kleine Mühlenwerke in Mierau, Tiege, Marienau u. Rückenau, frei auswässert. Damit ist aber nicht gesagt, daß die Ländereien in diesem Polder auch immer genügend auswässern können. Man hat zwar auch hier schon in den siebenziger Jahren erhebliche Verbesserungen vorgenommen. Die Schwente wurde von der Brückstelle Tiege ab bis Neuteich ausgebaggert u. etwas begradigt u. dann dem Schiffsverkehr dienstbar gemacht. Die erheblichen Zuckerverschiffungen durch die Zuckerfabrik Neuteich u. die Heranschaffung von allen Massenbedürfnissen derselben. Die Holzflößereien für einige Sägewerke in Neuteich u. der Getreidetransport der Kaufleute bedingten einen regen Schiffsverkehr, den diese Interessenten auch durchaus nicht missen wollten u. gegen alle etwaigen Entwässerungsverbesserungen protestierten. Man sprach auch mitunter von einem Projekt zur Aufstellung eines Pumpwerkes kurz oberhalb Neuteich, wo die beiden Schwenten (große u. kleine Schwente) zusammenkamen, aber geworden ist davon nichts.
Nun entwässern die beiden Schwenten gerade die höchst gelegenen Ländereien des Kreises, die einer Verbesserung ihrer Entwässerung kaum bedürfen, aber zwischendurch sind immer wieder kleinere Flächen, denen eine bessere Entwässerung gut tun würde.
Kap. II
Verkehr
Auf die Verkehrsverhältnisse, soweit sie mit der Entwässerung zusammenhingen, bin ich schon im vorigen Kapitel eingegangen. An befestigten Straßen besaß der Kreis bis 1870 noch keine. 1871 wurde die erste Kreischaussee Neuteich-Liesssau gebaut. Sie erhielt noch auf beiden Enden Chausseegeld-Einnehmerhäuschen, die auch bis zum letzten Tage noch bestanden, aber bei meinem Denken nicht mehr benützt wurden. Dann wurde 1874-75 die Chaussee Marienburg-Neuteich-Tiegenhof gebaut, an deren Entstehung ich mich noch sehr genau erinnere, denn sie führte in etwa 200 m. Entfernung an meinem väterlichen Hof in Ladekopp vorbei. Dann wurden im Lauf von 40 Jahren soviel Chausseebauten ausgeführt, daß bei Ausbruch des ersten Weltkrieges im Jahre 1914 fast jedes Dorf Chausseeanschluß hatte. Anfänglich wurde den Bauern das Land, das sie zum Chausseebau hergeben mußten, noch vom Kreise bezahlt; später mußten die Gemeinden, die Chaussee haben wollten, das Land frei hergeben, d.h. die Gemeinden mußten die Bauern, welche Land hergaben, entschädigen, was mitunter heftige Feindschaft zwischen den Nachbarn hervorrief. Aber trotz alledem war die Sehnsucht nach einer Chaussee so groß, daß einige Gemeinden auf ihre eigenen Kosten Anschlußchausseen bauten, unter Subventionierung durch den Kreis. Dazu gehörten unter anderem die Chausseen Tragheim-Gr. Lesewitz, Trampenau-Parschau und Damerau-Barendt. Diese Chausseen wurden aber später alle vom Kreis übernommen. Bevor die Bahn Simonsdorf-Tiegenhof gebaut war, verkehrte einmal tägl. die gelbe Postkutsche von Marienburg nach Tiegenhof. Ich bin zwar nie mit der Post gefahren; sie ist aber doch eine freundliche Erinnerung an meine Jugendzeit. Sie kam nämlich pünktlich um 11 Uhr an meines Vaters Hof in Irrgang vorbeigefahren u. war dort von allen Teilen unseres Landes sichtbar. Folgedessen wurde sie als Signal für die Mittagspause benutzt. Wir haben sie später recht vermißt u. mußten den Ausfall der Post durch eine weiße Flagge ersetzen, die am Scheunengiebel von der Köchin hochgezogen wurde, wenn das Mittagessen fertig war. So ein Landbriefträger hatte in meiner Jugend ein schweres Amt. Er mußte für etwa 3 Dörfer die Post zu Fuß bestellen, zu einer Zeit, wo Chausseen selten u. Fußsteige garnicht vorhanden waren. Da wurden die Postsachen von dem alten Copenzgerne in Schulen, Schmieden, Molkereien etc. abgegeben. Etwa 1889/90 wurde die Sekundärbahn Simonsdorf-Neuteich-Tiegenhof eröffnet, die sogenannte Machandelbahn. Mit der Postkutsche war auch ein anderer Betrieb, die Fuhrhalterei Preuß Neuteichsdorf eingegangen. Reichlich 10 Jahre lang hatte er mit einer Anzahl Gespanne Zucker für die Neuteicher Zuckerfabrik nach Liessau oder Marienburg gefahren. Nun brauchte ihn die Fabrik nicht mehr, die trotz der Verschiffung des Zuckers auf der Schwente, auch, besonders im Winter, die Pferdetransporte nicht entbehren konnte. 1895 wurden von den Zuckerfabriken Liessau-Neuteich, Marienburg u. Tiegenhof Kleinbahnen in ihr Rübeneinzugsgebiet gebaut, die zunächst ausschließlich im Dienst der betr. Fabrik standen u. untereinander keine Verbindung hatten. Um 1900 wurden diese Rübenbahnen von der Westpr. Kleinbahn A.G. in Danzig aufgekauft. Sie schloß die einzelnen Strecken zusammen, baute sie besser, auch für Personenbeförderung aus u. machte sie allen Einwohnern des Kreises für ihren Bedarf zugänglich. Das war, besonders für die abgelegenen Dörfer, eine große Erleichterung. Bald hatte die Post auch in den Dörfern Postbriefstellen eingerichtet, was dem gesteigerten Verkehr zu Gute kam. In diesen Posthilfestellen, die meistens nebenamtlich verwaltet wurden, waren auch sehr bald öffentliche Fernsprechstellen eingerichtet, die viele Jahre lang dem Telefonbedürfnis der Dörfer genügten. Aber 1914 bei Ausbruch des ersten Weltkrieges hatte schon jeder Kaufmann u. auch die meisten Bauern ein eigenes Telefon.
Nachdem um 1890 sich die zweirädrigen Fahrräder auch bei uns eingeführt hatten, tauchten um 1900 die ersten Automobile bei uns auf, aber bei den Bauern tauchten sie erst nach Beendigung des ersten Weltkrieges auf u. waren auch bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges nicht allgemein geworden, aber das Radio hatte sich bei Beginn des II. Krieges bei den Bauern u. auch einem großen Teil der Arbeiter eingebürgert.
Um 1890 waren auch in den großen Kirchdörfern Säle an die Gasthäuser angebaut, die das gesellige Leben sehr beförderten. Neben allerlei Vereinstagungen wurden dort auch gerne Hochzeiten gefeiert u. als die Kinovorführungen zwischen den beiden Weltkriegen erst allgemein bekannt wurden, benutzte man die Säle auch dazu. Auch die Flugzeuge wurden zwischen den beiden Weltkriegen schon ab u. zu benutzt, aber den gewaltigen Aufschwung, den dieses neueste u. schnellste Beförderungsmittel in der ganzen Welt genommen hat, haben wir in der Heimat nicht mehr erlebt.
Eine gewisse lokale Bedeutung hatten auch die mit Pferden betriebenen Feldbahnen gewonnen, die von einigen größeren Landwirtschaften vor dem ersten Weltkrieg angeschafft worden waren u. besonders die großen Zuckerrübenbaubetriebe bei der Rübenabfuhr weitgehend vom Wetter unabhängig machten.
In den dreiz[ß]iger Jahren, als die Landwirtschaft in Deutschland sehr gefördert u. zur Anschaffung aller möglichen neuen Maschinen u. Geräten angeregt wurde, da sahen wir neidvoll über die nahen Grenzen, wo Trekker aller Art, Futtersilos, Mähdrescher etc. förmlich aus der Erde wuchsen. Aber nur einige kapitalkräftige Landwirte konnten in bescheidenem Umfang ähnliche Anschaffungen machen. Unter den verhältnismäßig wenigen Neuanschaffungen waren unter anderm die Pommritz-Rübenhebepflüge u. die Luftgummibereiften Ackerwagen. Um beide Geräte hatte die Zuckerüben bauende Landwirtschaft mehr als 50 Jahre gekämpft u. Menschen u. Tiere abgeschunden, bis endlich dieser einfache u. billige Rübenheber auf der Bildfläche erschien. Auch der luftgummibereifte Ackerwagen in seinen verschiedenen Größen war das Praktischste, was bisher in Ackerwagen geboten wurde.
Zu der Zeit der Freistaatherrlichkeit war es für unsere Reichsdeutschen Landsleute die einzige Möglichkeit, ohne poln. Visum nach Danzig zu gelangen, wenn sie mit dem D.Zuge nach Marienburg oder Elbing fuhren u. dann von dort aus mit Autoomnibus oder Kleinbahn durch das große Werder nach Danzig fuhren. Die Reise mit der Kleinbahn war nur von Marienburg aus möglich u. außerdem sehr zeitraubend. Folgedessen entwickelte sich bald ein reger Omnibusverkehr: Marienburg-Neuteich-Ladekopp-Danzig und Elbing-Tiegenhof-Ladekopp-Danzig. Nach Beendigung des Polenfeldzuges im September 1939 fiel diese Verbindung sofort weg.
Kap. III
Wirtschaftsweise der Bauern
In dieser Wirtschaftsweise hatte sich im Gr. Werder seit Jahrhunderten wenig bis 1840 verändert. Die Landnutzung bestand nach wie vor hauptsächlich im Getreidebau auf den höheren Ländereien des Werders, und überwiegend in der Kuhhaltung in der Niederung. Das Getreide wurde noch, wie zu Cäsars Zeiten, mit dem Flegel ausgedroschen u. durch Werfen durch den Wind gereinigt. Das Werfen geschah mit großen, selbst angefertigten Holzschaufeln auf der Scheunentenne, wo zu diesem Zweck beide Scheunentüren geöffnet wurden, um Zugluft herzustellen. Oft fehlte aber die nötige Windbewegung, oder der Wind kam unpassend längs der Scheune. Dann wurden eine oder nach Bedarf auch mehrere große Scheunentüren ausgehoben u. damit an einer Seite der Scheune ein Windfang gebildet, wodurch in den meisten Fällen der nötige Zugluftstrom erzeugt wurde. Nachdem auf diese Weise die Spreu vom Korn getrennt u. auch das magere Korn vom vollwertigen getrennt war, mußten noch mit Handschüttelsieben etwaige grobe Bestandteile, wie Distelknoten, Erdkluten etc. aus dem Korn entfernt [werden],[dann] wardasselbe verkaufsfertig u. wurde mit Scheffelmaßen in die Säcke gefüllt. Gewogen wurden diese Kornsäcke nicht, sondern vom Kaufmann ebenfalls mit dem Scheffelmaß nachgeprüft. Die Würde des gelieferten Korns war natürlich sehr verschieden u. wurde vom Kaufmann schon vor der Lieferung durch das sogenannte holländische Gewicht mittels einer kleinen Handwage festgestellt u. bei der Lieferung ebenso nachgeprüft.
Der Leser dieser Zeilen wird sicher in Gedanken ausrufen: „Welch mühsames Verfahren!!“
Um 1830 war der Rapsbau eingeführt. Er brachte schon etwas Abwechslung in den dauernden Getreidebau, erforderte aber eine sorgfältige Bodenbearbeitung durch Schwarzbrache u. kräftige Stalldüngung. Aber die Einnahmen aus Raps müssen besonders hoch gewesen sein. Das ging wenigstens aus einem Rechnungsbuch meines Großvaters hervor, der 30 Jahre lang die Einnahmen aus Rapsverkauf angeschrieben hatte, aber weiter nichts. Man könnte annehmen, daß alle übrigen Einnahmen nicht des Anschreibens wert gewesen seien. Die Bearbeitung des Raps’, nachdem er mit der Sichel abgeschnitten u. auf kleine Häufchen gelegt war, mußten die Werderaner noch lernen. Anfänglich wurde der Raps, sofort nachdem er abgeschnitten war, in die Scheune, in ein leeres Fach gefahren, das von allen andern Resten gesäubert war u. dessen Lehmboden tennenartig festgestampft war. Dort blieb er einige Monate liegen u. wurde dann wie Getreide mit dem Flegel gedroschen. Aber dann fanden wir heraus, daß man den Raps ruhig auf dem Felde liegen lassen konnte, ohne daß die Schoten aufplatzten, wie man befürchtet hatte u. daß er dann allerdings mit Planwagen in die Scheune gefahren u. mit Pferden ausgeritten werden konnte, ohne sonderliche Verluste. Eine sorgfältige Behandlung war dabei allerdings oberstes Gebot. Das ausreiten war ein besonderer Spaß für die Bauernjungen, die zu dieser Arbeit auch gerne zum Nachbar gingen, besonders, wenn er mit 30 [50?] Pfennig pr. Tg bezahlte. Nachdem aller Raps eingeerntet war u. das Stroh für Heizzwecke beiseite geräumt, wurde der Rapszylinder angestellt, eine, gewissermaßen als Röhre zu bezeichnende, etwa 4 m. lange, etwas schräg gestellte, mit passendem Maschendraht überspannte Trommel von etwa 70 cm. Durchmesser, die von einem Mann oder auch einer Frau gedreht wurde. Dieser Rapszylinder befreite die Rapsfrucht von den fingerlangen Schlauben, die ebenfalls ein gutes Heizmaterial waren. Das Rapsgut wurde dann anfänglich auch durch werfen in den Wind gereinigt u. später mit einer sogenannten Klapper (Windfege mit Sieben) gereinigt.
Der Raps verlangte einen frischen Boden in guter Kultur u. feuchtes Klima, was im Gr. Werder auch fast überall zutraf. Er wurde Mitte August mit einem, extra für diesen Zweck konstruierten sogenannten „Tonnchendriller“ in Gaben von etwa 6 kg. pro ha. ausgesät u. Ende Juli geerntet u. war eine vorzügliche Vorfrucht für Winterweizen – die Hauptfrucht des Werders. Und so war um die Mitte des 19ten Jahrhunderts der Raps die Lieblingsfrucht aller werderschen Bauern geworden.
Aber es ging wie fast immer mit solchen Neuerungen: Der Anbau wurde übertrieben und rief Rapsunkräuter u. Schädlinge auf den Plan. Zu den Unkräutern gehörte vor allen Dingen die Zaunrade oder Klebkraut genannt, zu den Schädlingen der Rapsglanzkäfer, der in dem trockenern Klima des Oberwerders – südlich der Eisenbahn Dirschau-Marienburg so verheerend auftrat, daß der Rapsbau aufgegeben werden mußte.
Der Winterraps hatte übrigens noch einige Halbbrüder: 1. den Rübsen, bei uns auch Ripper genannt, der Anfangs September ausgesät u. Anfang Juli geerntet werden konnte. Er war etwas anspruchsloser an den Boden, war auch im Preis u. Ertrag etwas geringer wie Raps u. wurde wenig im Werder angebaut.
2. gab es auch Sommerraps, der im Frühjahr ausgesät u. im Juli geerntet wurde und 3. gab es den Gelbsenf, der ähnlich, wie Raps u. Rübsen blühte, aber gelbes gröberes Korn, wie der Raps hatte, spätere Aussaat vertrug, aber ebenso, wie Rübsen u. Sommerraps zumeist nur als Lückenbüßer angebaut wurde. Alle diese Früchte waren gute Vorfrüchte für Weizen, gestatteten also schon eine bessere Abwechslung für die Halmfrucht u. boten im Mai, in der Blütezeit mit ihren weitleuchtenden gelben Flächen eine hübsche Belebung des sonst im allgemeinen etwas eintönigen Landschaftsbildes.
Inzwischen waren auch Pferde oder Schweinsbohnen u. Sommerwicken in den Anbauplan aufgenommen, wovon die Bohnen eine besonders geschätzte Vorfrucht für Winterweizen wurden u. bis etwa 1900 in großen Feldern angebaut wurden. Die Wicken waren der beste Stickstoffsammler, den wir damals besaßen, aber sie wurden doch hauptsächlich zu Grünfutterzwecken, weniger zur Samengewinnung angebaut. Sie erzeugten wegen der starken Stickstoffzufuhr leicht Lager in der nachfolgenden Halmfrucht. Auch Rotklee, Weißklee u. Schwedenklee waren bei uns heimisch geworden, was den trockneren Werderböden besonders zustatten kam, die nun im regelmässigen Wechsel durch Einsaat eines Gemisches von Rotklee, Weißklee u. Thimothen einen ein bis zweijährigen, mitunter sogar 3jährigen Weideu. Heuschlag einrichteten u. im letzten Jahr nach der Heuaberntung eine Johannibrache für Raps einführten u. die Schwarzbrache fallen ließen. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts traten dann die Göpel oder Roßwerkdreschmaschinen auf den Plan, die mit 4 Pferden betrieben wurden. Das Roßwerk stand meistens vor der Scheunentür u. war durch 2 je etwa 4 m. lange gekoppelte eiserne Stangen mit dem Dreschkasten auf der Tenne verbunden. Einige Bauern hatten auch das Roßwerk in die Scheune fest eingebaut. Es war fraglos schon eine erhebliche Erleichterung der bisherigen Flegeldruschmethode, aber die Reinigung mußte nach wie vor durch den Wind geschehen, bis dann auch bald die schon beim Rapsbau erwähnten Klappern (Windfege mit Siebwerk) konstruiert wurden, die den Bauern endlich von günstigen oder ungünstigen Winden unabhängig machten.
Diese Zeit von 1850-1880 muß aber eine gute Zeit für die Landwirtschaft gewesen sein, was man aus den erheblichen Vermögen entnehmen kann, welche die Bauern damals ihren Kindern beim Aufkauf eines Hofes mitgaben.
1871 wurde in Liessau die erste Zuckerfabrik im preußischen Osten gebaut, der sehr bald 2 Zuckerfabriken in Dirschau, je eine in Neuteich, Tiegenhof, Marienburg, Altfelde, Riesenburg, Marienwerder, Lobbowitz, Mewe, Schwetz, Pelplin, Praust u. Gr. Zünder folgten. Diese ungesunde Bauwut betrf. Zuckerfabriken, die bis auf 7 bei Ausbruch des ersten Weltkrieges verschwunden waren, hatten die Landwirtschaft ein tüchtiges Stück Geld gekostet. Aber zunächst war ein reges Leben in die Landwirtschaft gekommen u. hatte in Verbindung mit den ebenfalls seit 1875 wie Pilze aus der Erde schießenden Molkereien den Werderbauern Gelegenheit gegeben, ihre Böden zu verbessern. Etwa 1875 hatten einige unternehmende Bauern wie z.B. Janßon Tiege, Dyck Brodsack, Gerhard Wiebe Gr. Lesewitz kleine Molkereien, oft sehr behelfsmässig, eingerichtet u. von den Nachbarn Milch zugekauft. Anfänglich haben diese Bauern ihre Molkerei wohl auf eigene Rechnung betrieben. Da sie aber einen Fachmann aus Süddeutschland oder der Schweiz für den Betrieb einstellen mußten u. von dessen Ehrlichkeit abhängig waren, wobei sie oft schlechte Erfahrungen machten, so wurden aus den Molkereien bald Genossenschaften, die dann für einen bestimmten Milchpreis meistbietend verpachtet wurden. Die Hausfrauen waren nun endlich die schwere zusätzliche Arbeit der Käse u. Butterfabrikation los, wonach sich viele schon lange sehnten. Ich kann mich aber aus meiner frühesten Kinderzeit noch des Käsehändlers erinnern, wenn er zur Abnahme der Production von etwa 2-3 Wochen auf den Hof kam u. der Wiegebalken hervorgesucht wurde, mitsamt den gekennzeichneten Steinen. Eine Dezimalwage besaß Vater damals noch nicht. Der Wiegebalken wurde ganz einfach an einem passenden Baumast befestigt u. die Wage war fertig.
Als die Molkereien erst allgemein geworden waren, gingen viele Bauern daran, aus Westdeutschland besseres Vieh einzuführen u. hatten damit so große Erfolge, daß sich etwa um 1890 die ganzen Viehzüchter der Provinß Westpreußen zu einer Herdbuchgesellschaft mit dem Sitz in Danzig zusammenschlossen u. regelmässig Auktionen in Danzig abhielten. Diese Zuchtrichtung bestand aus schwarz-weißen Ostfriesen, holländischer Abstammung.
Es waren auch rotbraune Holsteiner Kühe von Gerhard Wiebe Gr. Lesewitz eingeführt worden u. hatten in seiner Verwandtschaft viel Beifall u. Nachzucht gefunden. Es waren gut geformte leichtfuttrige Tiere von der gleichen Milchergiebigkeit, wie die Ostfriesen, aber sie waren nicht der Geschmack der Mehrheit u. so mußten sie weichen. Etwa 1910 nach dem Tode seines Vaters Gerhard Wiebe stellte sein Sohn Rudolf sich ebenfalls auf Schwarz-weiß um.
Erstaunlich war es, wie schnell sich nach Gründung der Molkereigesellschaften der größere Grundbesitz des Werders von der Mastviehhaltung auf die Kuhhaltung umstelltenu. manchen tüchtigen Züchter aus ihren Reihen gestellthaben. Auch die Höhenkreise Westpreußens waren an diesem Aufschwung in der Rinderzucht beteiligt, aber das Zentrum blieben immer die Weichselniederungen.
Auch die Pferde u. Schweinezucht wurde eifrig betrieben. Bis zur Einführung des Zuckerrübenbaues beruhte die Pferdezucht im Gr. Werder auf Tieren ostpreußischer – Trakehner – Abstammung u. bis zur Beendigung des ersten Weltkrieges veranstaltete die Militärverwaltung regelmäßig Remontenmärkte im Kreise. Aber die schwere Arbeit des Rübenbaues u. besonders der Rübenabfuhr forderte doch gebieterisch die Zucht eines stärkeren u. ruhigeren Pferdes u. so war in zahlreichen Höfen ein Mischblut von Ostpreußen u. Belgiern rheinischer Abstammung zu finden. Auch die beiden Richtungen der Pferdezucht hatten ihre Stutbuch Gesellschaften.
Die Schweinezucht war der Herdbuch Gesellschaft angeschlossen.
Zugleich mit der Entstehung der Zuckerfabriken kamen auch die ersten Dampfdreschmaschinen mit voller Reinigung ins Land, sowie 2 Dampfpflugsätze, welche von der Liessauer Dampfpfluggesellschaft erworben wurden. Nun war man in Kreisen der Bauern u. auch Städter soweit, daß man glaubte, weiter ginge es nun nicht mehr. Die Garben wurden oben eingeworfen u. unten lief das sauber gereinigte Getreide in die Säcke. Die Dampfdreschsätze führten sich schnell ein. Es dauerte allerdings wohl noch etwa 30 Jahre, bis jeder Bauer von mehr als 100 ha einen eigenen Dreschsatz besaß; aber es waren doch soviel Dreschsätze im Kreise, die auf Lohn droschen, daß noch kaum ein Bauer nach 1880 mit dem Roßwerk gedroschen hat. Der Flegeldrusch, ab u. zu ausgeführt, hauptsächlich wohl zur Gewinnung von Richtstroh zur Ausbesserung von Strohdächern, soweit noch welche vorhanden waren. Weniger führten sich die Dampfpflüge ein. Sie beschränkten ihre Arbeit mehr auf die Felder der Gesellschaftsmitglieder. Es war auch immerhin eine erhebliche Ausgabe, wenn man 20 Mark pro culm. Morgen bezahlen u. noch die benötigten Kohlen liefern mußte u. zusätzlich 1 vierspänniges Gespann mit Führer zum Wasserfahren sowie einen Mann am Pflug. Es hatten sich zwar um 1890 noch 3 Gesellschaften gebildet. Aber, sei es, daß die Maschinen zu schwach gekauft waren, die den Pflug nicht in der gewünschten Tiefe zwangen,oder waren es andere Umstände, die Gesellschaften gingen alle ein. Bestehen blieb blos ein Privatunternehmen von Jahn Damerau u. seinem, im Kreise Rastenburg wohnenden Bruder, die beide große Besitzungen hatten u. sich solch teuren Apparat leisten konnten, den sie auch, wenn er frei war, an Nachbarn ausliehen.
Nun standen wir also von 1830 an im Zeichen des Zuckerrübenbaues u. sind bis zu unserer Flucht 1945 nicht mehr von ihm losgekommen. Einige Bauern weigerten sich allerdings standhaft u. begannen garnicht mit dem Anbau. Andere schleppten sich jahrelang mit schlechten Erträgen hin u. gaben dann das Rennen auf, und dann gab es auch eine Anzahl, die trotz dauernd schlechter Erträge nicht von dem Rübenbau liessen. Diese kamen am schlechtesten weg, denn der Rübenbau war nur viele Jahre lang rentabel, wenn er hohe Erträge abwarf. Mit ganz gemeinen [?] Preisen von 75 Pf. bis zu 1.00 M pro Centner haben wir uns durch die lange Zeit von 1880 bis zum ersten Weltkrieg durchgeschleppt. Erst nach dem ersten Weltkrieg bekamen wir einigermassen den Preis für die Rüben, der den Anbau lohnend machte, und die Berechtigung von der Fabrikleitung, durch unsere Vertrauensleute das verwiegen u. Probeputzen zu überwachen, was unsern ha. Erträgen sehr zustatten kam. Etwa 20 Jahre lang hat die Zuckerfabrik Liessau auch Rübensamenzucht auf ihrem Gut in Liessau getrieben. Aber dann gab man das Wettrennen mit den sächsischen Züchtern auf u. nahmen aber, bald nach dem ersten Weltkrieg, den Vermehrungsbau von Zuckerrübensamen für sächsische Züchtereien in größerem Umfang wieder auf. Der Rübensamen ist eine graue unscheinbare Frucht, aber er strömt in der Blütezeit einen berückend honigsüßen Duft aus, der den Duft von frischem Heu u. blühendem Rotklee oder Pferdebohnen noch übertrifft. In diesen Tagen u. Wochen kann man auch bei uns sagen: „Wo in Düften schwelgt die Nacht“! [Rheinlied – Strömt herbei, ihr Völkerscharen]
Um dem geneigten Leser ein wenig die Gründe für den vielfach geringen Erfolg beim Rübenbau zu erläutern, muß gesagt werden, daß die Rüben zunächst eine tiefe Pferdefurche (30 cm.) verlangen, welche mit Gespannen, besonders auf schwerem Werderboden, kaum zu erreichen war. Dann mußte der Boden möglichst unkrautfrei sein; besonders Queken sind der Rübe größter Feind, neben Wildhafer u. Hederich. Auch leidet die Rübe sehr darunter, wenn sie vom Unkraut überschattet oder zu spät verzogen wird und der größte Fehler war es, wenn man im Gr. Werder die Rüben auf ungekalkten Boden bringt. Zwar ein oder zweimal läßt sich die Rübe das gefallen, aber dann leiden die Rüben unter Wurzelbrand, der sofort verschwindet, wenn genügend Kalk im Boden ist. Aber das Kalken war teuer u. machte erhebliche Arbeit u. Beides scheute der Werdersche Bauer oft u. nahm lieber dauernd schlechte Erträge hin. Einen andern Feind hatte die Rübe noch, das war die Rübennematode, die sich bei übertriebenem Rübenbau einfindet u. die Verkurstung der milderen Böden. Damit hatten wir in den letzten 20 Jahren nicht mehr zu kämpfen, nachdem die sogenannten Meißeleggenbei uns eingeführt waren, mit denen man die Rüben ein bis zweimal vor dem auflaufen, besonders aber nach jedem Regen abeggte, so daß es garnicht zur Kurstenbildung kommen konnte.
Unter den Winterhalmfrüchten beherrschte der Quadendorfer Weißweizen bis etwa 1890 das Feld. Er war nicht sonderlich lagerfest, gab aber mittelgute Erträge. Später wurde oft gewechselt, sobald sich eine neue Sorte überlegen zeigte. Zuletzt waren wir bei K[C]arstens Dickkopf Nr. 5 angelangt. Roggen wurde im Werder fast nur zum eigenen Bedarf angebaut u. zwar hauptsächlich Petkuser. Gerste wurde Heines Hanna, Heils Frankengerste u. Ackermanns Isaria, doch auch viele andere Sorten angebaut. An Hafer wurde auch oft gewechselt. Ich erinnere mich an Svalö[v]fs Siegeshafer, Lochows Gelbhafer, Bensings Fahnenhafer u. viele andere Sorten wurden angebaut. Die Erträge schwankten zwischen 60 u. 90 Ctr. pr. ha., ausnahmsweise darüber oder darunter. Die Zuckerrübenerträge lagen bei mir im Durchschnitt der letzten 20 Jahre bei 720 Ctr., Kartoffeln u. Futterrüben wurden auch hauptsächlich zum eigenen Bedarf angebaut. Die Erträge u. besonders die Preise waren im Laufe der Jahre von 1895 bis zum ersten Weltkrieg langsam angestiegen. Weizen war von 6 bis auf 10 .00 M. pr. Ctr., Roggen von 5.00 M. auf 8.00 M., Gerste von 5.00 M auf 9.00 M. u. Hafer auch von 5 auf 9.00 M angestiegen u. die Milch pro Liter von 7 auf 10 Pf., Schweine von 30 auf 50.00 M pr Ctr u. Rindvieh von 25.00 M auf 40 M. Ein gutes 3jähriges Remontepferd brachte bis 1000 M, eine gute Milchkuh bis 600 Mark im freien Handel; auf den Herdbuch Auktionen auch oft auf 800 M. und die jungen einjährigen Zuchtbullen brachten etwa 1000 M. Durch die Herdbuch Auktionen wurden die Preise im allgemeinen wesentlich erhöht. Aber auch der Handel zahlte Preise, daß man dabei bestehen konnte. Daher versuchte man es vor dem ersten Weltkrieg kaum, neue Früchte in den Anbau aufzunehmen. Als dann der Krieg beendet u. wir Werderaner vom deutschen Vaterlande abgetrennt u. dem Freistaat Danzig einverleibt waren, regte sich auch in der Landwirtschaft oft ein kräftiger Aufbauwille, in dem wir von unserm alten Vaterlande sehr unterstützt wurden. Auch die deutschen Bauern im abgetretenen Westpreußen u. Posen wurden von Deutschland nach Kräften gefördert, um sie auf ihrem Grund u. Boden zu erhalten. Die Verbände aller Art, die durch die Verteilung Westpreußens an Danzig, Deutschland u. Polen in 3 Teile zerrissen waren, mußten neu gegründet werden. Neue kamen hinzu. Danzig war mit Deutschland im gemeinsamen Währungsverband geblieben u. als der Währungsverfall in Deutschland einsetzte, machten wir alle Phasen dieses Verfalls mit, bis wir Danziger uns von der deutschen Mark lösten u. den Danziger Gulden schufen, der an das englische Pfund gebunden war. In dem letzten Inflationsjahr 1923 wurde schon weitgehend nach Pfd. oder U.S.A. Doll. gehandelt. Dieser allmähliche Währungsverfall hatte schon 1920 oder 21 zur Gründung des Rübenbauvereines geführt und der Zuckerrübenpreis wurde nun alljährlich zwischen den Zuckerfabriken u. dem neuen Verband ausgehandelt. Das gab viel Streit u. führte 1922 zum Rübenanbaustreik. Nun wurde nach Ersatz für den fehlenden oder wenigstens sehr eingeschränkten Rübenbau gesucht u. dabei kamen einige Bauern auf den Gedanken, Cichorien anzubauen, wozu auch ich gehörte. Die Cichorie, die zur Fabrikation des bekannten Kaffee-Ersatzes gebraucht wurde, war damals in der Provinz Posen, besonders auf den guten Böden Cujawiens gerne angebaut u. auch auf den großen Gütern in eigenen Fabriken verarbeitet. Es war dieses für die dortige Landwirtschaft eine Notwendigkeit, weil sie sich den guten Zuckerrübenboden durch übermäßigen Rübenanbau stark mit Nematoden verseucht hatte u. nun die Cichorie als Gegenmittel gegen die Nematoden und als Vorfrucht für Zuckerrüben anbaute.
Wir versuchten es also einige Jahre mit der Cichorie, gaben ihren Anbau aber sofort wieder auf, als wir mit den Fabriken Frieden geschlossen hatten. Die Cichorie hatte zudem eine lästige Auswirkung bei ihrem Anbau. Jedes kleinste Stückchen Wurzel, das im Boden blieb, trieb im nächsten Frühjahr unfehlbar wieder aus u. mußte sorgfältig entfernt werden, wenn man sich nicht ein neues Unkraut heranziehen wollte. Wir haben nachher in Frieden mit den Zuckerfabriken gelebt und den Rübenbau auch, trotz der vielen eingegangenen Fabriken, nicht einschränken dürfen. Die noch vorhandenen Fabriken waren so groß ausgebaut, daß sie die ganze Produktion meist bis Weihnachten verarbeitet hatten. Die uns am nächsten gelegene Fabrik Neuteich hatte z.B. bei Aufnahme ihrer Arbeit im Jahre 1878 =6000 Ctr in 24 Std verarbeitet u. im Jahre 1930=30000 Ctr.
In den Jahren des nationalsozialistischen Regims fanden keine Verhandlungen zwischen Fabriken u. Rübenbauern mehr statt, sondern die Machthaber diktierten den Fabriken den Anteil am Gewinn, den sie den Rübenbauern zu zahlen hatten. Die Rübenbauern kamen nicht schlecht dabei weg. Im Jahre 1920 wurde der erste landw. Versuchsring in Liessau gegründet u. als Versuchsringleiter der junge Diplomlandwirt Emil Wiebe angestellt. Die hauptsächlichste Triebkraft für diesen Verein war Ernst Penner Liessau, auf dessen Feldern auch die meisten Versuche angestellt wurden. Diese Versuche befaßten sich hauptsächlich mit Düngungs u. Sortenversuchen, aber auch auf Feststellung des Kalkbestandes im Boden u. auf Einwirkung mechanischer Arbeiten, wie verschiedener Furchentiefen u. der Hackarbeit auf den Ertrag bei Hackfrüchten u. Halmfrüchten. Die Lehren, die wir daraus für uns ziehen konnten, waren uns sehr wertvoll, besonders, weil man sich unbedingt auf sie verlassen konnte. Der Verein hat etwa 10 Jahre bestanden u. ging, wie auch die zahlreichen landwirtschaftlichen Vereine, erst zur nationalsozialistischen Zeit ein. Von da an bekam man alle diesbezüglichen Anregungen von der „Partei“. In dieser Zeit begannen viele Bauern auch von sich aus nach neuen Früchten zu suchen u. so begann etwa 1923 fast gleichzeitig der Anbau von blauem Schließmohn u. weißen Victoria Erbsen. Sie haben 10-15 Jahre das Landschaftsbild des großen Werders beherrscht u. boten dem Bauern neben guten Erträgen u. guten Preisen auch zu der Blütezeit ein landschaftlich schönes Bild. Nun war es im großen Werder garnicht mehr farblos. Im Mai blühte nach wie vor der Raps goldgelb, im Juni die Erbse mit ihrem zartgelbweißen Blütenmeer u. im Juli der mannshohe Mohn mit seinen lilaweißen großen Blüten, die manchem fremden nächtlich Durchreisenden eine große Wasserfläche vortäuschten. Der ebenfalls zu dieser Zeit eingeführte Rübensamenbau brachte dann noch den honigsüßen Duft ins Land.
Aber die Herrlichkeit dauerte nur 10-15 Jahre, da fanden sich, durch übermäßigen Anbau stark gefährdet, Krankheiten u. Schädlinge, die den Anbau von Mohn u. Victoria Erbsen unmöglich machten. Bei dem Mohn war es ein Schädling, der sich an den Wurzeln ansiedelte u. den Mohn bei Beginn der Blüte zum umfallen brachte u. bei den Erbsen der Kohlweisling, der seine Eier in die Erbsenblüte legte u. viel Wurmfraß erzeugte u. die Brennflecken Krankheit, die ein vorzeitiges Absterben der Erbse zur Folge hatte. Schade um die beiden schönen Früchte, die ebenso, wie Rübensamen eine gute Vorfrucht für Weizen waren, dessen Anbau natürlich auf Kosten der andern Halmfrüchte erheblich ausgedehnt wurde. Unterdesssen, waren ab 1910 die sandigen Böden in den Dörfern an Weichsel u. Nogat, die einmal, oft vor Jahrhunderten, durch Deichbrüche versandet waren, zumeist in Kultur gebracht worden u. gaben gute Erträge an Roggen u. Kartoffeln. Diese Kultur wurde noch durch Einführung des Süßlupinenbaues bemerkenswert gefördert, die auf allen Sandböden herrlich wuchs u. gelb blühte. Auch Mais, der etwa 1923 eingeführt wurde, konnte auf den besseren Sandböden mit gutem Erfolg angebaut werden. Er störte allerdings erheblich in der Rübenerndte, denn er war in der Regel erst Anfang Oktober reif. Er brachte gute Erträge (bis 100 Ctr pr ha.) u. Preise, wie Futtergetreide, aber in der Zeit des 2. Weltkrieges mußte er stark im Anbau eingeschränkt werden, weil die Preise für alle Früchte, die man aus dem eroberten Polen u. später auch einige Jahre aus Rußland einführen konnte, zu Gunsten der Preise für Hackfrüchte aller Art, besonders Gemüse, niedrig gehalten wurden. Bei Beginn der nationalsozialistischen Zeit wurde dem Öllein, den wir als Lückenbüßer schon früher ab u. zu angebaut hatten, größere Aufmerksamkeit gewidmet. Er konnte im Gegensatz zum Faserlein, mit der Maschine gemäht werden u. da das Stroh mit 5 M. pr Ctr. bezahlt wurde, brachte er eine gute Einnahme u. war außerdem eine gute Vorfrucht für Winterweizen, die uns durch den Ausfall von Mohn u. Erbsen, sehr willkommen war.
Seit der Zeit, als wir den Mohn- u. Erbsenbau aufgeben mußten, waren eine ganze Anzahl neuer Früchte in den Anbauplan aufgenommen worden. Ich nenne da den Anbau von Spinatsamen, von Kümmel, Mohrrübensamen, Futterrübensamen, Grassamen (Thimothee u. Wiesenschwingel) u. während des Krieges Mohrrüben, frühen u. späten Weißkohl, Pflückerbsen, Rot u. Weißkleesamen, rote Beeten und manches andere, das mir aus dem Gedächtnis entschwunden ist u. auch nur vereinzelt angebaut wurde. Es ist ein fast verwirrend buntes Bild, das ich dem geneigten Leser vorgeführt habe.
Als Nebenerwerb bestanden in der Mitte des vorigen Jahrhunderts noch viele Windmühlen, die z.T. zu einem Bauernhof gehörten, aber auch den Haupterwerb des Besitzers neben einer kleinen Landwirtschaft bildeten. Sie sind fast alle eingegangen oder wenigstens mit einer Lokomobile versehen worden, die sie vom Winde unabhängig machte. Als neuerliche Ausnutzung des Windes waren um die Jahrhundertwende mehrfach Windmotore neben den Stall gestellt, die das Wasserpumpen u. das schroten u. Häckselmachen besorgen sollten. Sie verschwanden aber meist, als die Elektrizität bei uns eingeführt wurde. Das war im Jahre 1924, als die 5 Bauern des Dorfes Liessau einmütig beschlossen, elektr. Strom von dem Elektrizitätswerk Dirschau zu beziehen u. in Verhandlungen mit der Stadt Dirschau, die damals schon polnisch geworden war u. „T[c]zew“ hieß, einzutreten. T[c]zew erklärte sich auch sofort zur Stromlieferung bereit, wenn wir alle Baukosten bis an das Elektrizitätswerk übernehmen würden. Das überstieg unsere Leistungsfähigkeit denn doch u. machte die Aufnahme eines Darlehns von 60000 Mark notwendig. Die Einrichtung auf seinem Hof mußte jeder für sich und nach seinem Geschmack ausführen lassen. Einen großen Teil der Baukosten verschlang der Ankauf des über 1000 m langen Kabels über die Weichselbrücke u. noch etwa 500 m Kabel von der Brücke bis zum Elektrizitätswerk, etwa 35000 Mark und der Bau der Hochspannungsleitung bis an die Transformatoren.
Nach etwa 4 Jahren baute die Staatsregierung Danzig dann allmählig für das ganze Werder Elektrizitätsleitungen aus u. übernahm von uns die Liessauer Ortsleitung u. auch das Darlehn von 60000 Mark u. führte die Leitung über das Werder bis Danzig durch und versorgte fast alle Dörfer u. Einzelhöfe mit Strom, der nun größtenteils von dem Ostpreußenwerk geliefert wurde. Als am 1. September 1939 die Brücken bei Dirschau von den Polen gesprengt wurden, machte sich diese Maßnahme für uns günstig bemerkbar.
Dann gab es noch eine Anzahl kleinere Ziegeleien im Kreise, die durch Neubauten in den 80ziger Jahren noch um einige vermehrt wurden, aber nach 20-30jährigem Bestehen fast alle wieder abgebrochen wurden. Die Konkurrenz der Haffziegeleien, die mit billiger Wasserkraft ihre Produktion bis Neuteich bringen konnten, war zu groß.
In den beiden kleinen Städtchen Tiegenhof u. Neuteich regte sich auch der Unternehmergeist. In Neuteich spielte die Zuckerfabrik die Hauptrolle u. der Getreide und Düngemittelhandel eine erhebliche Rolle. Auch war es nun zum Treffpunkt der Landwirte des oberen Werders u. ihrer geselligen Zusammenkünfte geworden, nachdem unsere alte Kreisstadt Marienburg Ausland für uns geworden war. Zwei Bankgeschäfte u. eine Anzahl Kaufläden u. Gasthäuser aller Art, sowie Handwerksunternehmen rundeten das Bild ab.
Tiegenhof war ähnlich ausgestattet, hatte aber seine Zuckerfabrik längst wieder abgebrochen. Dafür war der Schiffsverkehr nach Elbing, Königsberg u. Danzig rege, auch bestanden neben der weltberühmten Machandelfabrik von Stobbe ein Mühlewerk, eine Oberschule und schier unzählige Kneipen.
Das gesellschaftliche Leben des Oberwerders spielte sich viele Jahre in der Ressource in Neuteich ab, bis die Nationalsozialisten auch diesem Verein ein Ende bereiteten.
Die Zuckerrübensamenzucht Delitzsch in Sachsen, mit der wir Samenanbauer aus Liessau und Umgegend in angenehmer Geschäftsverbindung standen, hatte in Liessau eine Abnahmestelle u. eine Rübensamentrocknungsanlage eingerichtet, die wir im Bedarfsfalle auch zur Trocknung von naß geerntetem Getreide u. besonders zur Trocknung von Körnermais benutzen durften. Wir hatten in Liessau zwar fast alle Spezialscheunen zur Maistrocknung gebaut, wo der Mais aber bis zum Frühjahr liegen bleiben mußte. Wer seinen Mais, etwa zu Futterzwecken, früher brauchte, ließ ihn in der Trocknerei trocknen. Um den Rübensamen versandfertig machen zu können, mußten wir eine Entstoppelungsmaschine anschaffen. Das waren z. T. von heimischen Tischlern gefertigte Gestelle von etwa 1 m. breite, die in verschiedener Höhenlage in einer etwa 75 cm. großen Entfernung voneinander 2 Holzrollen besaßen, über die eine Leinwand endlos abrollte. Oben war ein möglichst großer Behälter zur Aufnahme des soweit gereinigten Rübensamens. Die feinen Stoppelteilchen konnten nur auf diese Weise entfernt werden. Das war keine schwere Arbeit, sie konnte von einem Mädchen oder einem alten Mann bequem geleistet werden, aber sie schaffte sehr wenig u. als uns die Samenzucht Delitzsch den Samen auch ungestoppelt, sogar ganz ungereinigt abnahm, verzichteten viele Samenbauer auf Reinigung und event. auf Trocknung u. liessen sich lieber die entsprechenden Abzüge gefallen.
Abgesehen vom Rübensamen-Versuchsbau, den wir alle gleichmässig betrieben, wurde auch von Ernst Penner Liessau in gleicher Weise Vermehrungsbau in andern Fruchtarten (Weizen, Erbsen, Gerste u.s.w.) betrieben. Wir andern Bauern hatten das Wettrennen weitgehend aufgegeben u. bauten nur zugekaufte Originalsaat an, die im ersten Anbau auch noch anerkannt wurde, aber nicht mehr dem Zwang zur Ablieferung an den Züchter unterlag. Wir verkauften zwar etwas billiger, wie Penner, wurden aber unsern Anbau fast immer zu etwas erhöhten Preisen gut los.
Kap. IV
Bauten.
Bei dem Kapitel „Bauten“ muß ich zuerst des Hochmeisterschlosses des deutschen Ritterordens in Marienburg gedenken.
Marienburg liegt zwar auf der anderen Seite der Nogat u. gehörte also in den letzten 25 Jahren nicht mehr zum Kreise Gr. Werder. Da es aber seit seiner Gründung um 1250 bis 1920 unsere Kreisstadt gewesen ist, erscheint mir ein kurzer Abriß der Geschichte von Stadt u. Burg „Marienburg“ gerechtfertigt. Als der Orden um die Mitte des 13ten Jahrhunderts im Preußenlande festen Fuß gefaßt hatte, suchte er nach einer passenden Stelle, wo er sein Haupthaus, wie er es bescheiden nannte, hinsetzenkonnte. Die Wahl fiel auf das hohe Ufer an der östlichen Seite der Nogat, kurz bevor das Gelände zu der rechtseitigen Nogatniederung abfiel. Aus dem Ordenshaupthaus wurde eine so gewaltige Burganlage, wie sie in Deutschland nicht mehr zu finden war. Man sagt, die alte Papstburg in Avignon in Südfrankreich soll der Marienburg ähnlich sein. Der Beginn der Ordensherrschaft in Preußen fiel allerdings in die Zeit, als die Päpste durch 1 ½ Jahrhunderte in Avignon residierten u. viel Verbindung mit dem Orden hatten. Diese vielfache Berührung könnte auch auf den Bau der neuen Burg eingewirkt haben. 1309 war der Bau der neuen Burg soweit fertig, daß der Hochmeister seinen Sitz von Venedig nach der Marienburg verlegen konnte. Damit begann die Zeit der höchsten Blüte des Ordens. Unter dem Hochmeister Winrich von Knipprode 1350-82 wurde der Hochmeisterpalast, etwas abseits des Hochschlosses, u. der große Remter gebaut. Wer diese wundervollen Spitzbogenwölbungen im großen Remter, die gleichen Bogen im Sommerremter, die hier auf einem einzigen Pfeiler ruhten, während der große Remter 3 Pfeiler benötigte, oder wer die entzückenden logienartigen Umgänge im Hof des Hochschlosses u. die St. Annenkapelle, unter der sich die Gruft der Hochmeister befand, auf sich wirken ließ, der wird die Marienburg so leicht nicht mehr vergessen. Aber der Orden hatte seine Aufgabe erfüllt. 1410 verlor er die Schlacht von Tannenberg gegen die Polen. Der Komthur von Schwetz, Heinrich v. Plauen rettete zwar die Marienburg durch seine Tatkraft, aber im Orden selbst war vieles faul geworden. So kam ihm nicht nur aus seinen eigenen Reihen, sondern von seinen eigenen Städten u. eigenen Adligen das Verderben. Von der Belagerung der Marienburg mußten die Polen zwar, ohne ihr Ziel erreicht zu haben, abziehen, auch hatte der Orden an Landbesitz kaum etwas eingebüßt, aber jede Reorganisation blieb aus und der lange Krieg zwischen dem Orden u. den von der Ritterschaft unterstützten Städten machte der Ordensherrschaft weitgehend ein Ende. Söldnertruppen zogen in die stolze Marienburg ein u. übergaben, als sie ihren Sold nicht bekamen, die Burg an die Polen. Der Orden wurde auf das spätere Ostpreußen beschränkt, das er auch nur noch von Polen zu Lehen erhielt u. nahm seinen Sitz in Königsberg. Über die gänzlich unzerstörte Burg senkten sich Jahrhunderte des Schweigens. Erst 400 Jahre später, um die Mitte des 19ten Jahrhunderts, erinnerten sich einige Romantiker, darunter auch Max v. Schenkendorf der Burg im Osten. Man brachte wenigstens wieder Dächer auf die, nur durch Witterungseinflüsse beschädigten Gebäude. Aber erst um 1880 begann man mit einer planmäßigen Restaurierung der Burg, die durch eine alljährliche Schloßbaulotterie u. Zuschüße der preußischen Regierung finanziert wurde. Zwei Schloßbaumeister – Steinbrecht u. Schmidt haben ihre Lebensaufgabe darin gefunden. Den ersteren nahm ein gnädiges Geschick aus der Mitte seiner Arbeit hinweg, der letztere mußte die Vernichtung seines Lebenswerkes noch überleben u. ist erst vor einigen Jahren in Schleswig-Holstein gestorben.
Hier sei auch mit einigen Worten unserer lieben alten Kreisstadt Marienburg gedacht. Sie wurde vom Orden wohl gleichzeitig mit dem Bau der Burg angelegt. Die Stadt grenzte unmittelbar an den etwa 30 m. breiten Schloßgraben, der die Burg von 3 Seiten umgab. Die vierte Seite wurde bei Burg u. Stadt von der Nogat geschützt. Die Stadt zog sich, südlich der Burg, etwa 400 m. lang an der Nogat hin u. hatte, nach den noch vorhandenen Stadtmauern zu schließen, eine Breite von 200-300 m. In der Mitte, parallel mit der Nogat, zog sich die einzige Haupt oder Marktstrasse, etwa 30 m. breit, hin, die an beiden Seiten in vollkommen geschlossener Weise von 2-3stöckigen Laubenhäusern begrenßt war. Zu beiden Seiten der Marktstrasse, auch parallel mit ihr, zog sich je eine Speicherstr. hin, deren Gebäude an der einen Speicherstr. hart an die Nogat grenßten. Die Lauben wurden an der einen Seite hohe Lauben, an der andern Seite niedere Lauben genannt. Das hatte mit der Höhe der Gebäude aber nichts zu tun, sondern bezog sich auf das Terrain, das an der einen Seite der Marktstrasse etwa 2 m. höher lag, wie an der andern Seite. Ende des 19ten Jahrhunderts brannten bei einem großen Schadenfeuer etwa 10-20 dieser Häuser nieder, wurden aber im alten Styl wieder aufgebaut. Und so blieb das einzig schöne Stadtbild, das in Deutschland, meines Wissens, nur noch in Hirschberg in Schlesien ein ähnliches Gegenstück hat, erhalten bis zu unserer Flucht.
Von den Gebäuden im Gr. Werder waren die vielen alten kath. Kirchen am bemerkenswertesten. Sie hatten die vielen Jahrhunderte ohne sonderlichen Schaden überstanden. Schlechter hatten sich die meisten evangelischen Kirchen gehalten. Sie waren durchweg von Fachwerk u. ohne Turm gebaut, der ihnen vielfach erst im 19ten Jahrhundert, unter preußischer Herrschaft angebaut wurde. Einige waren auch so schlecht gebaut, daß sie im 19ten Jahrhundert abgerissen u. neu gebaut wurden. Jetzt aber massiv und mit Turm. Die 8-10 Mennonitenkirchen, die ausschließlich aus Holz gebaut waren u. immer außerhalb der geschlossenen Dörfer standen, bedurften auch schon oft eines Neubaus, der durch unsere Vertreibung jetzt überflüssig geworden ist.
Wenn man die alten Vorlaubenhäuser in den 3 Werdern (großer u. kleiner Marienburger Werder u. Danziger Werder) ansieht, dann überlegt man wohl, woher dieser eigenartige Baustyl gekommen ist. Auf einigen alten Zeichnungen aus dem 17ten Jahrhundert von Gr. Lichtenau u. Gr. Mausdorf findet man schon die Vorlaubenhäuser. Aber es waren andere Formen, als man heute, noch in sehr schöner Ausführung u. gut erhalten, sehen kann. Einige Exemplare der ersten Vorlaubenhäuser gibt es allerdings auch, aber sie sind durch Neubauten u. Anbauten so verändert, daß man den alten ursprünglichen Baustyl kaum noch feststellen kann. Auf den oben erwähnten Zeichnungen besteht der ganze Bauernhof nur aus einem großen Gebäude, wie etwa heute noch in Niedersachsen. Aber, während die Gebäude in Niedersachsen mit der Einfahrt nach der Straße stehen, ist es mit den frühesten Werderhäusern umgekehrt. Sie stehen mit dem Wohnteil nach der Strasse. Der Giebel des Hauses ruht auf 6-8 Holzpfeilern, der untere Teil des Hauses ist auf eine Breite von crc. 4 m. bis Stubenhöhe freigelassen, so daß man darunter mit Wagen vorfahren u. durchfahren kann. Auch wird der Teil des Wohnhauses über der Vorlaube als Speicherraum benutzt worden sein und das verladen von gefüllten Getreidesäcken durch eine Luke auf den darunter stehenden Wagen wäre sehr einfach. Da das Einfahren des Getreides etc. vom Hofgiebel aus vorgenommen wird, können die Höfe nahe beieinander stehen. Das ergibt auch die vorerwähnte Zeichnung. Ich erwähnte schon, daß einige dieser Bauten noch auf unsere Zeit gekommen sind. An ihnen kann man mit einiger Phantasie noch feststellen, wie dem Bauern sein enger Raum zu klein geworden ist u. er nach der einen u. bald nach beiden Seiten Anbauten in gleicher Höhe des bisherigen Hauses im rechten Winkel vorgenommen hat, u. da ist dann plötzlich aus dem Hause, das mit dem Giebel nach der Straße stand, ein Haus geworden, das mit der Langseite nach der Straße steht. Da man inzwischen auch dem einen oder andern Nachbar seinen Hof abgekauft haben wird, um sich mehr Raum zu schaffen u. der Viehstapel größer geworden ist, so kommt man auf den Gedanken, das Vieh in einem gesonderten Stall u. das Getreide in einer Scheune unterzubringen, und da auch ein Getreidespeicher da sein muß, ist die quadratische Form des Bauernhofes zur Zeit der Freiheitskriege geschaffen. Etwa um 1700 ist dann die erste Vorlaubenform der Bauernhäuser aufgegeben u. einheitlich das Vorlaubenhaus gebaut, das wir noch alle kennen u. das in seinem Vorlaubengiebel oft künstlerische Formen u. Maßwerk aufweisen u. das noch heute die Kenner bäuerlicher Baukunst zu dem harten Urteil veranlaßt: „Diese Bauform wäre das einzig Richtige für uns und was nachdem gebaut sei, wäre Schund u. nicht der Erwähnung wert.“ Im Jahre 1878 kaufte mein späterer Schwager Bernhard Penner in Irrgang einen Hof mit einem baufälligen Vorlaubenhaus aus der ersten Vorlaubenzeit, wo der Giebel nach der Straße gekehrt war. Es zeigte als besondere Eigenart eine Empfangshalle, die durch 2 Stockwerke reichte u. in halber Höhe einen Umgang um die ganze Halle aufwies, von dem aus die andern oberen Räume zugänglich waren. Das Haus wurde schon nach einem Jahr abgebrochen, um einem Neubau Platz zu machen. Der Stirnbalken des alten Hauses war so gut erhalten, daß er an gut sichtbarer Stelle für den Dachstuhl verwendet werden konnte. Er trug folgende, aus dem Holz ausgemeißelte Inschrift in etwa 20 cm. hohen Buchstaben:
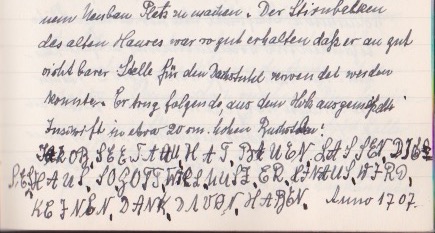
Es entwickelte sich nun im 18ten Jahrhundert die Form des Viereckhofes, wo die Gebäude alle allein standen; das Wohnhaus so nahe an der Straße, daß man bequem unter der Vorlaube an der vorderen Haustür vorfahren konnte. Man trat etwa 2 Stufen höher in das sogenannte Vorhaus, auf welches das Küchenfenster aus der sonst dunklen Küche in der Mitte des Hauses schaute. Dann war rechts ein großes Zimmer, die große Stube u. links ein kleines Zimmer, die Sommerstube. Das Vorhaus war vom Hinterhaus durch eine Wand getrennt. Vom Hinterhaus waren nach einer Seite der Zugang zur Küche u. zu der Gesindestube mit angrenzender Wohnstube u. Schlafstube. An der andern Seite befanden sich Mädchenzimmer u. Speisekammer. Im Dachgeschoß waren noch 2-3 Zimmer. Die Vorlaube war jetzt im rechten Winkel an die Mitte des Hauses angebaut u. stand nun doch wieder mit dem dritten Giebel nach der Strasse. Dieser Giebel war oft besonders reich verziert. Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurden die letzten Vorlaubenhäuser gebaut.




aus dem Internet: “Das Land des Deutschen Orden“: Vorlaubenhäuser bei Tiegenhof; Marienau; Tiege]
Dann suchte man nach einem neuen Baustyl, der mehr Licht u. Luft in die Gebäude u. vor allen Dingen die dunkle Küche beseitigen sollte. Die Wohnhäuser wurden bis etwa 1900 noch fast allgemein aus starken 15 cm. starken Kiefernbohlen gebaut, hatten zwar keine Vorlaube mehr, standen aber auf ein meter hohen Fundamenten, die bessere gewölbte Keller zu bauen gestatteten. Auch war meistens ein Drempel von 1.00 m Höhe in etwas schwächerer Ausführung auf die Außenwand des Hauses aufgereckt u. die Häuser durchweg mit verschaltem Pfannendach versehen. Diese Einrichtungen schafften mehr Raum in Keller u. Obergeschoß u. mehr Licht im Hause, das oft recht gefehlt hatte, besonders in der dunklen Küche. In der Regel besaßen die Häuser auch einen Erker an der Stelle, wo vorhin die Vorlaube angebaut war, und unter demselben eine offene oder geschlossene Veranda, die im Sommer ein beliebter Aufenthalt für die Familie, besonders in Feierabendstunden u. an Feiertagen, war. Es gab manch stattliches Haus unter diesen neuen Bauernhäusern u. wir wohnten gerne darin u. fühlten uns wohl. Mag sein, daß die alten Vorlaubenhäuser besser in unser Landschaftsbild paßten; jedenfalls waren sie schön anzuschauen, aber dazu waren noch genug da, die vereinzelt sogar unter Denkmalschutz standen u. nicht abgebrochen werden durften. Ich habe mich auf meinen vielen Reisen durch ganz Deutschland oft umgeschaut, ob ich eine Gegend entdecken könnte, aus der dieser eigenartige Baustyl stammen könnte, aber ich habe solche Gegend nicht gefunden. Es mußte also doch wohl eine bodenständige Entwickelung dieser Baukunst durch heimatliche Baumeister gewesen sein.
Ein anderer Baustyl hatte sich im kleineren Grundbesitz, namentlich in der Niederung entwickelt. Er wurde fraglos von den eingewanderten Holländern stark beeinflußt; das war der Winkelhof, von dem stellenweise die Scheune schon abgesetzt war. Diese Bauweise konnte man wohl mit dem engen Bauraum auf den künstlich aufgerichteten Baustellen begründen u. auf Bequemlichkeit. Der Viehstall war meistens bei diesen Höfen durch die angebaute Scheune sehr dunkel, und wenn auf der andern Seite noch ein Schweinestall angebaut war, erhielt der Stall sein Licht nur von ein paar kleinen Fenstern im Stallgiebel. Die Einteilung in den Wohnhäusern war aber ähnlich wie in den Vorlaubenhäusern, nur waren die Räume kleiner. Die Arbeitshäuser waren klein u. eng, u. meist aus Fachwerk, auf einen halben Stein vollgemauert, die Dächer weitgehend Strohdach, wie auch in den kleineren Bauernhäusern. Solche Arbeiterwohnung hatte nur etwa 32 qm. Fläche, d. h. Stube u. Kammer u. Anteil an einer dunklen Küche, in der gewöhnlich 4 Familien kochen mußten. Die neueren Bauten waren etwas geräumiger u. hatten jeder besondern Eingang u. Küche. Der größere Teil der Kathen, wie man diese Häuser nannte, waren Eigentum der Bauern u. wurden auch fast ausschließlich von Leuten bewohnt, die bei ihnen arbeiteten. Aber es gab auch Eigenkäthner, die freie Arbeiter bei sich gegen Miete aufnahmen, also dörfliche Mietshäuser. Die Handwerkerhäuser waren ähnlich wie die Arbeiterhäuser gebaut, wurden aber im allgemeinen nur von der Familie des betr. Hausbesitzers bewohnt, wobei wenigstens ein Raum für das Handwerk gerechnet wurde.
Die Schulen des Kreises, von denen die großen Kirchdörfer immer eine evangelische u. eine katholische Schule besaßen, während die kleinen Dörfer nur eine Simultanschule besaßen und die kleinsten Dörfer überhaupt keine Schule hatten u. ihre Kinder in die Nachbardörfer schicken mußten. Auch die Schulen u. ebenso die Pfarrhäuser waren aus Holz gebaut, und auch dem Lehrer standen nur 2 Stuben zur Verfügung, zu denen manchmal noch ein Dachstübchen kam.
Von den Mühlen, die als Kornmühlen oder Wasserschöpfwerke um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in großer Zahl das Landschaftsbild des Großen Werders beeinflußten, war 1945 wenig mehr übrig geblieben. Die Wasserschöpfwerke waren restlos verschwunden u. auch viele Kornmühlen abgebrochen. Der Motor hatte die unzuverlässige Windkraft verdrängt.
Kap. V
Kulturelles
Als um die Mitte des 16. Jahrhunderts die mennonitischen Holländer ins Land kamen, dessen Bauernschaft fast vollzählig soeben zum evang. lutherischen Glauben übergetreten war, erhielten die Holländer von dem damaligen Landesherrn, dem König von Polen, eine Vielzahl Privilegien
1. freie und ungestörte Ausübung ihres Gottesdienstes, der als Abweichung von dem lutherischen Bekenntnis vorsah: Freie Predigerwahl, Ablehnung der Kindertaufe und des Eides
2. Befreiung vom Wehrdienst u. allen Scharwerken
3. Befreiung von allen Deichlasten.
Diese Privilegien wurden ihnen fortlaufend bei jedem Regierungswechsel bestätigt. Auch Friedrich der Große bestätigte sie, mit der Einschränkung, daß die Holländer jährlich 5000 Thlr.für das Kadettenhaus Kulm zahlen sollten. Damit waren die Mennoniten auch einverstanden. Als aber unter Friedrich Wilhelm II. der weitere Erwerb von Grund u. Boden untersagt wurde, zogen in einigen Jahrzehnten crc. 8000 Mennoniten nach Südrußland. 1868 wurde die Wehrfreiheit der Mennoniten aufgehoben, aber ebenso die Einschränkung im Ankauf von Grundbesitz. Die Folge war, daß abermals eine Auswanderungswelle, diesesmal hauptsächlich nach den Vereinigten Staaten u. Kanada einsetzte, aber auch ein weiteres Vordringen der Mennoniten in das Oberwerder. Dadurch kamen viele ehemals evangelische Grundstücke in mennonitischen Besitz, für welche die Mennoniten zu evangelischen Kirchenlasten herangezogen wurden. Ein neuer Zankapfel. Erst in der nationalsozialistischen Zeit wurde dieser Streit beendet.
Mitte des vorigen Jahrhunderts gingen dann die mennonitischen Kinder in die evangelischen Dorfschulen u. nahmen auch am Religionsunterricht teil, mit Ausnahme des Konfirmandenunterrichts. In dieser Zeit kam es noch selten vor, daß ein Bauernsohn eine andere Schule besuchte als seine Dorfschule. Aus der Franzosenzeit war in Herrenhagen bei meinem Urgroßvater Isbrand Wiebe ein Franzose zurückgeblieben mit Namen „Maner“, der etwas mehr Bildung besaß, als seine Kameraden im allgemeinen. Dieser Maner hat ein paar Jahre meinem damals 12jährigen Großvater Isbrand W. (wie sein Vater) Unterricht erteilt u. hat dann in Tiegenhof eine Privatschule eingerichtet, die von einer Anzahl Bauernsöhnen des Gr. Werders, darunter auch von meinem Vater, um 1840 besucht wurde. Dann hörte man erst um 1870, daß eine größere Anzahl Bauern ihre Söhne auf eine höhere Schule schickten, aber allgemein wurde dieses Bestreben erst um 1900, und jetzt mit dem Vorsatz, daß die Kinder ein bestimmtes Ziel, sei es mittlere Reife oder sei es Abitur erreichen sollten, was ihnen schon den Anspruch auf die Berechtigung zum Besuch einer höheren Schule oder Universität öffnete.
Das Amt eines Dorfschullehrers war im 19ten Jahrhundert noch recht dornenvoll und wurde schlecht bezahlt, aber es war doch der Aufstieg in eine höhere Gesellschaftsschicht u. brachte die jungen Männer verhältnismäßig früh in ein Amt, in dem sie heiraten konnten. Ich habe mich in den 14 Jahren meines Gemeindevorsteheramtes in Brodsack auch mit dem durchstöbern der alten Gemeindeakten befaßt, die hier seit der Zeit der Freiheitskriege fast lückenlos vorhanden waren. Da fand ich ab u. zu den Vermerk: „An dem u. dem Tage habe ich den Seminaristen – als Lehrer für die Gemeinde Brodsack gemietet.“ Der Lehrer mußte unverheiratet sein, bekam ein recht kleines Gehalt u. wurde Reihum von den Bauern beköstigt u. verdiente beim helfen in der Ernte, bei Gesängen mit den Schulkindern bei Hochzeiten, Begräbnissen etc. noch etwas dazu. Es war also eine sogenannte Rundfraßstelle. Wahrscheinlich wird er auch für Schreibarbeiten beim Schulzen ein kleines Honorar bekommen haben. Daß er viel Schreibarbeit im Schulzenamt geleistet hat, konnte man aus der gleichmässig schönen Handschrift ersehen, mit der alle Verordnungen des Landrats in einem dazu bestimmten Buch abgeschrieben waren. Es gab damals noch kein gedrucktes Kreisblatt, sondern alle Verordnungen wurden dem Schulzen mit Laufzettel zugestellt, mußten sofort abgeschrieben u. weitergeschickt werden.
Im Jahre 1830 wurde die Stelle in eine Lehrerstelle für einen verheirateten Lehrer umgewandelt. Aber auch sein Gehalt war sehr mäßig u. bestand, außer freier Wohnung, zum großen Teil aus Naturalien, wie Getreide zur Schweinemast u. für den täglichen Gebrauch. Auch bekam er die Nutzung eines Schulmorgens. Wenn der Lehrer nun landwirtschaftlich interessiert war und etwas Glück hatte, dann konnte er aus der Verwendung des Deputates ganz hübsche Einnahmen erzielen. Im andern Fall erging es ihm übel. Der erste verheiratete Lehrer hieß Adisinkewiz u. muß einen guten Ruf als Lehrer gehabt haben, da auch Kinder aus den Nachbarortschaften bei ihm in die Schule gingen. Im ganzen kann ich feststellen, daß unsere Volksschullehrer den Kindern ein gründliches Wissen vermitteln konnten, wenn die Schüler es nur aufnehmen u. verwerten wollten. Aber daran haperte es oft, und nicht allein bei den Arbeiterkindern, deren Eltern den Schulbesuch als eine drückende Belästigung empfanden, sondern auch bei manchen Bauern. Wer allerdings ganz unbegabt war, dem konnte auch der beste Lehrer nicht helfen. Die Naturallieferungen erhielten sich bis ins Ende des neunzehnten Jahrhunderts, und wenn auch inzwischen schon manche Verbesserung für den Volksschullehrer durchgeführt war, so brachte doch erst die Revolution von 1918 eine durchgreifende Besserung ihrer Lage.
Bis etwa 1900 wurden die Lehrer nur zur Ersatzreserve eingezogen u. konnten mit einigen mehrwöchentlichen Übungen ihrer Militärpflicht genügen, aber schon kurz vor dem ersten Weltkrieg mußten die Lehrer als Einjährige dienen u. wurden im Kriege auch schon oft Offizier. Über eine Einrichtung in den Schulen möchte ich noch ein paar Worte sagen, die z.T. den Eltern kinderreicher Arbeiterfamilien, z.T. der Landwirtschaft zu Gute kam, das war die Freistellung der ältesten Jungen vom Sommerunterricht, welche Zeit sie dann als sogenannte Hütejungen beim Bauern für Beköstigung u. einen kleinen Entgelt zubrachten. Das war eine Einrichtung, die zwar den Arbeitereltern u. den Bauern etwas nützte, aber der Ausbildung der Jungen erheblich schadete. Es muß aber wahrheitsgemäß gesagt werden, daß solche mangelhafte Schulbildung nicht nur bei den Arbeiterkindern zu finden war, die fraglos auch aus Not zu diesem Rettungsmittel griffen, sondern auch gelegentlich bei alten, reichen Bauern, die fraglos nicht aus solchen Kreisen stammten, die gezwungen waren, ihre Kinder vom Schulunterricht, des Gelderwerbes wegen, fernzuhalten. Hier sah man doch, daß diese Bauern entweder wenig begabt, oder von ihren Eltern nicht genügend zur Erledigung ihrer Schularbeiten angehalten waren.
Eine kleine Episode aus der Zeit der „Hütejungen“ sei hier beigefügt: Auch ich hatte zeitweise solchen Hütejungen, der in diesem Fall Hermann Zwingmann hieß. Er war verspätet aus der Schule gekommen u. das Dienstmädchen leistete ihm bei seiner Mahlzeit Gesellschaft. Dabei entwickelte sich folgendes Gespräch:
“Minna: Na, Hermann, hiide häfft di de Lehrer doch woll wedder ordentlich geschmeert?
Hermann: De schleit mi nich mehr!
Minna: Na worom nich?
Hermann: Wenn he mi schloane wöll, denn bröll eck, onn denn schmitt he mi rut.“
[Minna: Na, Hermann, heute hat dich der Lehrer doch wohl wieder ordentlich geschmiert?
Hermann: Der schlägt mich nicht mehr.
Minna: Na warum nicht?
Hermann: Wenn er mich schlagen will, dann brüll ich, und dann schmeißt er mich raus.]
Dieses Verfahren ist nicht gerade neu!
Eine Einrichtung, die in den Schulen, wenigstens die ich besucht habe, üblich war, das war der alljährliche Sommerausflug nach Steegen an der Ostsee. Das war immer eine herrliche Fahrt u. ist in meiner Erinnerung auch immer von schönem Wetter begünstigt gewesen. Für diesen Zweck wurden soviel Leiterwagen zurecht gemacht, wie von der Klasse benötigt wurden u. von den Bauern der Schule kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Zurechtmachen bestand darin, daß in den etwa 6-7 m langen Leiterwagen ein Rapsplan eingebunden wurde. Dann kam eine Schicht Stroh in den Plan u. darüber noch ein Rapsplan; dann wurden etwa 10 Getreidesäcke kräftig voll Spreu gestopft, das waren die Sitzgelegenheiten für 30-40 Kinder; und wenn der Wagen dann ordentlich mit grünen Zweigen ausgeschmückt war, dann war der Wagen fertig zum einsteigen. Die Fahrten sind immer ohne Unfall verlaufen. Ich erinnere mich, daß wir von Brodsack aus einmal einen Dampferausflug über Tiegenhof nach Kahlberg, zusammen mit der evang. Schule Marienau und einmal einen Kleinbahnausflug Liessau-Steegen unternommen haben. Aber das waren Seltenheiten. Im Familienkreis haben wir solche Leiterwagen-Ausflüge öfter gemacht.
Ich komme nun auf die Gliederung der einzelnen Bevölkerungsschichten zu sprechen. Diese Gliederung war doch erheblich schärfer abgegrenzt, als wir hier in Westdeutschland kennengelernt haben. Zwischen Bauern, Handwerkern u. Arbeitern war ein unsichtbarer, aber sehr deutlicher Trennungsstrich festzustellen u. es kam nicht oft vor, daß 2 junge Leute aus diesen verschiedenen Gruppen heirateten. Kam es doch einmal vor, dann hatte das junge Paar, ja sogar oft noch die Kinder darunter zu leiden. Dabei standen sich die Bauern mit ihren oft langjährigen Arbeitern u. erst recht mit den alten eingesessenen Handwerkern gut, aber Familienverbindung mit ihnen wollten die stolzen Bauern nicht haben. Etwas weniger scharf war schon der Trennstrich zwischen Handwerkern u. Arbeitern, obgleich auch diese lieber in ihre eigenen Reihen heirateten. Auch ging der Weg zum Aufstieg für die Arbeiter fast durchweg über das Handwerk. Man pflegte zu sagen, die Reihenfolge beim Aufstieg eines Arbeiters sei: Arbeiter, Handwerker, Lehrer, Pfarrer. Ende des neunzehnten Jahrhunderts begannen die Bauern, ihre Söhne auf eine höhere Schule zu schicken, aber sie trugen sich selten mit dem Gedanken dabei, den Söhnen den Besuch der Schule bis zur Abschlußprüfung abzuverlangen u. die Söhne auch diesem Ziel entsprechend anzuspornen. Sie waren der Meinung, daß es zu einer besseren Schulbildung schon genüge, wenn sie die Söhne 1-2 Jahre länger, u. zudem auf eine höhere Schule schickten, daß die Jungen dann mit einer besseren Schulbildung nach Hause kämen. Sie hatten nicht bedacht, u. waren zu dieser Beurteilung wohl garnicht im Stande, daß jede Schule ihr abgerundetes Pensum hat, das erst bei Absolvierung der ganzen Schulzeit erreicht werden konnte. So kam für die Schüler, die dieses Pensum nicht erreicht hatten, weil sie vorzeitig von der Schule weggenommen waren, ein sehr geringer Nutzen bei dem Besuch der höheren Schule heraus.
Für unsere Bauernsöhne kamen als solche Schulen die Mittelschule in Tiegenhof, die Landwirtschaftsschule in Marienburg, das Gymnasium in Marienburg u. teilweise auch die Oberrealschule in Frage. Sie wurden auch alle von diesem oder jenem Bauernsohn besucht, aber die Abschlußprüfung der betr. Schule wurde selten erreicht, sei es, daß den Jungen die Lust zum lernen vergangen war, sei es, daß dem Vater die Pension zu teuer war. Die Jungen kamen meist mit 15-16 Jahren nach Hause, wo sie oft dringend in der Wirtschaft benötigt wurden. Wenn die Väter dann, besonders bei begabten Jungen, vom Director bedrängt wurden, er solle den Sohn bis zur Abschlußprüfung auf der Schule lassen u. der Vater dann auch schon etwas reich geworden war, dann wollte der Sohn oft nicht mehr; er hatte sich schon so schön an den Gedanken gewöhnt, nun endlich die lästige Schularbeit los zu sein. Allenfalls blieben noch einige bis zur Versetzung nach Obersecunda auf dem Gymnasium oder der Oberrealschule, die ihnen dann den Berechtigungsschein zum einjährigen Dienst brachte. Das änderte sich um die Jahrhundertwende. Die neue Generation brachte ihre Söhne schon mit dem Vernehmen zur Schule, daß sie diese Schule nun auch absolvieren sollten. Und viel Söhne u. Töchter haben den Erwartungen der Eltern entsprochen u. sind in akademische Berufe eingeschwenkt. Wenn man heute im Geiste die Bauernsöhne der Heimat, die Akademiker geworden sind, Revue passieren läßt, dann findet man Juristen, Ärzte, Philologen, Geistliche, Offiziere, Physiker, Chemiker, Diplomlandwirte, Ingenieure u. Dipl. Ingenieure, Künstler u. Schriftsteller darunter, und der Andrang zu den höheren Schulen hat fast bedrohliche Formen angenommen, da die Schulen, die doch noch immer nicht vollkommen aufgebaut sind, trotz Vormittags- und Nachmittagsunterricht in überfüllten Klassen, die Schüler nicht alle aufnehmen können.
Kap. VI
Unterhaltung der Dorfjugend um die Mitte des 19. Jahrhunderts
Durch das damals neu entstandene preußische Abgeordnetenhaus war die Prügelstrafe für mehr oder weniger feine Neckereien, die von der halbjährigen Arbeiterjugend hauptsächlich gegen ihre Bauern als Rache für irgend welche Tadel der Bauern verübt waren, aufgehoben. Aber solche neuen Gesetze drangen nicht gleich bis in unser abgelegenes Werder. Ich fragte in meinen Jugendjahren auch einmal den alten Pferdefütterer Dellmann, der noch in der vormärzlichen Zeit aufgewachsen war, nach diesen Prügelstrafen. Er meinte, das wäre so schlimm nicht gewesen; wenn man zur Exekution befohlen war, zog man sich schon vorsichtshalber immer eine dicke Lederhose unter die Oberhose, und dann wäre es schon zu ertragen gewesen. Vielleicht verfuhren die Delinquenten auch nach dem Muster von Hermann Zwingmann: „Denn bröll eck, onn denn schmiete se mi rut.“ [Dann brüll ich und dann schmeißen sie mich raus]
Von solchen Neckereien haben mir meine älteren Verwandten gelegentlich mal etwas erzählt: So hatte z.B. ein Bauer am Abend seine Wagen zu irgend einer Arbeit zurecht gemacht u. auf dem Hof stehen lassen. Als er am nächsten Morgen seinen Wagen bespannen will, sucht er ihn zunächst vergebens. Aber endlich entdeckt er ihn – auf dem First seiner Strohdachscheune, wo er, sauber zusammengesetzt u. abfahrbereit, stand.
Ein andermal war einem Bauern sein Wagen auseinandergenommen u. der Vorderwagen, mit der Deichsel voraus, in den offenen Hofbrunnen gesteckt und die andern Wagenteile irgendwo versteckt.
Die Bauernsöhne neckten sich u. ihre Eltern gegenseitig mit ähnlichen Späßen.
Ein Bauer hatte alles vorbereitet zur alljährlichen Schweineschlachtung in der Martinszeit. Solche Schlachtungen von mehreren Schweinen, aus denen der Fleischbedarf für das ganze Jahr konserviert wurde, begann, unter Mithilfe von Nachbarskindern schon immer sehr früh, um 2-3 Uhr, damit man in einem Tage fertig werden konnte. Und es war immer großes Hallo, wenn dabei irgend etwas nicht klappte u. darin eine Verzögerung eintrat.
In diesem Fall sollte morgens in aller Frühe das Feuer unter dem Kessel garnicht brennen, in dem das benötigte Wasser zur Brühe gekocht werden sollte. Man versuchte alles mögliche, um das Feuer anzufachen, denn mit der Schlachtung konnte nicht begonnen werden, wenn die Brühe nicht gekocht hatte. Nachdem Stunden vergangen waren, entdeckte man endlich, dass der Schornstein mit einer großen Holzplatte zugedeckt war und der schaden war nun leicht beseitigt, aber kostbare Stunden waren vergangen.
Im Garten unseres Nachbars in Ladekopp stand ein nettes Gartenhäuschen mit einem kleinen Dachraum. Das Häuschen diente auch Handwerkern, wenn sie auf dem Hof beschäftigt waren, als Schlafraum. In schöner Sommerzeit war mal wieder der Schneider mit seinem Gesellen Nachtgast in diesem Häuschen. Der Schneider war entsetzlich abergläubisch u. voll der grauenhaftesten Geschichten, die er in den Feierabendstunden regelmäßig zum besten gab. Mein Onkel Aron, damals noch ein junger Bursche, war mit dem gleichaltrigen Nachbarssohn befreundet u. hörte auch mehrmals zu, wenn der Schneider erzählte. Da beschlossen die beiden Bauernburschen, den Schneider mal ordentlich zu graulen. Am folgenden Tage, als der Schneider im Hof beschäftigt war, wurden allerlei zerbrochene irdene Töpfe über dem Schlafraum des Schneiders aufgestappelt und eine lange Kette darüber geführt, die man von außen hin u. her ziehen konnte. Abends versammelte sich wieder die Gesellschaft u. hörte dem Schneider andächtig zu. Schließlich war es aber Zeit zu Bett zu gehen. Die beiden Verschworenen blieben aber noch ein bischen sitzen. Der Bauer blieb auch sitzen u. wunderte sich nur, daß Onkel Aron garnicht nach Hause ging, u. da ihm wohl schon manche Streiche der Beiden bekannt waren, vermutete er auch bald, daß sie wieder etwas ausgeheckt hätten, u. schließlich mußten sie gestehen, was sie vorhätten. Da war der Nachbar auch interessiert u. kam mit, als die beiden Kadetten zum Gartenhäuschen gingen, um ihr diabolisches Werk zu beginnen. Als man sich überzeugt hatte, ob der Schneider auch schlief, wurde zunächst der Haufen Scherben zum Einsturz gebracht, dann wurde in Abständen die Kette über den Scherbenhaufen gezogen, bis der Nachbar befahl: „Nu hört oawer app, sonst starrt mi de Schnieder noch!“ [Nun hört aber auf, sonst stirbt mir der Schneider noch].
Den Schaden bei diesem etwas zweifelhaften Vergnügen hatte schließlich die Hausfrau. Sie hat am nächsten Tage – große Bettwäsche halten müssen.
Auch in den kleinen Städten vergnügte man sich mit ähnlichen Scherzen.
Ein biederer Bäckermeister hatte sich 6 schöne Ente gemästet u. geschlachtet. Sie sollten am nächsten Tage verzehrt resp. konserviert werden. Aber am nächsten Tage waren die Enten verschwunden u. trotz aller Nachforschungen blieben sie verschwunden. Nach einigen Tagen wurde der Meister von Freunden zu einem Entenessen eingeladen. Da kamen dem Meister schon einige Bedenken. Er folgte aber doch der Einladung u. hatte am nächsten Tage, nach dem schönen Essen u. einem kräftigen Trunk die Sache schon halb vergessen u. lehnte behaglich über der Untertür seines Hauses (damals hatte man auch in den kleinen Städten oft die Haustür in Unter u. Obertür geteilt) und dankte freundlich für Grüße vorübergehender Nachbarn, die sonderbarerweise immer grinsend nach seinem Hausgiebel über der Haustür schauten. Schließlich dachte er: du mußt doch mal sehen, was da eigentlich so sehenswert an deinem Hausgiebel ist. Als er daher auf die Strasse trat, sah er sofort die Sehenswürdigkeit, denn oben waren 6 Entengerippe angenagelt. Da entrang sich dem Meister nur der resignierte Ausruf:
„Uck dat nock“!! [Auch das noch!]
Das waren so einige Proben aus dem Vergnügungsregister der Dorfjugend, u. manchmal auch schon reiferer Semester im Gr. Werder vor 100 Jahren. Das Land war durch seine beiden großen Ströme noch mehr von der Welt abgeschlossen, die Verkehrswege viele Monate im Jahr fast unpassierbar, u. reisen taten damals so wie so nur die Handwerksburschen.
Zu dieser Zeit sprach im Gr. Werder noch alles, hoch u. niedrig, plattdeutsch. Dieses Plattdeutsch ist aber nie Schriftsprache gewesen u. so kam es, daß auf allen Versammlungen zwar in plattdeutsch verhandelt, das Protokoll aber in hochdeutsch geschrieben wurde. Vereinigungen, in denen nur Werderbauern verhandelten, gab es nur wenige. Als älteste Vereinigung möchte ich die Tiegenhöfer Feuerversicherung bezeichnen, die im 17. Jahrhundert von holländischen Mennoniten in Tiegenhagen gegründet wurde u. der sich allmählig das ganze Werder anschloß, denn es gab wohl mehr als 100 Jahre lang noch keine andere Feuerversicherung im Werder. Sie bestand auch noch, als wir aus der Heimat vertrieben wurden, hatte aber in den letzten Jahrzehnten schwer gegen die Konkurrenz der großen Aktiengesellschaften zu kämpfen. Da ich Ende des 19ten Jahrhunderts kurze Zeit auch Brandschulze in Brodsack war, habe ich noch einige solche, in plattdeutscher Sprache geführter, aber in hochdeutsch protokollierter Versammlungen mitgemacht.
Ein ähnliches Verhältnis bestand übrigens auch zwischen uns u. unsern Eltern, als wir von früher Kindheit an angehalten wurden, hochdeutsch zu antworten, wenn unsere Eltern uns etwas auf plattdeutsch fragten. Auf diese Weise war bis zum Ende des 19ten Jahrhunderts die Bauernbevölkerung auf hochdeutsch umgestellt worden. Unsere Eltern haben mit uns oft plattdeutsch gesprochen, wir aber gaben hochdeutsche Antworten. Unter sich u. mit ihren Geschwistern sprachen unsere Eltern plattdeutsch bis an ihr Lebensende. Ich selbst bin in meinem Leben nie aus dem Werder herausgekommen u. habe in Brodsack auch immer mit meinen Leuten plattdeutsch gesprochen, aber die meisten meiner Geschwister verstanden zwar jedes Wort plattdeutsch, konnten es aber nicht mehr sprechen. In den Arbeiterkreisen hatte sich das plattdeutsche bis zu unserer Vertreibung gehalten, aber jetzt wird auch dort wohl kein Raum mehr für die alte Muttersprache sein.
Kap. VII
Kleidung
Fast so scharf, wie der Trennstrich zwischen Bauern, Handwerkern u. Arbeitern im Familienverkehr war, war er auch in der Kleidung, die in meinen 86 Lebensjahren manchen Wechsel durchgemacht hat. Die Männerkleidung basierte allerdings fast immer auf den Kleidungsstücken: Jacke, Weste, Hose. Die Jacke wurde auch wohl durch den schwarzen Gehrock, den schwarzgrauen Cutaway, den schwarzen Smoking oder den Frack ersetzt.
Der feierlichste Anzug für Hochzeiten u. Bälle war immer der schwarze Frack mit tiefausgeschnittener Weste u. schwarzer Hose. Nach dem Frackanzug kam der der schwarze, bis zum Knie reichende Gehrock für Begräbnisse, großen Kirchgang etc. Dazu trug man eine schwarze wenig ausgeschnitteneWeste, weißes Hemd u. schwarze Schleife. Zum Frack wurde Plätthemd u. weiße Schleife getragen. Der Smoking war eigentlich eine halblange schwarze Jacke mit frackähnlichen Kragenaufschlägen, zu dem man schwarze Hose u. schwarze Schleife trug und die schwarze Gehrockweste. Nach dem 1ten Weltkriege kam der Cutaway in Mode, ein kurzer, vorn stark abgerundeter Rock von dunkelgrauer Farbe mit gleicher Weste u. grauer, schwarzgestreifter Hose, wozu man eine farbige Krawatte trug. Dieses Kleidungsstück war fraglos das praktischste. Man konnte es zu allen Gelegenheiten tragen, ohne anzustoßen. Für den Alltag hatte man natürlich andere Kleider, u. ich erinnere mich aus frühen Jugendtagen, daß die alten Herren damals noch teilweise die Hose mit dem breiten Latz trugen, der an den Seiten zugeknöpft wurde. Das war noch die Hose aus Napoleons Zeiten, den man auch oft darin abgebildet sieht. Sonst hat sich am Schnitt der Hose in meiner Lebenszeit wenig geändert. Sie wurde mal enger, mal weiter, mal mit Aufschlägen getragen, wozu die Bügelfalte unerläßlich ist. Zum Alltag u. Reisen hatte man einfachere Jackettanzüge, eine Reithose u. eine derbe Joppe. Alles zusammen war eigentlich ein unverantwortlicher Luxus u. es hatten auch längst nicht alle Bauern all diese Anzüge, aber einen schwarzen Gehrockanzug besaß wohl jeder Bauer u. auch jeder Handwerksmeister u. auch ein Teil der Arbeiter, die natürlich meist Anzüge von der Stange trugen u. starke dauerhafte Sachen bevorzugten. Zu der Arbeitskleidung der Arbeiter u. auch der jungen Bauern gehörte eine farbige Leinenbluse, die man heute Sporthemd nennt und darüber einen Wenning, das ist eine blaue kurze Leinwandjacke, wie sie heute vielfach die Monteure tragen. Einen Mantel besaß wohl jeder, wer sich’s leisten konnte, einen für den Sommer u. einen für den Winter. Wer oft fahren mußte, hatte darüber hinaus auch einen langen Mantel – Burka genannt – auch wohl einen Fahrpelz u. einen Gehpelz. Man sieht daraus, wer alle diese Dinge besaß, hatte schon einen ordentlichen Kleiderschrank nötig. Mein Vater besaß ausser einem schwarzen Gehrockanzug nur seine Alltagskleider u. kam damit auch aus. Wie es eigentlich gekommen ist, daß sich der, doch recht wenig verwendbare, Frackanzug bei den sonst so sparsamen Bauern schon in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts einbürgerte, ist mir nicht recht erklärlich; ich habe das aber aus alten Bildern aus dieser Zeit feststellen können.
Nun sind uns Flüchtlingen, besonders den ehemaligen Bauern, soweit sie nicht im alten Beruf unterkommen konnten, alle Luxusgedanken vergangen. Es muß sich eben jeder nach der Decke strecken.
Wir Werderbauern waren also durchaus nicht bescheiden in unsern Ansprüchen an Kleidung, u. wir waren auch sonst nicht bescheiden in unsern Ansprüchen an das Leben. Wir liebten ein geselliges Leben u. blieben im Freundeskreise auch manchesmal länger in der Stadt sitzen, als unsere Geschäfte es erforderten. Das ist der Nachteil im Beruf des Bauern, daß ihm soviel freie Zeit gelassen wird, über die er frei verfügen kann. Und er verfügte nicht immer zu Gunsten seiner Familie oder seiner Wirtschaft darüber.
Das Leben in den letzten 40 Jahren ist ja ein immerwährendes auf u. ab gewesen. Die zwei langen Kriege u. die dazwischen liegende Inflationszeit veränderten den Wert des Geldes oft von einem Tage zum andern. Da mußte man sehr auf der Hut sein, mit seinen Ausgaben. Der Bauer war in diesen Zeiten sehr bevorzugt; er besaß in seinen Erzeugnissen gewissermaßen eine Goldwährung gegenüber vielen anderen Berufen. Aber, wehe! wenn er seine Produkte vorzeitig verkaufte, da konnte er in einem Jahr pleite sein.
Und so kam es, daß der Bauer nach der Inflationszeit, die ihn doch eigentlich von allen Schulden befreit hatte, so unterschiedlich dastand. Der eine hatte richtig disponiert u. war nach der Inflationszeit tatsächlich schuldenfrei, der andere hatte sehr bald wieder eine Umschuldung nötig, die zwischen den beiden Weltkriegen mitunter sogar zweimal in Anspruch genommen wurde.
Nun müßte ich wohl eigentlich noch etwas über die Kleidung der Frauen sagen, aber da fühle ich mich nicht recht zuständig.
Von meiner Mutter weiß ich, daß sie in ihren Jugendtagen, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, noch als größten Staat den Reifrock, die Krinoline, getragen hat. Das dazu gehörige Korsett blieb mitsamt der Haube für die verheirateten Frauen noch bis ins 20. Jahrhundert modern. Die langen Röcke u. das geteilte Beinkleid war noch bis zum 1. Weltkrieg gebräuchlich. Dann wurden die Kleider, entsprechend dem Warenmangel, immer kürzer u. reichten am Ende des Krieges nur noch bis zum Knie, was mit aufkommendem Sport der Frauenwelt, mit Turnkleidung der Mädchen u. jungen Frauen, mit Schlüpfer u. Skihosen gut zusammenpaßte. Die Hosentracht bei Frauen fand auch bei unsern Landarbeiterinnen bald viele Anhänger, und mit Recht! Die Hosentracht der Mädchen u. Frauen hat sich auch zwischen den beiden Weltkriegen und nach dem II. Weltkriege nicht mehr verdrängen lassen, als, sowohl nach dem 1. als auch nach dem 2ten Weltkriege, die Frauenkleider wieder ihre alte Länge erreicht hatten.
Nachdem seit etwa 40 Jahren die Bartlosigkeit der Männer, dafür aber ein längerer Haarschnitt modern geworden sind, andererseits die Mädchen u. jungen Frauen den Bubikopf bevorzugen u. viel Hosen tragen, ist Unterscheidung zwischen männlich u. weiblich etwas schwierig geworden.
Die vielen Ehescheidungsprozesse der Nachkriegszeit, u. zwar in allen Kreisen unseres Volkes, bis in die höchsten Spitzen und ihre oft sehr eingehende Behandlung in Zeitschriften u. Büchern veranlaßt mich, die diesbezüglichen Zustände während des letzten Jahrhunderts in meinem Heimatkreise Gr. Werder möglichst unparteiisch zu schildern.
Am unbekümmertsten lebte in dieser Beziehung unsere Arbeiterjugend. Sie war auch am wenigsten geschützt. Nach der Schulentlassung mußten Jungen u. Mädchen beim Bauern in den Dienst gehen u. mußten die Schlafkammer meistens mit einem älteren Mädchen teilen, die natürlich längst ihren Verehrer hatte u. auch jederzeit bei sich aufnahm. Das erscheint von dem Dienstherrn barbarisch, daß er seinem Jungmädchen keine andere Schlafstelle gab, um sie vor allen Versuchungen zu bewahren. Aber diese Mädels wollten ja gar nicht bewahrt werden. Sie waren empört, daß man ihnen ihr Recht auf Liebe beschränken wollte. Ihre Eltern hätten es so gehalten u. ihre Großeltern auch, u. sie wollten nicht schlechter leben, wie diese. Und weil sie darin Recht hatten, konnten Ermahnungen der Eltern auch wenig nützen. Und wenn dann, ungewollt, ein kleiner Sprößling aus solchem Liebesleben hervorging, dann wurde der kleine Wildling, wenn auch vielleicht mit einigem Gebrumme, von den Eltern der jungen Wöchnerin aufgenommen u. einstweilen aufgezogen, ohne viel nach dem Vater zu fragen. Oft trug er gutwillig etwas zum Unterhalt des Kindes bei, oft auch nicht. Alimentenklagen waren meist aussichtslos, da die Väter ohne Vermögen waren u. auch nur einen kleinen Verdienst hatten. Und so blieb die Hauptlast auf der Großmutter sitzen, die wahrscheinlich in der Jugend in gleicher Lage Hilfe bei ihrer Mutter gefunden hatte. Oft wechselte man auch den Gegenstand seiner Liebe u. fand nachher wieder zu ihrem ersten Freund zurück. Und wenn sie sich dann ausgetobt u. verheiratet hatten, nahm der Ehemann das Kind seiner Frau meistens gutmütig bei sich auf u. später wurden es allgemein gute Ehen, die selten geschieden wurden; wenigstens viel seltener, wie in den sogenannten besseren Kreisen.
In den Handwerkerkreisen hatten die Mädchen schon mehr Selbstdisziplin. Sie heirateten meist untereinander. Die halbwüchsigen Töchter wurden vielfach Schneiderinnen u. gingen auch mitunter als Kindermädchen oder Wirtin, auch „Mamsell“ genannt, in die großen Bauernhöfe u. wurden dort manchmal die Freundin der erwachsenen Bauernsöhne oder der jungen Beamten. Das führte dann auch oft zu Alimentenprozessen, die den Mädchen, wenn auch nicht die Ehe, so doch ein Unterhaltgeld für das aus dem Verhältnis hervorgegangene Kind einbrachten. Neuerdings spielen ja bei allen Alimentenklagen die Blutproben eine erhebliche Rolle, die auch zuweilen ergaben, daß der in Anspruch genommene Mann nicht der Erzeuger des Kindes sein könne. Er sollte nur als Lückenbüßer dienen. Ganz selten kam es auch zu Eheschließungen, was dann meistens zu einem Zerwürfnis mit der Familie des Mannes führte. In beiden Kreisen gab es aber auch Ausnahmen, wo der Ehestand tatsächlich erst nach der Hochzeit begann.
In den Bauernkreisen war diese Ausnahme die Regel. Die Töchter wurden bis ins 20te Jahrhundert zu Hause gehalten u. ihr Umgang mit fremden jungen Männern stand sozusagen unter Aufsicht der Mutter, die ihre Töchter für den Beruf einer Bauernfrau erzogen hatte u. auch sehr besorgt darum war, daß die Tochter rechtzeitig unter die Haube kam. Entgleisungen kamen zwar auch vor, aber sie waren sehr selten u. wurden dann auch nach Möglichkeit verheimlicht. Der Norweger Knut Hamsun hat für seinen Bauern Roman „Segen der Erde“, einen Literaturpreis bekommen. Ich weiß nicht, in welchen Bauernkreisen er seine Studien zu diesem preisgekrönten Roman gemacht hat, im Großen Werder jedenfalls nicht. Ich lehne diese Form der Schilderung des Bauernlebens, wo die Mädchen als Kindsmörderin u. Hure u. die Männer als Trottel geschildert werden, die sich von der Frau alles gefallen lassen, wenn sie nur ihre Mitarbeit auf dem Hofe haben, ab.
Bei den jungen Männern unter den Bauern war diese strenge Selbstdisziplin allerdings weit seltener. Früher, wie auch die Söhne bis zur Heirat im Haus gehalten wurden, kam es unter den vielen Nachbarskindern oft schon früh zu einem Eheversprechen, und das war dann eine gute Stütze für beide Teile, vorausgesetzt, daß das Verlöbnis ernst gemeint war.
Im 20ten Jahrhundert trat dann allmählig eine Lockerung in dem Verhältnis Kinder-Elternhaus ein. Die Kinder kamen auf städtische Ausbildungsanstalten, wozu meistens auch eine Pension in der Stadt notwendig wurde und die Kinder nur in den Ferien nach Hause kamen. Da mußten dann Söhne und Töchter frühzeitig selbst für sich einstehen. Die, schon Anfangs des Jahrhunderts, eintretende Lockerung im Verkehr der beiden Geschlechter untereinander, u. zur nationalsociallistischen Zeit, dessen [sic] Lehren, brachten so manches Mädel aus ehrbarem Hause zu Fall, in dem Selbstdiziplin nicht fremd war.
Möge ererbte Selbstdisziplin u. das Andenken an ein ehrbares Elternhaus die jungen Menschen dieser Zeit stützen.
Kap. VIII
Freistaat Danzig
Im zwanzigsten Jahrhundert entwickelten sich alle sportlichen Bestrebungen, an denen jetzt auch die Arbeiterschaft teilnahm, bei der besonders Fußball sehr beliebt wurde und die vielen Fahrräder, die bald Jeder besaß, erleichterten die Zusammenkünfte, auch wenn man etwas abseits wohnte. Um 1909 gelang den Menschen endlich das motorische Fliegen, u. zwar fast gleichzeitig als Zeppelinflieger mit großem Luftschiff u. als Flieger mit kleinerem Apparat für 1-2 Personen, die große Tragflächen, wie riesige Vogelschwingen, besaßen. Sie konnten nur durch eine gewisse Schnelligkeit in der Luft gehalten werden. Der erste Weltkrieg förderte beide Typen. Der Krieg hatte noch nicht entgiltig darüber entschieden, ob dem Flugzeug oder dem Luftschiff nach dem Muster „Zeppelin“ der Vorrang gebühre. Der Zeppelin hatte nach dem ersten Weltkrieg sogar eine Fahrt um die Erde über Rußland, Sibirien, Japan u. Vereinigte Staaten von Amerika durchgeführt, u. dann regelmäßige Fahrten von Deutschland nach Süd u. Nordamerika eingerichtet. Als aber dann etwa 1930 der Zeppelin in U.S.A. kurz nach seiner Landung verbrannte, war die Konkurrenz zu Gunsten des Flugzeugs entschieden.
Ende der zwanziger Jahre gelang dem Amerikaner Lindberg zum erstenmal ein Flug über den Atlantik von Nordamerika nach Frankreich u. bald darauf einem deutschen Flieger die Überquerung des Oceans in der entgegengesetzten Richtung.
Der zweite Weltkrieg hat dann die Entwickelung des Flugverkehrs derartig gefördert, daß heute die Leute, die das Geld haben, für größere Strecken eigentlich nur noch das Flugzeug benutzen.
Für die Leute aus dem großen Werder war, wie auch für weite Kreise auf der Erde, mit Beginn des ersten Weltkrieges die geruhige Zeit vorbei. Zwar hatte uns im Osten, nachdem Hindenburg die Russen aus dem Lande gejagt hatte, der Krieg kaum berührt, abgesehen von den schmerzlichen Verlusten an lieben Menschen, die auch wir natürlich zu tragen hatten. Aber dann kam nach dem verlorenen Kriege die erste Zerstückelung Deutschlands u. unsere Einverleibung in den neu gegründeten Freistaat Danzig. Wir waren damals schon froh, daß wir wenigstens nicht zu Polen kamen. Aber die sonderbare Einrichtung, daß Polen die Vertretung Danzig’s im Ausland übertragen war, und daß Danzig mit Polen im gemeinsamen Wirtschaftsverband war, gab den Polen sehr bald Gelegenheit, sich immer mehr Rechte in Danzig zu verschaffen. Das färbte natürlich auch auf das große Werder ab, das zudem, da Dirschau u. ein Streifen Land bis fast Hohenstein polnisches Gebiet geworden war, das wir auf jeder Eisenbahnfahrt von Liessau nach Danzig durchqueren mußten, was immer mehrfache Paßkontrollen mit sich brachte. Zunächst war die Mitte des Weichselstromes als Grenze zwischen Polen u. Danzig festgesetzt. Dadurch waren 5/6 der beiden Weichselbrücken Danziger Besitz geworden. Aber dadurch war auch die Unterhaltung der beiden Brücken, sowie des ganzen Hauptbahnhofs in Danzig, Pflicht des kleinen Danziger Staatsgebietes geworden.
Diese Last konnte Danzig nicht tragen u. übergab den ganzen Bahnbetrieb freiwillig den Polen, mit der Bedingung, daß auf Danziger Gebiet nur Danziger Staatsangehörige angestellt werden durften.
Das war also die erste große Einfallspforte für die Polen, ihren Einfluß auf das sehnlichst erwünschte Danzig auszudehnen. Aus der kleinen polnischen Minderheit in Danzig wurden nun fleißige Eisenbahnbeamte ausgebildet u. die Kinderreichsten auf die Bahnhöfe im Danziger Gebiet versetzt. Es bestand nämlich die vertragliche Verpflichtung für Danzig, polnische Schulen oder wenigstens Schulklassen mit poln. Unterricht in denjenigen Orten einzurichten, in denen die Eltern von mehr als zehn der polnischen Kinder dieses verlangten. Im Kreise Gr. Werder ist den Polen dieses nur in Simonsdorf gelungen.
Dann mußte den Polen gestattet werden, sich ihre eigene Post u. eigene Briefkästen einzurichten. Dann erfolgte die zwangsweise erteilte Genehmigung, auf der Westerplatte ein Lager für Seegüter einzurichten. Aus diesem Lager machten die Polen ein starkes Fort mit entsprechender Besatzung. Und so ging das dauernd fort.
Der schlimmste Schlag für Danzig aber war der Bau des Hafens Gdingen (später Gotenhafen genannt), zu dem eine sogenannte Kohlenbahn von Oberschlesien führte, die Danziger Gebiet umging. Dadurch wurde der Danziger Hafen weitgehend stillgelegt, und die Danziger Import u. Export Firmen waren gezwungen, Kontore in Gdingen einzurichten, wenn sie nicht ihren Kram zumachen wollten.
Der kleine Freistaat Danzig konnte die große Stadt Danzig nicht ernähren u. war deshalb weitgehend von der polnischen Einfuhr abhängig. Die Polen drohten, daß sie uns den Brotkorb höher hängen würden, wenn Danzig ihnen nicht noch weitere Rechte einräume. Und als Danzig nicht weiter nachgab, machten sie Ernst mit ihrer Drohung. Da riefen sie aber Deutschland auf den Plan, welches seinerseits drohte, die Grenzen nach Ostpreußen für die Einfuhr von Lebensmitteln zu öffnen, wenn Polen nicht sofort sein Verbot aufhob. Das geschah denn auch. Aber nun versuchten die Polen, den Danziger Markt mit Lebensmitteln zu überschwemmen u. den Danziger Handel dadurch zu vernichten. Ein Verbot von Einfuhr aus Polen war vertraglich nicht zulässig. Aber da kamen die Danziger auf den genialen Gedanken, den Kaufleuten, die aus Polen importierten, Kontingente zuzuteilen, die natürlich so bemessen waren, daß die Danziger Erzeugung auch Absatz fand. So etwa war das Verhältnis zwischen Polen u. Danzig am 1.9.1939. Als dann am 1.9.39 Vormittags 5 Uhr der konzentrische Angriff deutscher u. Danziger Truppen einsetzte, war dem ganzen polnischen Spuk in Danzig sehr bald ein Ende gesetzt. Leider fielen an diesem Tage auch die beiden Weichselbrücken bei Dirschau dem Kriege zum Opfer.
.
[Eisenbahnbrücke bei Dirschau. Aus dem Internet: Preußische Ostbahn]
Die Eisenbahnbrücke wurde zwar von den Deutschen innerhalb 2 Monaten wieder aufgebaut, die Fuhrwerksbrücke diente während des ganzen 2ten Weltkrieges nur dem Fußgängerverkehr.
Im Gebiet des großen Werders waren bis kurz vor Kriegsende Kriegszerstörungen nicht erfolgt. Es kamen zwar ab u. zu feindliche Flieger über unser Gebiet, haben aber kaum Schaden angerichtet. Nur im Januar 1945, als die Russen schon an der Nogat standen, fielen einige Gebäude den Brandbomben zum Opfer. Und am 24. Januar 1945 mußten wir Haus u. Hof verlassen. Das war vor zehn Jahren!
Kap. IX
Der Winter 1887/88 und der Dammbruch bei Jonasdorf 25.3.1888
Der sehr schneereiche Winter 1887/88 und der Dammbruch waren ein einmaliges Erlebnis für mich, deshalb sei den ganzen Vorgängen ein breiterer Raum gewidmet.
Der Winter begann im Dezember 87 ganz normal u. von Weihnachten 87 bis Ende Januar 88 hatten wir eine flache Schlittenbahn u. wenig Frost. Dann setzte stärkerer Frost u. fast täglich Schneestürme ein, die zunächst bis Mitte März anhielten u. den Verkehr sehr behinderten. 2-3 m. hohe Schneeschanzen sperrten fast überall die Zugänge zu den Dörfern. Sie wurden zwar oft durch Handarbeit beseitigt, waren aber ebenso oft wieder da. Auf den Chausseen hatten sich regelrechte Schneedämme gebildet, von mehr als 1 m. Höhe, aber nur so breit, daß gerade ein Schlitten darauf fahren konnte. Begegneten sich 2 Schlitten, so mußte der eine von diesem festgefahrenen Damm herunter in den losen Schnee u. kippte in der Regel um. Das war an sich nicht lebensgefährlich, ja, sogar für junge Leute ganz amüsant. Aber es waren nicht alles junge Leute u. auch diesen wurde der Spaß bald über, wenn sich die Umkipperei zu oft wiederholte.
So lag Mitte März eine fast gleichmäßig 1 mstarke Schneedecke auf unsern Feldern u. wir sahen dem kommenden Frühling mit einiger Sorge entgegen. Da überraschte uns Mitte März die Nachricht, daß im oberen Weichsellauf der Eisgang eingesetzt hätte. Da bei uns damals 25° Frost herrschten, waren wir der Meinung, daß das Eis wieder zum stehen kommen würde. Da hatten wir uns aber getäuscht. Am 19. März überraschte uns erneut die Nachricht, dass der Eisgang auf der Nogat in vollem Gange sei u. alle Mann auf die Deiche mußten. Einen weiteren Schreck bekamen wir, als wir hörten, daß sich das Eis, kurz unterhalb der Nogatabzweigung, in der Weichsel verworfen hatte u. einen breiten undurchdringlichen Eisdamm quer durch die Weichsel gelegt hatte.
Nun mußte die Nogat das ganze Weichselwasser u. Eis aufnehmen. Die Nogat mündete aber nicht in das offene Meer, sondern in das mit einer meterdicken Eisdecke bedeckte Haff. Derweil arbeiteten Danziger Pioniere Tag u. Nacht an der Beseitigung der Eissperre in der Weichsel, aber vergebens.
Zur Entlastung der, im Unterlauf teilweise recht schmalen Nogat, war, wohl schon in der Ordenszeit, die Elbinger Einlage geschaffen worden, d.h. der linksseitige Nogatdamm war auf eine Strecke von etwa 7 klm. nur crc. 2 klm. vom Strom ab verlegt worden, wodurch ein großes Stück Grasland entstand, das dem Nogathochwasser u. natürlich auch dem Eis bei Hochwasser zugänglich war. Dieses Grasland war den mennonitischen Holländern zur Nutzung im 17. Jahrhundert abgetreten worden, die sich allmählig nahe an der Nogat einen neuen Damm bauten, um sich wenigstens vor Sommerhochwasser zu schützen. An diesen Damm bauten die Holländer dann ihre Höfe u. zwar schon in Anlehnung an den Damm so hoch, daß sie, bei normalem Hochwasser in ihren Gebäuden geschützt waren. Als dieser neue Damm an der Nogat aber immer höher u. stärker gemacht wurde, griff die Regierung ein u. baute in den neuen Nogatdamm 3 sogenannte Überfälle ein, etwa 100 m. breite Öffnungen, die fortan von der Regierung in jedem Jahr, nach dem Abfließen von Wasser u. Eis, geschlossen wurden u. im Herbst vor Winter wieder aufgemacht wurden. Das war auch 1887 im Herbst geschehen, und durch diese Überfälle zog nun auch im März 1888 Wasser u. Eis in die Einlage u. füllte dieselbe in kurzer Zeit, bis fast zur Dammhöhe an. Die Einl[ä]ger Bauern mußten seit Menschengedenken zum erstenmal mit ihrem Vieh auf den Damm fliehen, wobei auch viel Vieh ertrunken ist. Dieser ganz ungewöhnliche Vorgang, daß sich der Frühjahrseisgang 1888 ausschließlich durch die Nogat abspielen mußte, brachte die Dämme der Nogat am großen Werder entlang natürlich in schwere Gefahr, die sich an 3 Stellen besonders bedrohlich auswirkte u. zwar am sogenannten Koll, einer Wachbude am Werderdamm, neben der Einlage, bei Halbstadt u. Kalthof.
Die ersten beiden Stellen lagen in dem Befehlsbereich des damaligen Deichgeschworenen, späteren Deichhauptmanns Vollerthun Fürstenau. Aus der Verteidigung des Werderdammes am Koll sind mir einige recht drastische Redensarten der bedrohten Bewohner u. des Deichgeschworenen in der Erinnerung geblieben:
Die Schwiegermutter unseres Schmiedemeisters in Irrgang wohnte am Koll und der Schwiegersohn in Irrgang u. seine Frau waren natürlich in Sorge um die Mutter. Der Meister bat also meinen Vater um Fuhrwerk, damit er seine Schwiegermutter zu sich nach Irrgang holen könne. Er kam aber unverrichteter Dinge zurück. Die resolute Mama hatte ihn mit den Worten abgefertigt: „ Beschiet ju man nich wegen dem bät Woater!“ [Bescheiß dich man nicht wegen dem bisschen Wasser!]
Deichgeschworener u. Deichinspektor Götter, der heftig stotterte, besonders, wenn er erregt war, hatten Hunger bei der Arbeit am Damm bekommen u. baten die Wachbüdnerin um ein bis’chen Mittagessen. Die Frau lehnte ab, sie habe nichts für die Herren. Vollerthun drängte aber weiter, eine Kleinigkeit werde sie schon haben. Darauf die Wachbüdnerin in ihrem gewohnten Plattdeutsch: „Eck kann änne bloß Kielke mött Speck gewe!“ Darauf Vollerthun: Oawer Fru, dat es doch en schönet Ete, dat gewe Se onns man.“ Darauf Götter ganz empört: „K. K. Keilchen freß ich aber nicht“! [„Ich kann Ihnen bloß Keilchen mit Speck geben. – Aber Frau, das ist doch ein schönes Essen, das geben Sie uns nur.“]
Inzwischen hatte sich bei Halbstadt ein neuer Gefahrenherd aufgetan. Am Sonntag (Palmsonntag) den 25. März kam mit großer Gewalt das Eis u. Wasser aus den großen Nebenflüssen der Weichsel – Bug u. Narew – herunter. Und die Verstopfung der Weichsel konnte nicht beseitigt werden. Da war denn eine Katastrophe unvermeidlich. Das bisherige Weichseleis hatte die Einlage aufgenommen u. war nun bis zum Rande gefüllt u. die untere Nogat ebenfalls total verstopft. Also mußte sich das neue Hochwasser u. sein mitgeführtes Eis nach einer oder der anderen Seite einen Weg bahnen. Aber welches würde die betr. Seite sein? Bei Halbstadt war eine schlechte Stelle im Damm, aber sie wurde von entschlossenen Männern aus dem großen Werder mit Einsatz ihres Lebens verteidigt.
Tag u. Nacht wurde gearbeitet. Tausende von Sandsäcken wurden in die schlechte Stelle geworfen u. lange Balken zur Verhütung des weiteren Abbröckelns des Deiches ins Wasser geschoben. In welcher Kampfstimmung die Menschen am Damm in Halbstadt in ständiger Lebensgefahr arbeiteten, illustriert der Ausspruch eines polnischen Arbeiters, der über Winter im Werder geblieben war u. nun unverhofft zu dieser wässrigen Arbeit herangezogen wurde. Er schildert die gefährliche Arbeit ganz richtig u. als seine Kameraden ihn fragten, weshalb er denn nicht davongegangen wäre, gab er die Antwort: „Die hätten mich sofort in die Nogat geworfen!“ Unterdessen lief das Wasser von Halbstadt bis Wernersdorf, also etwa 20 klm über den Damm. Das geschah nicht in ununterbrochener Welle, sondern in Abständen von 50-100 m. In den Zwischenräumen hatten sich meterdicke Eisschollen auf den Damm geschoben u. bildeten so eine Erhöhung der Dämme. Vielfach rollten die schweren Eisschollen auch über die Dämme hinweg und machten den Verkehr auf den am Damm entlang führenden Wegen zu einer gefährlichen Angelegenheit.
Ein kleines Stimmungsbild sei hier eingefügt:
In Schadwalde lebte der Bauer Hahn, der seinen Hof unmittelbar am Nogatdamm hatte. Einer seiner Söhne war Arzt geworden u. hatte sich mit einem Frl. Friedrich aus dem benachbarten Blumstein verlobt. Am Sonntag d. 25. März folgte das junge Paar einer Einladung nach Schadwalde u. hoffte dort ein gemütliches Kaffeestündchen zu verleben. Aber das Wasser der Nogat stieg immer höher u. als erst anfingen, meterdicke Eisschollen über den Damm u. vor Vaters Haustür zu kollern, da hörte sich die Gemütlichkeit auf u. das junge Paar floh entsetzt nach Blumstein. Da war es aber auch nicht besser.
Mein Vater schickte mich u. meine Brüder Hans u. Otto mit einem Einspännerschlitten nach Schadwalde, um nachzusehen, wie es am Damm aussehe. Als wir bei schönstem Sonnenschein u. wenig Frost hinter Gr. Lesewitz den Blick auf den etwa 5 klm. entfernten Nogatdamm frei bekamen, sahen wir an diesem Damm 2 sonderbare Erscheinungen.
1. stand offenbar ein zweimastiges Schiff auf dem Nogatdamm
2. waren in die Schneedecke des Nogatdammes in Abständen von etwa 50 m scheinbar Gänge bis auf den kahlen schwarzen Grund geschaufelt.
Beide Erscheinungen konnten wir uns zunächst nicht erklären. Diese Erklärung brachten uns aber bald die flüchtenden Eiswachtleute aus Gr. Lesewitz, denen wir kurz vor Schadwalde begegneten. Sie hatten auf Befehl ihres Oberregenten Döhring ihren Posten am Damm verlassen, weil angeblich ein Dammbruch nicht mehr zu vermeiden war u. sie sich in Sicherheit bringen wollten. Das war das Gegenstück zu Halbstadt u. Kalthof, worauf ich noch zu sprechen komme.
Die beiden unerklärlichen Bilder waren nun leicht zu erklären. Da das Wasser fast höher stand, wie die Dämme, so war das Schiff zwar nicht auf den Damm getrieben, aber doch bis hart an die Dammkrone u. die schwarzen Streifen hatte das überlaufende Wasser in die Schneedecke gerissen.
Bei der Begegnung mit der Gr. Lesewitzer flüchtenden Eiswache mußten wir natürlich seitwärts in ein Feld fahren, um nicht in dem hohen Schnee überrannt zu werden. Neben uns hielt der, mir gut bekannte, 70jährige Gastwirt Jantzen aus Gr. Lesewitz, der ebenfalls auf dem Wege nach Schadwalde [war] u. fragte noch einmal seine Nachbarn unter den Flüchtlingen, was denn eigentlich los sei. Sie riefen ihm im vorbeifahren zu: Das Wasser hat angefangen über den Damm zu laufen u. es ist nichts mehr zu machen. Darauf schimpfte der alte Herr in seiner plattdeutschen Mundart. „Ess dat ne Oart, doarvon te renne, wenn dat woater anfangt, äwer den Damm to renne! An de acht onvörtig ess dat Woater 2 Daag lang äwer de Damm gerennt, on wi hebbe den Damm doch gehole!“ [Ist das eine Art, davon zu rennen, wenn das Wasser anfängt, über den Damm zu rennen! in achtundvierzig ist das Wasser zwei Tage lang über den Damm gerannt, und wir haben den Damm doch gehalten.]
Aber wir machten nun doch kehrt u. fuhren nach Hause. Als wir so gegen 4 Uhr ankamen, war Vater soeben von Kalthof zurückgekehrt, wohin er bald nach Mittag mit meinem Vetter u. Nachbar in Irrgang Bernhard Penner gefahren war. Es waren nämlich inzwischen bedrohliche Nachrichten aus Kalthof gekommen, und da Bernhard Penner’s Mutter in Kalthof wohnte, war er natürlich sehr besorgt um die Mutter.
Vater sagte also bei seiner Rückkehr aus Kalthof: Die Gefahr in Kalthof ist zwar noch nicht vorbei, aber es ist Aussicht, daß sich unsere Lage nun bald bessern wird. In der Jonasdorfer Feldmark ist der Damm der rechtseitigen Nogatniederung gebrochen und die Eisverstopfung in der Weichsel hat sich auch gelöst, so daß der Wasserdruck bald nachlassen wird. Aber augenblicklich ist noch angestrengteste Arbeit in Kalthof erforderlich. Und nun Jungens, fuhr Vater fort, fahrt sofort mit eurem Schlitten nach Kaminke an den Nogatdamm u. geht auf den Damm, da werdet ihr ein Schauspiel erleben, wie es euch in eurem Leben wahrscheinlich nicht mehr geboten werden wird. Und dann fahrt nach Kalthof, wo noch immer verzweifelt am Schlöpploch gearbeitet wird – Das Schlöpploch (Schlüpfloch) war ein etwa 2 m tiefer u. 5 m breiter Einschnitt in den Nogatdamm, der den Fuhrwerkverkehr über die Pontonbrücke auf der Nogat erleichtern sollte. Im Notfall, der seit Menschengedenken noch nie eingetreten war, sollte diese schwache Stelle mit Sandsäcken u. Dung verstopft werden. –
Wir fuhren also zunächst bis an den Damm in Kaminke u. kletterten hinauf. Da blieb uns allerdings fast der Atem weg. In der vollen Höhe des etwa 6-7m hohen Deiches eine unabsehbare Fläche von zusammengeschobenen meterdicken Eistafeln in starrer Ruhe; nichts bewegte sich, es war auch kein Laut zu hören. Uns wurde unheimlich bei dem Gedanken, daß nur der schmale Damm uns u. unsere Heimat vor den Wasserfluten bewahrte, die in 7 m. Höhe neben uns standen. Als wir noch in solchen Betrachtungen auf dem Damm standen, kamen noch 2 alte Bauern aus Tannsee den Damm heraufgeklettert. Ich hörte von ihnen nur die Worte: „Na joah, de Komm es voll, et kann geläpelt ware!“ [Na ja, die Schüssel ist voll. Es kann gelöffelt werden!“]
Wir fuhren dann nach Kalthof u. gingen auf dem Damm entlang bis zu dem Schlöpploch. Da wurden ununterbrochen gefüllte Sandsäcke angefahren, das Wasser quoll unaufhörlich durch den, doch recht schmalen, aus Sandsäcken gebildeten Notdamm, der alte, damals schon über 60 Jahre alte Deichgeschworene Theodor Tornier Tragheim stand bis an die halben Waden im Wasser u. ordnete die Verlegung der Sandsäcke an. Der alte Herr war schon ganz heiser vom Reden u. wohl auch von Erkältung, aber die bestimmte Aussicht, daß nach einigen Stunden der Wasserdruck nachlassen würde, hielt die Menschen aufrecht. Ehre den beiden Deichgeschworenen Vollerthun u. Tornier!!
Wie das in Kalthof einige Stunden früher ausgesehen hatte, das schilderten uns einige Kalthöfer Einwohner: Am Vormittag sei soviel Wasser durch das Schlöpploch gekommen, daß meterdicke Eisschollen mit hindurch gekommen u. von dem nachstürzenden Wasser durch die Straßen des Dorfes geschoben wurden. Da sei alles entsetzt über die Eisenbahnbrücke nach Marienburg geflohen. Auch wir drei Brüder gingen noch über die Brücke, um uns den Wasserstand in Marienburg anzusehen. Von der Eisenbahnbrücke aus hatten wir den besten Überblick über das, jenseits der Nogat gelegene Sandhöfer Land, das nicht eingedeicht war, aber so hoch lag, daß es bei normalem Hochwasser nicht überflutet wurde. Aber dieses Hochwasser war weit über normal u. bisher überhaupt noch nie dagewesen. Es hatte das ganze Sandhöfer Land bis an die Staatschaussee Marienburg-Elbing überschwemmt u. ebenfalls mit einer dichten Decke von Eisschollen überzogen. Daher auch die scheinbar unübersehbare Eisfläche, die uns vom Damm in Kaminke aus aufgefallen war. In Marienburg konnten wir nur bis zum Friedrichdenkmal kommen, das noch im Wasser stand u. an dessen Gitterstäben wir feststellen konnten, daß das Wasser schon 30-40 cm. gefallen war. In der oberen Nogat konnte man die einmalige Feststellung machen, daß ein Strom im gegebenen Fall auch mal rückwärts, also gegen den Berg fliessen kann. Das geschah nämlich, als die Eisversetzung in der Weichsel, von der ich schon mehrfach gesprochen habe, abtrieb u. sich um das angestaute Weichsel u. Nogatwasser in das viel tiefer gelegene leere Flußbett der Weichsel stürzte.
Als wir dann Abends nach Hause kamen, konnten wir mit Befriedigung feststellen, daß wir einen ereignisreichen Tag erlebt hatten, den Palmsonntag 1888. Am nächsten Tage bekam ich dann von meinem Vater den Auftrag, nach Halbstadt zu reiten u. mir die Stelle anzusehen, an der unsere Mannschaft unter Vollerthun so tapfer um die Erhaltung unseres Dammes gekämpft hatte u. gleichzeitig über den Eindruck zu berichten, den ich von dem genau gegenüberliegenden Dammbruch u. dem Schicksal der drei Höfe Arndt, Krüger u. Soenke gewonnen hätte. Auch dieses war ein bleibender Eindruck: Der Damm an unserer Seite zur Hälfte auf einer Strecke von etwa 200 m. verschwunden u. in den Strom gerutscht. Gehalten hatte nur noch die Landseite des Dammes, die auf etwa 2 m Tiefe gefroren war u. die Verteidigungsarbeiten Vollerthuns zweifellos kräftig unterstützt hatte. Im Strom stand eine 8-10 m. hohe Eismauer über die ganze Breite des Stroms. Sie diente in den nächsten Tagen wagehalsigen Fischern aus Halbstadt, mit ihren Booten überzusetzen und den fraglos in einem massiven Bauernhaus eingeschlossenen Menschen Hilfe zu bringen. Aber an diesem Tage, dem 26. März war dieses noch nicht möglich, der starken Strömung wegen.
Auf dem Damm hatten sich einige Menschen eingefunden, darunter auch, tränenden Auges, unser Nachbar Arndt aus Ladekopp, der Bruder des Arndt aus Jonasdorf, dessen Hof mit dem Hof des Krüger in den Fluten verschwunden war. Von dem Hofe des Soenke war noch ein massiver Stall u. ein massives Wohnhaus zu erkennen, in dem fraglos noch Menschen hausten. Das bewies die große weiße Flagge auf dem Wohnhause. Aber ob sich die Menschen alle in dieses Haus gerettet hatten, konnte an diesem Tage noch nicht festgestellt werden. Aber nach einigen Tagen erfuhren wir, daß die Menschen sämtlich gerettet, das Vieh aber alles umgekommen sei.
Ich bin im Laufe des Sommers 88 noch einigemale in Halbstadt u. Jonasdorf gewesen, habe zugesehen, wie die Senkstücke aus Strauch, mit Steinen beschwert, genau auf der Stelle versenkt wurden, wo der frühere Damm gestanden hatte u. habe dabei auch das Material bewundern können, aus dem der weggerissene Damm bestanden hatte. Es war durch u. durch reiner Lehm, wie an den beiden Bruchstellen leicht zu erkennen. Wenn man sich dagegen den Damm an unserer Seite ansah, dessen Kern aus reinem Sand bestand, der nur mit einer starken Lehmdecke umhüllt war, dann konnte man etwas nachdenklich werden. Bei diesen Besuchen an der Bruchstelle, bin ich auch ein paarmal zu dem Soenke’schen Gehöft gegangen.
Von den beiden andern Höfen (Arndt u. Krüger) war nichts mehr zu sehen; von dem Soenke’schen Gehöft war der massive Stall u. das massive Wohnhaus stehen geblieben u. sonderbarer Weise, auch der große Strohhaufen. Im Stall fehlten alle Türen u. Fenster und er war mit einer 1 m. hohen Sandschicht angefüllt, aus der noch stellenweise die Köpfe ertrunkener Rinder herausragten. Das Wohnhaus war nur teilweise unterkellert gewesen. Das war die Rettung für die Menschen geworden, die darin Zuflucht gesucht hatten. Soweit der Keller reichte, war der untere Teil des Hauses eingestürzt. Der andere Wohnhausteil war verhältnismässig wenig beschädigt. Die Gebäude wurden später zu einer Försterei ausgebaut.
Als ich Abends nach Hause kam, erklärte mir mein lieber Vater: Nachdem ich in den letzten 2 Tagen bewiesen hätte, daß ich von meinem Gelenkrheumatismus vollständig auskuriert sei, habe ich von morgen ab wieder meine Obliegenheiten in der Landwirtschaft zu übernehmen. Diese Obliegenheiten hatte in den letzten 2 Monaten mein Bruder Peter übernommen, der im Herbst 1887 mit dem Einjährigenzeugnis von der Landwirtschaftsschule Marienburg entlassen war u. zum 1.4.1888 eine Lehrstelle auf dem Gut Bublitz in Pommern antreten sollte. Ich habe dann in den nächsten Wochen auch noch Eiswachdienst an Stelle meines Bruders Peter gemacht, aber die Gefahr war ja vorüber u. die Mannschaften u. Pferde wurden nach Hause geschickt, nur einige Leute mußten ständig am Damm sein, um Boten bei kritischen Veränderungen zur Stelle zu haben. Die Wachbude für Irrgang u. Brodsack lag etwa auf der Mitte der Strecke zwischen Blumstein u. Schadwalde u. wurde von der Ww. Butschke bewohnt, bei der ich sogleich bei meinem ersten Erscheinen in Ungnade fiel. Der Unterschied zwischen meinem Bruder Peter u. mir war auch zu beträchtlich. Peter konnte singen u. wußte eine Menge Schlager u. Complets auswendig u. wenn Peter sang, versammelte sich bald eine größere Zuhörerschar um ihn, die auch reichlich verzehrten u. gleichzeitig für Peters Durst mit sorgten. Mit all diesen Vorzügen konnte ich nicht aufwarten u. so waren die Eiswachtage ziemlich einförmig.
Peter rüstete nun für seine Abreise nach Bublitz u. Hans für seine Abreise nach Tiegenhof, wo er am 1.4.88 bei dem Materialwarenkaufmann Peter Fröse in die Lehre treten sollte. Die Rüstungssorgen für beide Brüder lagen allerdings wohl hauptsächlich bei unsrer lieben Mutter, die zum erstenmal 2 Kinder von ihren 8 aus dem Hause geben sollte. Beide Brüder haben ein tragisches Schicksal gehabt, wenn auch in ganz verschiedener Form. Peter starb mit 57 Jahren freiwillig in Grünblum in Ostpr., familiär u. wirtschaftlich gestrandet. Hans als hochangesehener Kaufmann mit 51 Jahren in Marienburg am Schlaganfall.
In der letzten Märzwoche u. Anfangs April taute dann der viele Schnee des vergangenen Winters auf u. gab viel Wasser, das zunächst nicht abziehen konnte, weil alle Durchlässe mit Schnee u. Eis verstopft waren. Es hatten sich förmliche Seen auf unsern Feldern gebildet, als um den 9.4. noch einmal der Winter mit einem Schneesturm einsetzte, wie in den schlimmsten Februartagen. Unser Garten war an der einen Seite von einer 2 m hohen Dornenhecke begrenzt. Der Schneesturm wehte den Garten bis zur Höhe des Dornenzaunes voll Schnee, u. hinter dem Zaun stand im Windschutz Freund Adebar und fror u. hungerte erbärmlich. Unsere Köchin hat ihn dann durch Keilchen am Leben erhalten. Und die großen Wasserlachen auf den Feldern waren so fest zugefroren, daß man Schlittschuh darauf laufen konnte. Aber damit hatte sich der Winter nun endlich ausgetobt. Die Felder tauten nun schnell ab, u. Mitte April ordnete Vater an, daß das große Ruderboot, das seit 30 Jahren unbenutzt auf dem Schweinestallboden gelegen hatte, hervorgeholt u. ordentlich abgedichtet u. geteert wurde für eine Fahrt im Überschwemmungsgebiet des kleinen Marienburger Werders.
Eine Ruderbootsfahrt auf dem Überschwemmungswasser von Altfelde über Ellerwald nach Elbing u. zurück.
In Ellerwald 1. Trift, wohnte ein altes kinderloses Ehepaar Heinrich Suckau u. Frau. Letztere war ein spätgeborenes Kind ihrer Eltern, früh Waise geworden, u. im Hause meines Großvaters Isbrand Wiebe in Herrenhagen, zusammen mit seinen ältesten Kindern, mit denen sie etwa gleichaltrig war, aufgezogen. Am 25. März 1886 hatten wir dort in Ellerwald sehr vergnügt die Silberhochzeit des alten Paares gefeiert. An diesem 25. März 1886 war die Schlittenbahn so gut, daß wir ohne Hindernisse per Schlitten nach Ellerwald fahren u. auf einer längeren Strecke noch die Bahn auf dem Nogateis benutzen konnten. Zu diesen Suckaus, von denen wir noch ein Pferd auf ein Jahr in Fütterung genommen hatten, wollten Vater u. ich, zusammen mit meinem Onkel Gerhard Wiebe Gr. Lesewitz u. seinen 2 Söhnen Rudolf u. Hermann fahren.
Dazu gehörte aber neben der Herrichtung eines ordentlichen Ruderbootes auch die Beschaffung einer landrätlichen Genehmigung, ohne die Niemand befugt war, die große Wasserfläche zu befahren. Das war ein Schutz gegen Seeräuberei, der ständig von patrouillierenden Polizeibooten überwacht wurde.
An einem milden stillen Frühlingstage, Mitte April, war es soweit. Das Ruderboot war schon am Tage zuvor auf einen Arbeitswagen gesetzt u. gut befestigt, Proviant für Menschen u. 4 Pferde auf 2 Tage wurde mitgenommen, auch 2 kräftige Männer zum rudern. Dann setzten Vater u. ich nebst den 2 Ruderleuten uns in den Kahn u. fuhren guten Mutes nach Gr. Lesewitz, um unsere Verwandten abzuholen. Dann ging es in schlankem Trab über Marienburg nach Altfelde. Da das Überschwemmungswasser schon etwas gefallen war, war Altfelde schon wasserfrei u. wir konnten uns im dortigen Gasthaus Quartier für die Pferde u. den Kutscher bestellen, falls wir an demselben Tage nicht zurückkommen sollten. Der Kutscher fuhr uns dann noch etwa 1 klm. zum Dorf hinaus, wo wir schon soviel Wasser vorfanden, um unser, vom Wagen gehobenes Boot flott machen zu können. Dann befahl der Lesewitzer Ohm: „Nun laßt all schlechten Winde fliegen u. dann steigt ein.“ Das taten wir denn auch, das Steuer hatte sich aber Vater vorbehalten, der aus den wiederholten Überschwemmungen in Ladekopp, in seiner Jugendzeit fraglos auch die meisten Erfahrungen mit der Bootsfahrt hatte. Nach kurzer Fahrt kam das erste Hindernis in Sicht. Es war ein Wall, der quer zu unserer Fahrtrichtung verlief. Der Wall war allerdings noch mit Wasser bedeckt, aber aus dem gekräuselten unruhigen Wasser erkannte mein Vater schon aus einiger Entfernung, daß dort ein Hindernis im Wasser liegen müsse. Er suchte sich also eine Stelle aus, wo das Wasser einigermassen ruhig war u. bevor wir uns recht versahen, waren wir mit einigem rütteln des Bootes über das Hindernis hinweg gekommen. Dann kamen wir bald in tieferes Wasser u. haben auf dem Hinwege auch keine Hindernisse mehr angetroffen. Die Ruderarbeit besorgten unsere 2 Männer u. abwechselnd einer von uns 3 Vettern, die wir auch die Männer ab u. zu ablösten. wwWir konnten uns nun ganz der Betrachtung des einzigartigen Bildes widmen, das sich den ganzen Tag in wechselnder Form darbot. An einer Stelle wurde aus einer Scheune Heu geholt. Ein Prahm, ähnlich einer Weichselfähre, war auf eine etwa 1 ½ m. unter Wasser stehende Tenne gefahren u. lud aus dem Scheunenfach Heu auf, das zur Fütterung von gerettetem u. auf der unweit gelegenen Höhe untergebrachtem Vieh dienen sollte. Als wir dann nach Ellerwald kamen, sahen wir zu unserem Erstaunen, daß viele kleine Häuser zwar im Dach den Einschnitt aufwiesen, in dem normalerweise ein Schorn [?] stehen müßte, aber von einem Schornstein war nichts zu sehen. Schließlich belehrte uns Vater, daß die Erbauer dieser Häuser aus Sparsamkeitsgründen ihre Schornsteine aus ungebrannten Lehmziegeln gebaut hätten, daß diese Patzenschornsteine, wie man ungebrannte Ziegel auch nannte, im trockenen Raum auch gerade so gut hielten, wie gebrannte Steine; daß sie aber im Wasser sofort aufweichen. Das war denn hier auch ausnahmslos geschehen. Bald darauf kamen wir an einen Hof, der so hoch lag, daß die Bewohner in ihren Wohnzimmern geblieben waren, das war bei Klaaßen Ellerwald 1. Trift. Dort machten wir die erste Station u. wurden freundschaftlich begrüßt u. bewirtet. Da nicht allein der Hof, sondern auch die nähere Umgebung besonders hoch lagen, so hatte sich ein ganzes Holzfeld um den Hof angesammelt – Reste von zerstörten Gebäuden. Nun hatten wir nur noch eine kurze Strecke bis zu unserm ersten Reiseziel Suckau Ellerwald, wo wir von der Tante u. einer ihrer Nichten freudigst begrüßt wurden. Der Onkel war allerdings nicht zu Hause; er war zum Glas Grog nach Elbing gefahren (mit Boot natürlich). Dieser Hof lag zwar auch noch an der ersten Trift, die ihre Höfe durchweg auf einem Hochrücken aufgebaut hatten, der früher wohl einmal ein Nogatdamm gewesen sein mag. Aber der Suckau’sche Hof lag doch etwa 1 m. niedriger wie der Klaaßen’sche, den wir soeben verlassen hatten. Man mag über den geringen Höhenunterschied wohl lächeln, aber wenn man soeben erlebt hat, welcher Unterschied durch diese geringe Höhendifferenz geschaffen werden kann, der wird nicht mehr darüber lächeln. Bei Klaaßen hatten Menschen u. Tiere in ihren Räumen bleiben können, bei Suckau standen 60 cm Wasser in den Wohnräumen u. auch im Stall. Da waren die Menschen schleunigst in das Oberstübchen geflüchtet u. die Tiere waren auf dem Stallboden untergebracht. Wer aber glaubte, daß die Menschen von ihrem Schicksal sehr niedergedrückt gewesen wären, der war sehr im Irrtum. Nachdem wir das freundlichst angebotene Mittagessen eingenommen hatten, baten wir die Tante, uns etwas aus ihren Erlebnissen der letzten 3 Wochen zu erzählen. Sie schilderte nun, wie sie am Palmsonntag Nachmittag die Nachricht vom Dammbruch bei Jonasdorf erhalten hätten, wäre der Onkel Suckau sofort nach Elbing gefahren u. hatte einen Zimmermeister dafür gewonnen, daß er am Montag sofort mit allen Leuten u. dem notwendigen Material auf den Suckau’schen Hof kommen würde, um den, inzwischen abgeräumten, Stallboden mit einer kräftigen neuen Holzdecke zu versehen, eine Treppe für Mensch u. Tiere bauen u. etwa notwendige Verstärkungen im Stall auszuführen. Denn es waren recht alte Gebäude, alles unter Strohdach, um die es sich handelte. Inzwischen hatte sich das Wasser um den Hof gesammelt u. stieg immer höher, so daß das Vieh schon im Wasser stand, als die neue Treppe u. der obere Stallbodenraum zur Benutzung freigegeben werden konnten. Dann stellte sich ein neuer Hinderungsgrund ein. Das Rindvieh war störrisch u. wollte nicht die Treppe hinaufsteigen. Aber schließlich bekamen sie die Tiere doch allmählig nach oben. Nur eine Kuh wäre besonders widerspänstig gewesen u. daher bis zuletzt zurückgestellt worden. Aber als sie erst bis zum Knie im Wasser stand u. ihr das Euter naß wurde, gab sie ihren Widerstand auf. Sie hätten dann, so erzählte die Tante weiter, einige Wochen ganz ruhig in ihren Räumen gehaust, nur an den Tagen um den 9. April, als der letzte Schneesturm über unsere Felder brauste, da hätten die Wellen so heftig gegen die alte Stallwand geschlagen, u. mitunter auch noch Eisschollen u. Treibholz, da hatten sie Angst bekommen, aber es wäre ihnen doch weiter nichts passiert. Sie hätten auch oft Besuch von Polizeibooten gehabt, die ihnen in ihrer Hilfsbereitschaft anfänglich immer anboten, Sachen aus Elbing mitzubringen, die sie gerade benötigten. Suckau’s hatten aber immer abgelehnt, sie hätten ja alles, was sie brauchten; schließlich hatten sie aber doch zwei Flaschen Petroleum in Auftrag gegeben. Nach 1-2 Stunden kam das Boot wieder vorbei, nachdem es die ganze Trift abgeklappert haben, u. der Führer rief wütend hinauf: „Das ganze Dorf haben wir besucht, aber kein Mensch braucht was, da werden wir wegen Ihrer 2 Flaschen Petroleum nicht extra herauskommen.“ So kann man sich mit seiner Bedürfnislosigkeit die Gunst der Obrigkeit verschertzen.
Inzwischen war die Mittagspause vergangen u. Tante Suckau führte uns durch das Haus u. den Stall auf den Stallboden – den improvisierten Viehstall. Als uns die Tante voraus schritt, die Treppe hinauf u. der Lesewitzer Onkel ihr unmittelbar folgte, konnte er sich nicht bezähmen u. kniff die alte Dame ein bis’chen in die Waden, worauf die Tante mit einem halb ärgerlichen u. halb vergnügten Quiken reagierte. – Erinnerung an die gemeinsam verlebte Jugendzeit. Auf dem Stallboden standen nun etwa 15 Rinder, gut aufgehoben unter dem dicken Strohdach, Schweine u. Pferde habe ich nicht gesehen. Unten im Stall u. in den Wohnzimmern stand das Wasser nur noch ganz flach, so daß man auf etwas erhöhten Brettern trockenen Fußes durch die Räume gehen konnte. Aber die Holzflur war überall aufgetrieben u. lag wirr durcheinander herum. Wir verabschiedeten uns dann von unsern freundlichen Gastgebern u. fuhren nach Elbing, da wir doch auch den Onkel Suckau sehen u. begrüßen wollten. Auf der Fahrt dahin kamen wir nun auch in den tiefer gelegenen Teil Ellerwalds, wo das Wasser 3-4 m. tief war u. die Häuser fast alle ihre Schornsteine eingebüßt hatten, wie ich das schon vorhin geschildert habe. Hier war Vorsicht des Steuermannes besonders notwendig, weil die abgeköpften Weiden oft nicht aus dem Wasser herausragten, also schlecht zu sehen waren. Wenn man auf solchen Weidenbaum auffuhr, war ein umkippen kaum zu vermeiden. Die ungeköpften Weiden, die wenigstens mit ihrem Strauch aus den Fluten herausragten, waren keine Gefahr.
In Elbing im Gasthof zur Hoffnung, an dem wir mit unserm Boot glatt vorfahren konnten, fanden wir dann den alten Suckau, behaglich bei einem Glas Grog sitzend. Er konnte uns aber auch, nachdem wir von Tante Suckau unterrichtet waren, wenig neues berichten. Der Lesewitzer Ohm ging noch in die Stadt Elbing, um seinen Sohn Hugo zu besuchen, der in einer Brauerei in der Lehre war. Als er zurückkam, machten wir uns sofort auf den Heimweg, der in etwa 4-5 Stunden ohne Zwischenstation zurückgelegt wurde. Wir jungen Leute hätten ganz gerne eine Nacht irgendwo im Heu zugebracht, aber die alten Herren drängten nach Hause. Es war inzwischen dunkel geworden und wenn es auf dem Wasser auch nicht so finster wird, wie auf dem Lande, so konnten wir, als wir an den Wall kamen, dessen Überquerung uns schon auf dem Hinwege etwas Schwierigkeiten gemacht hatte, die Stelle nicht finden, die uns auf dem Hinweg über den Wall hinweggeholfen hatte. Bei den Versuchen, über den Wall hinweg zu kommen, hatten wir uns auch mehreremale festgefahren u. das Wasser drohte an der vorderen Bootspitze, dem Bug, in das Boot zu spritzen, so daß wir uns schleunigst wieder von dem Wall herunterschoben. Diese mehrfachen vergeblichen Versuche hatten unsere Rudersleute, die ebensowenig wie wir zünftige Seefahrer waren, schon etwas nervös gemacht, und als wir dann noch beim Suchen nach einer Stelle, wo wir über den Wall hinwegkommen könnten, an der sogenannten alten Posthalterei Fischau unter die Trümmer dieser Posthalterei gerieten u. die losen Balken über unsren Köpfen baumelten, versuchten sie auszusteigen. Aber glücklicherweise war das Wasser so tief, daß sie es doch nicht wagten u. da entdeckten wir auch, daß wir ganz nahe an der Staatschaussee Marienburg-Elbing waren u. daß diese Chaussee nur ganz flach mit Wasser bedeckt war u. daß der lästige Wall nur bis an die Chaussee reichte und wir unser Boot nur etwa 30 m auf der Chaussee entlang zu schurren brauchten, um hinter dem Wall wieder auf das nötige Wasser zu kommen, das ein Boot fahren möglich machte. Das geschah denn auch u. nach einer weiteren Bootfahrt waren wir an der Stelle angelangt, von der wir morgens abgefahren waren. Ich mußte gleich an den Spruch meines Lesewitzer Onkels denken, mit dem er uns zum einsteigen aufforderte. Aber alle schlechten Lüfte waren damals sicher nicht an Land zurückgeblieben, das hatten wir an der kritischen Stelle an der zerstörten Posthalterei deutlich merken können. Nachdem wir das Boot auf das Land geschleppt hatten, gingen die beiden alten Herren zu Fuß nach Altfelde u. schickten uns den Wagen, auf dem wir dann das Boot verluden u. unsere alten Herren im Gasthaus Altfelde abholten u. sehr befriedigt, aber auch sehr müde heimwärts fuhren.
Kap. X
Auf besonderen Wunsch meiner Tochter Else will ich noch etwas über Vaters u. der beiden Großväter Wirtschaftsweise u. ihre Erfolge daraus berichten.
Aber während ich von dem Wirken meines Vaters u. Schwiegervaters, die beide vor mehr als 50 Jahren starben, den notwendigen Abstand habe, um wenigstens einigermaßen objektiv urteilen zu können, erscheint mir eine Beurteilung der eigenen werten Person u. des eigenen Wirkens doch recht gewagt. Ich will mich bemühen, streng bei der Wahrheit zu bleiben, aber auch das ist nicht leicht, angesichts der zwei langen Kriege u. ihrer Folgeerscheinungen, die hinter uns liegen.
Mein Vater Peter Wiebe, geb. 9.11.1825 in Ladekopp, gest. 22.2.1899 in Irrgang
Als mein Vater am 9.11.25 als ältester Sohn meines Großvaters Peter Wiebe geboren wurde, da erlebte die Landwirtschaft meiner Heimat wohl die schwerste Zeit des ganzen 19. Jahrhunderts. Mein Großvater hatte im Jahre 1816 den väterlichen Bauernhof von 35 ha Größe nach dem Tode seiner Eltern von den Geschwistern für 45 000 Mark übernommen u. gleich nach den Freiheitskriegen zunächst gute Jahre gehabt. Es war dasselbe Bild, das wir nach den beiden Weltkriegen auch erlebt haben. Und doch war es ganz anders. Das Papiergeld bestand noch nicht, und da wurde das gemünzte Geld, das nur in bescheidenem Masse vorhanden war, bald sehr wertvoll. Da konnte man sich für 70 Pf. ein Scheffel Gerste u. für 25 Pfennige ein Pfd. Butter kaufen. Und der Bauer lernte den Thaler wieder außerordentlich schätzen und es bildete sich bei den Bauern die Sparsamkeit aus, die bis zum Ende des 19ten Jahrhunderts anhielt und den Bauern, oft zu seinem Schaden, davon abhielt, mit dem ersparten Gelde notwendige und einträgliche Verbesserungen in der Wirtschaft vorzunehmen. Unter diesen Anschauungen hat auch mein Großvater sein Leben lang gewirtschaftet u. mein Vater auch.
Als mein Vater 14 Jahre alt war, starb seine Mutter u. ließ den Großvater mit 6 Kindern im Alter von 3 bis 21 Jahren zurück. Großvater hat auch nicht mehr geheiratet, wie es damals bei Witwern u. auch z.T. bei Witwen allgemein üblich war. Das haben ihm seine Kinder hoch angerechnet. Ob das für den Witwer u. seine 6 Kinder vorteilhaft war, wage ich zu bezweifeln. Es bildete sich doch recht bald ein sehr rauher Ton im Umgang der Familienmitglieder miteinander aus. Meinem Vater wurde dann noch, als große Seltenheit, der ½ jährige Besuch einer Art privater Fortbildungsschule in Tiegenhof genehmigt, die von einem, aus der Franzosenzeit hiergebliebenen, Franzosen Maner geleitet wurde, was ich schon unter dem Titel „Kulturelles“ geschildert habe.
Nach der Schulzeit trat er dann, wie allgemein üblich, bei seinem Vater in die Landwirtschaft ein. Meine Schwester Agathe, die bis zum Tode der Eltern bei ihnen blieb, erzählte mir nach Vaters Tode, daß er einmal geäußert hatte, daß er ungern Bauer geworden war u. lieber Kaufmann geworden wäre. Aber das gab es in den meisten Fällen nicht. Der Sohn mußte Bauer werden, wie der Vater, ganz gleich, ob er sich dazu eigne oder nicht. Manch schönes handwerkliches Talent ist dadurch verkümmert!
Wie einseitig landwirtschaftlich unsere holländer Bauernfamilien eingestellt waren, das konnte ich feststellen, als ich mich, besonders durch den Nationalsozialismus angeregt, intensiver mit Familienforschung beschäftigte. Drei Generationen vor mir sind mir genau bekannt, die Wurzeln meiner Familie reichen aber bis in das 17te Jahrhundert zurück. Aber da ist auch nicht ein einziges Mitglied zu entdecken, das nicht aus dem Bauernstande hergekommen wäre.
In diesen Kreis trat um 1840 mein Vater ein u. mag wohl in verhältnismäßig jungen Jahren schon eine gewisse Selbständigkeit erlangt haben, da Großvater Peter Wiebe im Nebenberuf auch Tierarzt war u. oft, auch nachts, irgendwo zur Hilfe gerufen wurde.
Großvater hatte zwar nie eine tierärztliche Schule besucht, aber natürliche Veranlagung u. Selbststudium hatte ihn darin befähigt, in seinen älteren Jahren ein Buch über Tierarzneikunde zu schreiben und in Druck zu geben, das am Schluß etwa folgende Widmung aufwies:
„Dieses Buch widme ich meinen vielen Freunden u. Bekannten aus der Zeit meines früheren Wirkens. Wenn es von ihnen mit Wohlwollen aufgenommen wird, dann würde ich mich freuen, wie der Araber vor seinem Zelt, wenn der Gast mit Wohlwollen von dannen geht!
Ladekopp 1856 Peter Wiebe“
Ein Exemplar dieser Buchausgabe stand auch in meinem Bücherschrank u. ist mit all den andern schönen Büchern verloren gegangen.
Großvater betonte auch in diesem Buche, daß er seine Tätigkeit bei Tierkrankheiten immer nur als Ersatz ansah u. daß möglichst bald der Tierarzt geholt werden mußte. Aber Tierärzte waren damals noch knapp u. außerdem war es in der langen Winterzeit, in der doch der Tierarzt am meisten gebraucht wurde, oft unmöglich, denselben zu holen.
Um 1850 begannen sich Vaters Altersgenossen u. Freunde selbständig zu machen u. sich zu verheiraten. Ich kann mir denken, daß auch er solche Absichten gehabt haben wird, aber es verging Jahr auf Jahr u. die beiden Brüder Peter u. Aron Wiebe trafen keine diesbezüglichen Anstalten u. wurden allmählig alte Junggesellen. In dieser langen Junggesellenzeit hatte sich Vater eine Werkstatt für den Bau von Pflügen eingerichtet. Sein diesbezügl. Rechnungsbuch ist mir ebenfalls verlorengegangen, aber es zeigte eine ganz stattliche Reihe von Kunden auf, denen im Gr. Werder Pflüge geliefert waren. Bei so einem einscharigen Pflug bestand eigentlich nur das Schar u. der Zughaken aus Eisen, alles andere war Holzarbeit, auch das Streichblech. Onkel Aron interessierte sich sehr für Maschinen, u. als ihm etwa 1860 der Großvater einen Göpeldreschsatz kaufte, mit dem er auch für Lohn drosch u. damit von Hof zu Hof fuhr, da hatte auch dieser alte Junggeselle seine Winterbeschäftigung.
Aber über diesem Treiben wurden besonders die Schwestern, die sich 1850 u. 52 verheiratet hatten, u. auch der Großvater unruhig u. drängten darauf, daß wenigstens Peter sich verheiraten u. den Hof übernehmen sollte; der Großvater war fast 80 Jahre alt. Und schließlich kam dann auch durch die Vermittlung des Großohms Behrends Siebenhuben am 30.10.1866 in Herrenhagen die Hochzeit meiner Eltern zustande. Es ist eine glückliche, mit 8 Kindern gesegnete Ehe geworden. Vater übernahm den Hof auch für 45 000 M., wie sein Vater 50 Jahre vorher.
Meine Eltern haben dann 17 Jahre in Ladekopp mit gutem wirtschaftlichem Erfolg gewirtschaftet und 33 000 Mark übergewirtschaftet. In die Wirtschaft war allerdings auch wenig hinein gesteckt worden und in die Ausbildung seiner vielen Kinder auch nicht. Neubauten wurden nicht vorgenommen, aber die alten Gebäude wurden doch immer wieder ausgebessert u. vor weiterem Verfall bewahrt. Ja, das Wohnhaus hatte sogar im Jahre 1876 ein hübsches rotes Pfannendach erhalten u. war auch im Innern etwas wohnlicher eingerichtet worden. Auch des lebende u. tote Inventar war durch Ankauf eines Zuchtbullkalbes u. einer Sämaschine etc. verbessert worden u. darin war er seinen Nachbarn sogar voraus. Aber vor größeren Investitionen nahm er sich sehr in acht. Auch in der Ausbildung seiner Kinder tat er etwas mehr, als seine Nachbarn, aber es wurde auch da immer alles aufs sparsamste eingerichtet. Wir waren 4 Brüder, von denen die ältesten 3 ab Ostern 1881 nach Tiegenhof in die Mittelschule geschickt wurden, aber nie ist einer von uns jemals deswegen in Pension gewesen. An den vier Tagen mit Nachmittagsunterricht gingen wir zur Frau Korella zum Mittagessen, pr. Person 30 Pfennige, machte für jeden Burschen 1,20 M. pr Woche aus. 1 ½ Jahre später siedelten wir zur benachbarten Frau Epp über. Da kostete die Pension schon 40 Pfennige, war aber auch erheblich schlechter. Meine Vorliebe für Fischsuppen hatte mir Frau Epp ganz ausgetrieben und es dauerte einige Jahre, bevor ich die Abneigung gegen Fischsuppen überwunden hatte. Für den 5-6 klm langen Weg zur Schule stand uns im Winter ein Einspänner zur Verfügung, den wir bei Barwick einstellten u. Abends wieder nach Hause fahren konnten. Aber im Sommer wurden wir nur ein Stück gefahren u. den übrigen Weg u. den ganzen Rückweg mußten wir zu Fuß machen. Das war bei großer Hitze, besonders für meinen erst 8 Jahre alten Bruder Hans, eine sehr anstrengende Aufgabe.
Als meine Eltern am 1.10.1883 nach Irrgang zogen, wurde das Ladekopper Grundstück, besonderer Umstände halber, nicht gleich verkauft, sondern erst am 1.4.1885. Ich war am 1.4.1884 auf Anordnung meines Vaters aus der Schule entlassen worden. Onkel Aron bewirtschaftete inzwischen den Ladekopper Hof u. hielt uns drei Tiegenhofer Schüler bei sich u. in dem Schulbesuch trat keine Änderung ein.
Die Schwestern erhielten in ähnlich billiger Weise ihre „erhöhte“ Bildung. Marie kam auf einige Jahre zum Onkel Wienz, meinem späteren Schwiegersohn, u. ging mit den beiden Cousinen Marie u. Helene Wienz zum Nachbar Schirrmacher, der eine Privatschule für seine Kinder eingerichtet u. ein Frl. Abramowski aus Marienwerder als Lehrerin engagiert hatte. Dort fand auch meine Schwester Marie Aufnahme. An Pension u. Schulgeld wird Vater recht wenig bezahlt haben. 1882 löste sich diese Privatschule auf. Die beiden älteren Cousinen Marie Wiebe u. Marie Wienz verliessen die Schule u. Helene kam mit meiner Schwester Agathe nach Herrenhagen zum Onkel Jacob Wiebe in Pension, der Lehrerin Frl. Abramowski nach Erledigung ihrer Aufgabe in Kl. Lesewitz für seine Kinder engagiert hatte. Meine damals beiden jüngsten Geschwister Otto u. Helene besuchten von Herbst 1880 ab die Privatschule beim Nachbarn Jacob Wiebe Irrgang. Otto besuchte dann von Ostern 1885 ab mit den Brüdern Peter u. Hans die Landwirtschaftsschule in derselben Weise, wie wir früher von Ladekopp aus die Schule in Tiegenhof, d.h. die Jungen gingen resp. fuhren jeden Tag zum Unterricht nach Marienburg u. waren bei der Pfarrerswitwe Corsepius [?] zum Mittagessen. Der dortige Pensionspreis ist mir nicht mehr in der Erinnerung, dürfte 50 Pf pro Portion auch wohl kaum überstiegen haben. Es war also den Kindern allen eine etwas über der Dorfschule liegende Bildung zu Teil geworden, mit verhältnismässig geringen Kosten. Es waren, in unseren Augen, verhältnismäßig geringe Mittel von Vater aufgewendet worden, sie lagen aber immer noch über dem Durchschnitt der Aufwendungen, die das Gros der Berufsgenossen seiner Zeit für ihre Kinder aufwandten. Und dafür sind wir ihm immer dankbar geblieben.
Im Jahre 1883 begann nun ein neuer Abschnitt für meine Eltern, die von einem 35 ha großen Hof auf einen 80 ha großen versetzt wurden. Meine Eltern hatten ja etwa 15 000 Mark Vermögen von ihren Eltern erhalten. Sie hatten an dem Hofverkauf in Ladekopp 20 000 Mark verdient u. 33 000 Mark in den 17 Wirtschaftsjahren in Ladekopp erübrigt. Sie kamen also mit rund 80 000 Mark nach Irrgang u. glaubten fest, sich dadurch zu verbessern, aber sie hatten sich getäuscht. Es setzte schon in der 2ten Hälfte der achtziger Jahre eine erhebliche Wirtschaftsflaute ein, die in der Caprivi Zeit, Anfang der 90ger Jahre, ihren Höhepunkt fand. Der Weizenpreis, der im großen Werder immer eine große Rolle spielte, ging bis auf 6.00 M. pr. Centner zurück, die Milch kostete 7 Pf. pro Liter, fette Schweine brachten 30 M. pr. Ctr. u. die Zuckerrüben 70 Pf – 1.00 M. pr. Ctr. Mit diesen Preisen, die sich nur allmählig am Ende des 19ten Jahrhunderts besserten, waren bei Gott keine großen Sprünge zu machen.
1885 war Vater 60 Jahre alt geworden u. konnte sich auf keine neue Wirtschaftsmethode mehr umstellen, besonders nicht, wenn sie mit Geldausgeben verbunden war. Mit diesen Anschauungen stand er durchaus nicht allein. Seine Nachbarn in Irrgang waren sogar einhellig derselben Anschauung. Da war der Zuckerrübenbauer aber nicht am Platz. Die Zuckerrübe gedeiht zunächst auf jedem guten Boden, aber bei Wiederholung stellen sich leicht Schädlinge ein. Da war zuallererst der Wurzelbrand, der in verheerendem Maße um sich griff. Dagegen gab es ein gutes Mittel, den Scheideschlamm der Zuckerfabriken, einfach Kalkschlamm genannt. Eine Gabe von 500-600 Ctr. pr. ha. tat Wunder. Aber der Kalkschlamm kostete Geld u. zusätzliche Winterarbeit durch das anfahren u. auf dem rauhen Acker ausbreiten des Kalkschlammes; u. beides scheuten die alten Werderbauern. In Irrgang wenigstens war kein einziger, der mit Kalkschlamm arbeitete u. so waren schlechte Rübern die Regel. Ich selbst war nie auf einem andern landwirtschaftlichen Betrieb tätig gewesen u. hielt selbstverständlich bis etwa zu meinem 20ten Jahr, die Wirtschaftsweise meines Vaters für die allein richtige. Aber dann fing ich doch an, mit den Betrieben der fortschrittlichen Bauern Vergleiche anzustellen, u. da wurmte es mich schon mächtig, daß unsere Felder u. besonders die Rübenfelder viel schlechter aussahen, wie die Felder der Bauern, die regelmäßig kalkten u. ich bat meinen Vater, auch einmal einen Versuch mit Kalkschlamm zu machen. Es war aber nichts zu machen. Aber damals gab ich mir schon das Versprechen: „Du wirst niemals Zuckerrüben auf ungekalktem Boden bauen!“ Und dieses Wort habe ich gehalten durch 52 eigene Wirtschaftsjahre.
Wenn ich hier hauptsächlich von meinem Vater schreibe u. der Mutter kaum gedachte, so bedeutet das nicht, daß Mutter an dem Gang der Wirtschaft unbeteiligt war. Aber sowohl mein Vater, als auch mein Schwiegervater u. schließlich auch ich selbst hatten Frauen, die mit unbegrenßtem Vertrauen zu ihren Männern standen, was besonders meiner eigenen Frau nicht immer leicht gefallen sein wird.
So hatten meine Eltern dann bei Vaters Tode am 22.2.1899 zwar in der 2. Hälfte ihrer 33 jährigen gemeinsamen Wirtschaftszeit in Irrgang keine Überschüsse mehr erzielt, aber die 80 000 Mark, die sie einst aus Ladekopp mitgebracht hatte, waren durch eiserne Sparsamkeit und unendliche Bedürfnislosigkeit der Eltern erhalten geblieben, so daß nach Mutters Tode einmal etwa 9-10 000 M. auf jedes der 8 Kinder vererbt werden sollten. Mutter hatte sich nach Vaters Tode u. nachdem am 1. Jan. 1901 der Hof in Irrgang für 147 000 Mark an Gustav van Riesen aus Tralau verkauft worden war, wodurch eine Erbauseinandersetzung zwischen den Geschwistern sehr erleichtert wurde, 24 000 Mark als Witwengut vorbehalten.
Dieser Teil der Erbschaft war 1922 beim Tode der Mutter durch die Inflation schon sehr entwertet. Soweit das wirtschaftliche Leben meiner Eltern. Vater schrieb bis an sein Lebensende eine schöne durchgeschriebene Handschrift u. hatte sich auch in mancherlei Ämtern betätigt. Er ist im Anfang der siebenziger Jahre 6 Jahre Gemeindevorsteher in Ladekopp u. in seinen letzten Lebensjahren auch noch in Irrgang gewesen, hatte als Diakon der Mennonitengemeinde Ladekopp die weltlichen Angelegenheiten dieser Kirche zu vertreten u. hatte auch schon in Ladekopp den „Verein gegen Pferdediebstahl“ mitbegründet u. war bis zu seinem Tode dessen Vorsteher. Und so hatte Vater sein Leben lang viel Gelegenheit, sich schriftlich zu betätigen. Um so mehr hat es mich immer gewundert, daß er keine schriftlichen Aufzeichnungen über besondere Vorgänge in der Wirtschaft u. der Familie hinterlassen hat. In seinem Nachlaß, soweit er mir bekannt geworden ist, befanden sich nur ein paar Hefte aus seiner Schulzeit u. Aufzeichnungen seines Vaters u. Großvaters über Vorkommnisse in der Familie u. Wirtschaft. Wenn ich in Bezug auf landwirtschaftliche Maßnahmen auch nicht immer mit meinem lieben Vater einverstanden war, so habe ich doch meinem allzeit gütigen Vater u. meiner lieben lieben Mutter stets ein dankbares Gedenken bewahrt.
Kap. X
Mein Schwiegervater Jacob Wienz
geboren d. 10. Juli 1815 in Kl. Lesewitz
gestorben d. 25. Februar 1900 in Irrgang
Auch er war, wie mein Vater, schon ein älterer Junggeselle, als er mit 37 Jahren im Jahre 1852 zur Ehe mit einem Frl. Reimer aus Kl. Lesewitz schritt.
Aus seiner Jugendzeit erzählte er mir einmal, daß es seinen Eltern auf ihrem 47 ha großen Hof in Kl. Lesewitz gut gegangen wäre u. daß es ihm sein Vater versprochen habe, ihn nach beendeter Schulzeit, seinem Wunsch entsprechend, das Orgelspiel erlernen zu lassen. Da sei 1929 ein großes Unglück über die Familie gekommen. Im Frühjahr dieses Jahres brach der Nogatdamm bei Schadwalde u. versandete eine große Fläche Schadwalder Landes. Dazu gehörten auch crc. 20 ha des Wienz’schen Hofes in Kl. Lesewitz. Das war ein schwerer Schlag für die Familie Wienz u. lähmte zunächst alle Familienmitglieder. Damals gab es keinen Pfennig Entschädigung für Bruchschäden. Die mußte jeder selbst tragen. Aber allmählig hatten sich die Eltern Wienz mit ihren 5 Kindern aufs sparsamste eingerichtet. Da starb 1837 die liebe Mutter, und der damals 22 jährige Jacob Wienz wurde von einem Grauen vor Leichen gepackt, wie das bei jungen Menschen wohl oft der Fall sein mag. Aber er habe sich dieses Grauens vor seiner Mutter, die ihm doch in seinem ganzen Leben nur gutes getan habe, geschämt. Da habe er sich selbst überwunden und heimlich die ganze Nacht an ihrem Sterbelager gewacht u. dort das Grauen vor Leichen verloren. Ich habe ehrfürchtig zu dem 84 jährigen Greise aufgeschaut, als er mir in stiller Zwiesprache einen Blick in sein Geistesleben gewährte.
In den vierziger Jahren war dann auch sein Vater gestorben und der älteste Bruder Peter hatte sich verheiratet u. war nach Lespe [?] gezogen. Die andern 4 Geschwister blieben noch einige Jahre zusammen u. Jacob war der Führer u. begann Ende der vierziger Jahre mit dem Landdrehen des versandeten Landes. Es gehörte schon erheblicher Unternehmensgeist dazu, an diese Arbeit heranzugehen. Denn diese Arbeit war teuer (einen ha Land drehen kostete 700 bis 850 Mark je nach der Höhe der Landschicht, die vergraben werden sollte). Dieses Landdrehen geschah in der Weise, daß zunächst von einem crc. 2 m. breiten Streifen Land der Sand nach einer Seite ausgehoben u. dann noch 50 cm des guten Bodens von unten herausgeworfen wurden; dann wurde von dem benachbarten Streifen der Sand in die Grube geworfen u. 50 cm Boden von unten nach oben auf den Sand geworfen u. wenn das beabsichtigte Landstück in dieser Weise bearbeitet war, dann wurde Raps gesät u. zwar 2-3mal hintereinander. Zweimal wäre der Raps sehr gut geworden, zum drittenmal erheblich schlechter. Aber die Erträge aus Raps waren damals so gut, daß schon 2 Ernten die Landdrehungskosten vollständig deckten.
1852 verheiratete sich dann Jacob Wienz u. kaufte einen kleinen 20 ha großen Hof in Halbstadt. Welchen Preis Jacob Wienz damals für den Hof gezahlt hat, weiß ich nicht mehr, mir ist aber erinnerlich, daß die 3000 Mark, die angezahlt werden mußten, aus 6000 fünfzigpfennig Stücken bestanden, die von 2 Männern in einer großen Lüschke herangeschleppt wurden. Dann wurde das größte Zimmer sauber ausgefegt, ein großes Bettlaken über dem Fußboden ausgebreitet u. das Geld aufgezählt.
Die erste Ehe des Jacob Wienz dauerte nur ein Jahr. Die Frau starb mit dem Kinde im ersten Wochenbett. Ein Jahr später heiratete Jacob Wienz die Schwester seiner ersten Frau. Aus dieser Ehe sind wohl mehrere Kinder klein gestorben, nur eine Tochter Katharina blieb am Leben u. war die älteste Halbschwester meiner Frau. Inzwischen hatte der jüngste Bruder Bernhard die väterliche Wirtschaft in Kl. Lesewitz übernommen, sich aber mit weiterem Landdrehen nicht befaßt. Anfangs der sechziger Jahre zog Bernhard dann nach Pordenau u. verkaufte den väterlichen Hof in Kl. Lesewitz an seinen Bruder Jacob, der nun von Halbstadt wieder auf seinen väterlichen Hof nach Kl. Lesewitz zog. Da traf ihn erneut das Unglück u. auch seine zweite Frau starb u. ließ ihn mit der kleinen 1859 geborenen Katharine zurück.
Jacob Wienz blieb dann jahrelang Witwer u. nahm die 1852 unterbrochene Arbeit des Landdrehens wieder auf, die bis 1870, ungefähr, beendet wurde. Mein Schwiegervater Jacob Wienz litt sein Leben lang an Rheumatismus u. behauptete, daß er sich dieses Leiden beim Landdrehen zugezogen habe. Das Landdrehen wurde nämlich von Akordarbeitern ausgeführt, die gerne mogelten, wenn der Bauer nicht dabei war und da war Schwiegervater eben immer dabei. Im übrigen stellte sich Jahrzehnte später heraus, daß es nicht richtig gewesen war, 50 cm reinen Lehm nach oben zu bringen und daß der gedrehte Boden erheblich fruchtbarer u. viel leichter zu bearbeiten wäre, wenn der Boden noch einmal u. diesesmal mit einem riesigen einscharigen Dampfpflug auf 1 mTiefe zurückgedreht würde u. man ihn im ersten Jahre danach mit Karrhaken u. ähnlichen Geräten gründlich durcheinander mische.
Mein Schwiegervater heiratete dann im Jahre 1866 zum drittenmal u. zwar meine Schwiegermutter Marie Wiebe aus Herrenhagen, die Schwester meiner Mutter. In den siebenziger Jahren habe ich dann einigemale frohe Ferientage beim Onkel Wienz verlebt. Da fiel mir damals schon auf, daß bei Onkel u. Tante Wienz offenbar eine gemeinsame große Vorliebe für einen schönen Garten herrschte. Der Garten war mit einem hohen Staketenzaun eingefaßt. Er enthielt neben vielen mit Ligusterhecken eingefaßten Gartenwegen auch 2 große Lindenlauben. Hecken u. Lauben wurden 1 bis 2mal jährlich geschoren, was bei den hohen Lindenlauben immer vom Gärtner Thießen aus Schadwalde ausgeführt wurde, der eigentlich von Beruf Schneider war, sich aber im Sommer fast ausschließlich mit Anlage von Gärten u. scheeren von Lindenlauben u. Lindenbäumen im ganzen Werder beschäftigte. Das scheeren solcher hoher Lauben u. Bäume geschah nicht etwa mit einer Heckenschere, sondern mit einem etwa 50 cm. langen, an einer 3-4 m langen Stange, befestigten zweischneidigen Messer. Es war erstaunlich, mit welcher Kraft der kleine siebenzigjährige Mann, mitten in den Baumkronen stehend, die oft schon recht starken Lindentriebe absäbelte. Zunächst sah das manchmal recht wüst aus, wenn aber erst die abgehauenen Zweige u. Blätter entfernt waren, kam eine saubere glatte Fläche an Lauben u. Lindenbäumen, die um das Haus standen, zum Vorschein. Das feinere nachputzen wurde dann noch mit der Heckenschere, die man damals allgemein Ligusterschere nannte, vorgenommen.
Bei solchem Ferienaufenthalt in Kl. Lesewitz bin ich auch einmal mit meinem Onkel Wienz nach Marienburg mitgefahren, als Raps abgeliefert wurde. Onkel Wienz fuhr selbstverständlich im ersten Gasthaus der Stadt, dem Hotel Marienburg, ein u. wir verzehrten jeder eine Tasse Kaffee u. eine mit Käse belegte Buttersemmel. Diese Bedürfnislosigkeit gefiel dem Gastwirt offenbar nicht sehr, was Onkel Wienz auch merkte. Er fragte den Wirt so nebenbei, als er seine geringe Zeche bezahlte, ob er vielleicht ab u. zu mal einen Sack Häcksel gratis von ihm haben wolle. Darüber war Gastwirt Mink hoch erfreut, da ja immer Häcksel in seinem Gaststall gebraucht wurde, und Onkel Wienz war fortan ein gern gesehener Gast. Auf Reputation hielt Onkel Wienz besonders von Seiten seiner u. auch fremder Arbeiter außerordentlich. Die Anrede war damals in weiten Arbeiterkreisen gegenüber ihrem Chef: „Hochgeehrter Herr!“, was in dem allgemein gebräuchlichen Plattdeutsch als Hochjetter oder gännziger [?] Herr ausgesprochen wurde. Wer einmal Halbes Scholle u. Schicksal gelesen hat, dem werden diese Ausdrücke vielleicht schon dort aufgefallen sein. [Bei Halbe heißt es: Hochtgeter Härr!]
Als Ohm Wienz schon lange in Irrgang im Ruhestand lebte u. selten ausging, kam er aber doch an einem schönen Sommertage, als wir gerade bei der Rapsernte waren, zu meinem Vater in die Scheune. Er hatte bei seiner Unterhaltung mit Verwandten u. Bekannten die Angewohnheit, wenn er einen Satz beendet hatte, ihn noch mit “joa, joa“ zu bekräftigen. Auf der Tenne arbeitete neben andern Leuten auch unser alter Fütterer Dellmann, der dieselbe Angewohnheit hatte. Als Onkel Wienz den Dellmann etwas fragte, antwortete Dellmann ganz ruhig u. sachgemäß u. bekräftigte seine Auskunft mit „joa, joa!“ Als er eine zweite Antwort mit joa, joa beantwortete, fuhr Onkel Wienz den alten Dellmann an: „joa, joa segge se blos, wenn he enmal joa seggt, dat genügt mir all!“[Ja ja, sagt man bloß [?], wenn Er einmal ja sagt, dann genügt mir das!] u. ging, offenbar erzürnt, davon. Dellmann war ganz verdattert über diesen Anschnauzer u. meinte: De ole Herr ess uck forts so krus; eck haew mi doch nuscht schlömmet doarbi gedocht. [Der alte Herr ist auch immer so ärgerlich, ich hab mir doch nichts Schlimmes dabei gedacht.] Und ich glaube auch, daß Onkel Wienz in diesem Fall Unrecht hatte, aber er glaubte offenbar von Dellmann veräppelt zu sein.
1882 verkaufte Onkel Wienz seinen Hof an Johann Fieguth aus Warnau. Zwei Jahre vorher, am 10. Juli, feierten wir in Kl. Lesewitz noch einmal den Geburtstag des Hausherrn, der eben von einem vierwöchentlichen Kuraufenthalt in Teplitz zurückgekehrt war. Es war sein zweiter u. letzter Kuraufenthalt in Teplitz gewesen. Leider brachte ihm auch dieser 2te Teplitzer Kuraufenthalt keine Heilung von seinem Rheuma, u. daher verkaufte er 1882 seine Wirtschaft u. zog nach Irrgang zu seinem Schwiegersohn Bernhard Penner ins Rentierhaus. Der Geburtstag am 10.7.1880 nahm übrigens ein vorzeitiges u. stürmisches Ende. Nach einem sehr heißen Tag sahen wir im Westen eine pechschwarze dicke Wolkenwand langsam emporsteigen. Die meisten Gäste flüchteten schleunigst, um noch vor Ausbruch des erwarteten Unwetters nach Hause zu kommen. Meine Eltern aber u. ich mit meinen Geschwistern hatten 1 ½ Std. Landweg nach Hause u. blieben deshalb in Kl. Lesewitz über Nacht. Zu Bett gegangen war aber zunächst Keiner. Der Gedanke, daß wir in einem Winkelhof mit ausschließlich Strohdach saßen, in dem noch sogar der vielfach vorhandene massive Brandgiebel zwischen Wohnhaus u. Stall fehlte, war auch recht beunruhigend. Aber die krachenden Donnerschläge wurden allmählig schwächer u. morgens fuhren wir dann bei hellem Sonnenschein über Irrgang u. Neukirch nach Hause und erfuhren in Irrgang, daß in der vergangenen Nacht unter Blitz u. Donner ein Junge geboren war. Der älteste Enkel des Großvaters Wienz. Wir kamen an einigen Brandstellen vorbei, aber die Sorge der Eltern, ihrer zu Hause gebliebenen Kinder wegen, war unnötig gewesen; zu Hause war alles in Ordnung.
Mein Schwiegervater Jacob Wienz war nicht annähernd so federgewandt, wie mein Vater u. hat ebenfalls nichts schriftliches hinterlassen, aber in einem Punkt überwand er seine Abneigung gegen die Schreibfeder u. das war seine Buchführung. Das war kein kompliziertes Buchführungssystem, aber es genügte ihm u. für andere Leute war es ja auch nicht bestimmt. Er hat uns in seinen ganz alten Tagen noch ermahnt: „Kinger, schriewt an, schriewt an, wenn eck nich emmer angeschräwe had, wat eck ennahm on utgaw, denn had eck foaken geglowt, andere Mensche hade mi wat weg genoame, so fex es dat Geld alle!“ [Kinder, schreibt auf, schreibt auf, wenn ich nicht immer aufgeschrieben hätte, was ich einnahm und ausgab, dann hätte ich oft geglaubt, andere Menschen hätten mir was weggenommen, so fix ist das Geld weg]. Und wenn man ihn bei seiner Buchführung beobachtete, sah man erst, welche Umstände ihm wohl das Schreiben machte. Schwiegervater war nämlich Linkshänder, schrieb zwar mit der rechten Hand, zum eintauchen der Feder in das Tintenfaß nahm er aber jedesmal den Federhalten in die linke Hand.
Nun waren seine Zeitgenossen nicht alle so korrekt. In seinen besseren Tagen war er mit Schwiegermutter u. dem verwandten Ehepaar Heinrich Fast Kl. Lesewitz einmal zu einer Ausstellung nach Königsberg gefahren u. schrieb nach gewohnter Weise jede Tasse Kaffee u. jedes Glas Bier an. Sie mußten auch in Königsberg übernachten u. am nächsten Tage sagte die Tante Fast zu ihrem Mann: „Heinrich, de Schwoager Wienz schriwwt alles an, wat he utgewwt, schriffst du uck wat an?“ „I, Minke, antwortete Ohm Heinrich, eck heww to Hus genau angeschräwe, wat wi an Geld metnahme, on wenn wi noa Hus koame, denn täll eck ewer, wat noch im Portmonaie es, on wat fehlt, dat hewe wi utgegewe, dat schriw eck denn als Utgoaw an.“ [Heinrich, der Schwager Wienz, schreibt alles auf, was er ausgibt, schreibst du auch was auf? – I, Minchen, antwortete Ohm Heinrich, ich hab zu Hause genau aufgeschrieben, was wir an Geld mitnahmen, und wenn wir nach Haus kommen, dann zähle ich nach, was noch im Portemonnaie ist, und was fehlt, das haben wir ausgegeben, das schreibe ich dann als Ausgabe auf]. Dieses Verfahren wird auch heute wohl meistens geübt.
In seinen Irrganger Tagen hat Schwiegervater Wienz oft schwere Krankheiten durchgemacht, die oft für sein Leben fürchten liessen. Aber die unendlich sorgsame Pflege der Schwiegermutter u. sein Gehorsam, als Patient den Anordnungen seiner Frau zu folgen, liessen ihn das hohe Alter von fast 85 Jahren erreichen.
Auch die Schwiegereltern hatten, als sie sich zur Ruhe setzten, ein Vermögen von etwa 80 000 Mark angesammelt. Aber während dieses Vermögen auf 3 Kinder verteilt wurde, mußten sich bei meinen Eltern 8 darin teilen.
Auch diesen beiden lieben Alten haben wir Kinder immer in Liebe u. Verehrung gedacht. Sie ruhen schon seit 1912 unter einem gemeinsamen Hügel auf dem Friedhof in Gr. Lesewitz, wo viele Verwandte schlafen.
Kap. XI [Meine eigene Wirtschaftszeit]
Hermann Wiebe, geb. d. 5.3.1869 und Helene geb. Wienz, geb. d. 13. Februar 1872 in Kl. Lesewitz gest. 26. Februar 1947 in Flötz Krs. Anhalt Zerbst u. dort auch beerdigt.
Über meine Jugend habe ich in einem Buch „Aus der Jugendzeit“, meiner Tochter Margarete geschenkt, und aus unserm gemeinsamen Lebensweg unter dem Titel „Von der grünen bis zur goldenen Hochzeit“ berichtet.
Im Jahre 1893, als wir uns sehnsüchtig nach einer Stelle umsahen, brannte im April ein kleiner Bauernhof in Brodsack nieder, welcher den Abram Pennerschen Erben aus Neuteichsdorf gehörte u. nach dem Brande zum Verkauf gestellt wurde. Vater u. ich besichtigten den Hof, der 29 ha „groß“ war, nur aus Ackerland 2.-3. Kl. bestand, das in 3 weit auseinander liegenden Parzellen bestand, die nicht an den Hofraum angrenzten. An Inventar war das notwendigste Ackergerät, eine Kuh u. 4 alte Pferde vorhanden. Der Anfang erschien also durchaus nicht günstig. Aber es lag eine 27 000 Mark hohe, mit 4% verzinsliche unkündbare Hypothek auf dem Grundstück, die uns die Übernahme des Hofes mit den verlangten 15 000M. Anzahlung zu übernehmen [erlaubte]. Das war gerade die Summe, die Schwiegervater Wienz seiner Tochter Helene mitgeben wollte u. bereit liegen hatte. Wir haben nicht lange gehandelt u. griffen zu, und am 1. Mai 93 zog ich als neugebackener Hofbesitzer in Brodsack ein. Aber bevor wir Hochzeit machen konnten, mußte noch erst Wohnhaus u. Stall aufgebaut werden, wozu uns das Brandgeld von crc. 6000 Mark cediert wurde. Auf dem Hof war eine gute, fast neue Pappdachscheune u. ein kleiner Speicher mit Pfannendach vorhanden.
Der Acker war bis auf ein Stück von 2 ½ ha an der Tannsee’schen Grenze bestellt. Weideland war nicht vorhanden. Aber da wir ja auch vorläufig noch kein Vieh besaßen, machte mir das auch keine Sorgen. Die 2 ha, die mit Zuckerrüben bestellt waren, hatten eine ordentliche Kalkdüngung erhalten. Es war der erste Kalkschlamm, der auf das ganze Grundstück bisher gegeben war. Ich hatte also reichlich Gelgenheit, meine Kalkungspläne durchzuführen und ich habe mich selbst beim Wort genommen u. niemals Rüben auf ungekalktem Boden angebaut, u. ich bin gut dabei gefahren. Den Aufbau von Wohnhaus u. Stall, sowie die Einzäunung des Grundstücks hatte der Zimmermeister Peters aus Schöneberg übernommen für 9000 Mark. Die 3000 Mark, die über das Brandgeld hinaus gebraucht wurden, gab mir mein lieber Vater und auch ein komplettes Fuhrwerk (2 schöne 4 jährige Pferde mit Geschirren u. einem 4 sitzigen Kabriolwagen, mit dem wir ordentlich Staat machten, bei unsern wenigen Brautleutefahrten, die damals noch bei uns Sitte waren[)]. Die Onkels u. Tanten, event. auch verheiratete Geschwister, mußten vor der Hochzeit alle besucht werden. Ich hatte zunächst nur sehr geringes Angespann (4 alte Pferde), aber mein Vorgänger hatte dem Eichwalder Fuhrenverband mit einem verhältnismäßig großen Anteil angehört und ich war in seine Rechte eingetreten u. bekam soviel Fuhren gestellt, daß ich nicht nur das Holz von Schöneberg anfahren lassen konnte, sondern auch den zum Bau notwendigen Sand von meinem unbestellten Feld an der Tannsee’er Grenze, ohne meine eigenen Pferde dafür anspannen zu müssen. Die Arbeiten auf dem Hof wurden von dem bisherigen Hofmann Vogt u. einem unverheirateten 20 jährigen Burschen besorgt, der zugleich unser Kutscher bei unseren Brautleutefahrten war. Sie bekamen neben ihrem Lohn pr. Tg. 1.00 M. Kostgeld u. beköstigten sich selbst. Die Rübenpflege hatten alte Leute aus dem Dorf im Akord übernommen u. sonstige Arbeiten wurden von ihnen im Tagelohn ausgeführt. So war uns die Zeit bis zu dem in Aussicht genommenen Hochzeitstag d. 11.7.1893 schnell vergangen, aber der Zimmermeister hatte es nicht geschafft, unser Wohnhäuschen (das ebenso wie der Stall aus Holz mit verschaltem Pfannendach gebaut wurde) fertig zu stellen. Aber da sich der Hochzeitstermin wegen der bevorstehenden Ernte [aber] nicht weiter hinausschieben ließ, wurde termingemäß am 11. Juli Hochzeit gefeiert. Es war ein strahlend schöner Tag, an dem wir Vormittags mit den beiden Vätern in 2 Wagen nach Gr. Lesewitz zum Standesbeamten Bachmann zur standesamtlichen Trauung fuhren. Die kirchliche Trauung wurde am Nachmittag von unserm Prediger Gerhard Fieguth Kl. Lesewitz vollzogen, der uns den Spruch auf den gemeinsamen Lebensweg mitgab: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an, am Gebet“. Das schöne Wetter hielt den ganzen Tag und auch noch die nächsten Tage an. Es konnten alle Aufführungen im Garten stattfinden u. sogar unser alter Vater Wienz, der gegen Erkältungen sehr empfindlich war, hat bis zum Abendbrot im Garten ausgehalten.
Und als ich dann am 23. Juli endlich meine junge Frau in das neue Heim holen konnte, das liebe Eltern u. Geschwister schon ganz freundlich eingerichtet hatten, da begann ein freundliches gemeinsames Wirken u. Streben, das erst 54 Jahre später endete.
Ich hatte mir sehr bald die Anerkennung meiner Nachbarn, die sämtlich zu unserer Hochzeit erschienen waren, erworben, was sich 2 Jahre später in meiner Wahl zum Gemeindevorsteher ausdrückte. Ich war auch eine kurze Zeit Brandschulze für die Tiegenhöfer Feuerversicherung u. von 1900 ab 9 Jahre lang Rechner des Eichwalder Raiffeisenvereins, zu dessen Mitbegründern ich gehörte.
Aber diese Ämter brachten nicht allzuviel ein und, trotzdem ich immer gute Ernten erzielte u. auch nicht besonderes Pech in der Wirtschaft hatte, konnte ich doch nicht erhebliche Überschüsse aus der Wirtschaft erzielen. 8 Kinder wollten ernährt u. möglichst nach Wunsch ausgebildet sein. Da versuchte ich einigemale, die Wirtschaft zu verkaufen, um mir eine größere zu kaufen. Das scheiterte an der Lage meiner Felder, die in 3 Parzellen u. fast immer vom Hof ablagen.
Diese Zerstückelung habe ich besonders schmerzlich im Jahre 1905 empfunden, als ich in dem sehr nassen Herbst besonders viel Zuckerrüben angebaut hatte ( 8 ½ ha, also fast ein drittel meines ganzen Landbesitzes). Und diese Zuckerrübenfelder lagen noch in 2 weit voneinander entfernten Parzellen ganz am Rande meines Landbesitzes.
Als ich dann mit der Rübenernte begann u. gleich bei den ersten Fuhren mit dem Wagen im Boden versank, da wurde mir klar, daß hier besondere Maßnahmen ergriffen werden mußten, wenn ich meine schöne, große Rübenernte retten wollte.
Nachdem das abfahren der Rüben schon bei den ersten Fuhren gescheitert war, beschränkte ich mich ausschließlich darauf, die Rüben auszuheben, zu köpfen u. auf einen großen Haufen, sogenannte Quakretmieten [?, Quäkermieten?], zusammenzufahren u. an den Seiten mit Erde zu bedecken. Oben wurde eine Schicht Rübenblätter darauf gedeckt. Die beiden großen Haufen waren etwa 1 ¾ m hoch u. hätten der Blätterdecke schon nicht bedurft, denn die Rüben waren bei der Abfuhr schon ziemlich stark ausgewachsen, hatten also zu warm gehabt. Aber ich konnte nicht voraussehen, daß es bis Weihnachten nicht frieren würde. Nach dieser Arbeit wurde mit aller Kraft gepflügt. Das war bei dem schweren Lehmboden die vordringlichste Arbeit.
Ich aber ging nun auf die Suche nach einer Feldbahn, mit der ich die Rüben zur Chaussee befördern konnte.
Der Gutsbesitzer Koch in Kochstädt [Kochstedt] bei Praust besaß eine sogenannte Fuhrwerksbahn, die ich mir auf einer Reise nach Danzig ansah. Bei dieser Art der Rübenabfuhr wurde der leere Arbeitswagen von der Chaussee auf ein vierrädriges niedriges Rahmengestell, in Länge eines Arbeitswagens, geschoben, das auf Feldbahngleisen lief, die beliebig an die einzelnen kleinen Mieten verlegt werden konnten. Ein Mann mit 2 Pferden zog den Wagen zur Miete u. nahm den beladenen Wagen mit zur Chaussee. Da die Rüben in diesem Fall bei der Rübenernte mit Kiepen in kleine Mieten zusammengetragen waren, das Feld also absolut keine Radspur aufwies, so funktionierte das, wenigstens während meiner kurzen Anwesenheit auch ganz gut, obwohl mir die Sache doch recht kipprig vorkam. Ich war überzeugt, daß diese Tranportart für mich nicht in Frage kam u. fuhr weiter nach Danzig zur Fa. Orenstein&Koppel, einer Feldbahnverleih Fa. u. fand sofort, was ich suchte. Die Fa. hatte soeben in Kl. Lesewitz 1000 m Gleis u. 9 Kipplorrys vom Chausseebau Kl. Lesewitz-Halbstadt frei bekommen u. aufgestappelt u. bot mir dieses Material nebst 2 Weichen für ein billiges Leihgeld an. Ich griff sofort zu und holte dieses Material nach Brodsack u. nachdem die Pflugarbeit beendet war, begann ich mit meinen 4 Leuten, von denen 2 Polen waren, die ich nach beendeter Rübenarbeit hier behalten hatte, die Gleise auszustrecken.
Der eine von den Polen war meine zuverlässigste Kraft, bei diesem beginnenden Feldbahnbetrieb. Er hatte in Kiesgruben gearbeitet u. kannte alle Kniffe bei dieser Arbeit. Es sind jetzt 50 Jahre darüber verflossen, aber ich sehe uns noch eifrig bei der Gleislegung. Da kamen wir an eine Kurve, aber Kurven waren keine mitgeliefert; was nun? Die Kurven mache ich Ihnen, sagte der Pole gemütsruhig zu mir. Es wurden auf sein Geheiß zwei schwere Schmiedehämmer aus der nahen Schmiede geholt u. dann begann der Kurvenbau, indem an einem 5 m langen Gleisstück die Eisenblechschwellen, die mit Klammern an der Schiene befestigt waren, an der einen Schiene kräftig vorgetrieben [wurden?], und, o Wunder, die Schiene bog sich, wie eine Spiralfeder; aber nun war das eine Schienenende um etwa 40 cm. zu lang. Was nun? fragte ich besorgt meinen Polen. Da antwortete er wieder ganz ruhig: Das Ende schlagen wir ab u. so geschah es u. wir brauchten nicht noch auf die nachzuliefernden Kurven warten. An der Chaussee, wo die Rüben auf Wagen umgeladen werden sollten, waren ein paar dreizöllige breite Bohlen hingelegt, auf die der leere Wagen gefahren wurde u. nebenbei lagen ein paar alte Türen, auf die die Rüben ausgekippt wurden. Und dann ging es los. Mein Schwager Penner aus Irrgang hatte mir 2 Pferde für den Bahnbetrieb geliehen, mit denen ich selbst sämtliche Rüben von den Mietenstellen zur Chaussee gefahren habe. Ein Pole lud an der Miete auf u. einer an der Chaussee auf die Wagen u. meine 2 Leute fuhren mit den beladenen Wagen zur Fabrik und bis Weihnachten war die Arbeit beendet u. die Gleise an der Chaussee zum Abtransport aufgestappelt, und keine Rübe war verfault oder erfroren. Ich hatte aber auch erheblich Glück gehabt mit dem Wetter. Es hatte niemals gefroren u. war nie glatt auf der Chaussee geworden und es hatte auch nie geregnet – Ein bischen Glück muß der Mensch schon haben u. es ist mir auch später in kritischen Lagen zumeist treu geblieben.
Die ganzen Gleise u. Lorrys übernahm übrigens von mir noch Max Schroedter Eichwalde, vor dessen Haustür, sozusagen, ich 3 Wochen lang meine Zugführerkünste ausgeübt hatte. Er übernahm auch die spätere Verladung nach Danzig und etwaige Ansprüche für fehlendes Material. Von all meinen Verwandten u. Nachbarn hat sich nie jemand den doch nicht alltäglichen Feldbahnbetrieb angesehen. Es wäre manchem zu empfehlen gewesen, der in der gleichen Lage, wie ich, aber nicht den Mut fand, etwas zu riskieren u. seine Rüben zu Hause verfaulen ließ.
Im Frühjahr dieses Jahres 1905 hatte ich meine 8 Milchkühe verkauft. Es hatten sich Zeichen der Verkalbeseuche bemerkbar gemacht. Die Kühe verkalbten zwar nicht, aber sie blieben mit der Nachgeburt stehen u. wurden nachher nicht mehr trächtig. Ich verkaufte also meine hochträchtigen Kühe und kaufte mir von Cornelius Janßon Orloff 8 hochtragende Stärken für 2000 M., die schon zur Herdbuch-Auktion in Marienburg angemeldet waren, aber nun nicht mehr die Reise nach Marienburg machen durften. Ich kaufte dann noch einen gekörten Bullen u. trat in das Westpreuß. Herdbuch in Danzig ein.
Aber das Züchtertalent hatte ich nicht mitgekauft u. so habe ich die Tiere zwar ein paar Jahre besessen, aber sonderliche Erfolge nicht erzielt. Meine Stärke lag beim Ackerbau und nicht bei der Tierzucht.
Als ich 1905 mit Muttern und 6 Kindern das Weihnachtsfest feiern konnte, fühlte ich mich recht befriedigt nach der schweren Rübenkampagne, die mich fast ¼ Jahr anstrengend beschäftigt hatte und nun erfolgreich abgeschlossen war.
Da erhielt ich in den Weihnachtstagen meine Einberufung als Geschworener nach Elbing zu einer 14 tägigen Sitzungsperiode, bald nach Neujahr beginnend. Das war mir keine unangenehme Nachricht u. ich betrachtete die 2 Wochen in Elbing als Erholungsurlaub. Es waren fast alles Landwirte aus den Kreisen Marienburg, Elbing, Stuhm u. Rosenberg, mit denen ich dort zusammentraf. Sie haben mir manche Anregung, auch auf landwirtschaftlichem Gebiet, gegeben.
Aus früheren Jahren muß ich noch nachholen, daß ich mir etwa 1904 ein Zweifamilien-Arbeiterhaus baute, wozu ich allerdings 4000 Mark von meiner Schwiegermutter leihen mußte. Ich hielt nun ständig 2 verheiratete Instmänner. Im Jahre 1897 am 19. August brannten die beiden neuen Gebäude Wohnhaus u. Stall nieder, die ich 1893 erbaut hatte. Das Feuer entstand in den frühen Nachmittagsstunden auf dem Heuboden, derweil wir alle eifrig mit der Einbringung der Ernte beschäftigt waren. Meine Frau, die vor der Hintertür des Hauses mit der Wäsche beschäftigt war, bemerkte das Feuer durch die offene Heubodenluke zuerst. Sie erzählte später, daß sie bemerkt habe, wie ein kopfgroßer Feuerball von dem Heuvorrat zur Heubodenluke herunterrollte u. habe geglaubt, der Feuerball müsse doch noch zu löschen sein, aber im nächsten Augenblick wäre der ganze Heuvorrat aufgeflammt. Das wenige Vieh, das im Stall war u. auch das Inventar aus dem Wohnhause konnte gerettet werden. Wir aber fanden mit unserm damals einzigen 3 jährigen Töchterchen liebevolle Aufnahme bei unserm eben neu zugezogenen Nachbar Letkemann u. seiner Frau in dem großen Wohnhause.
Es wurde aber sofort der Wiederaufbau der abgebrannten Gebäude in Angriff genommen. Die neuen Gebäude wurden von dem Zimmermeister Dzaak aus Stutthof für das Brandgeld neu, aber wieder aus Holz aufgebaut. Sie waren aber beide etwas größer und das Wohnhaus konnten wir erheblich weiter vom Stall abrücken, weil der benachbarte Schmiedemeister Schlichtingmir im Austausch ein Stück Land abgab, das mir meinen Hofraum bisher sehr eingeengt hatte. Wir nahmen die Gastfreundschaft Letkemanns nur 2 Wochen in Anspruch u. zogen dann mit unserem Mädel in unsern kleinen Speicher, in dem der Zimmermeister Dzaak eine Behelfswohnung eingerichtet hatte. Aber die Zeit drängte, einmal stand der Winter doch vor der Tür und dann erwarteten wir für Anfang November wieder Familienzuwachs u. Dzaak schaffte es wirklich bis 1. November, daß wir wenigstens 2 heizbare Zimmer beziehen konnten u. am 5. November wurde unsere Else geboren. Das war durchaus keine vorbildliche Entbindungsanstalt, in der dieser Akt vor sich ging. Das Haus war aus nassem Holz gebaut u. als nun in den Zimmern geheizt werden mußte, da quoll das Wasser aus dem Holz u. überzog die Innenwände mit grünen Pilzen u. oben wurde gehämmert. Aber meine Frau ertrug alles ohne Klage und die Kleine gedieh trotz aller Unruhe. Die Bauzeit war von besonders schönem Wetter begünstigt worden u. wie der Winter einsetzte, war wieder alles einigermassen in Ordnung, und im nächsten Frühjahr 1898 legte Gärtner Thießen aus Schadwalde auch bei uns den neuen Garten an. Er war schon recht alt, aber noch immer sehr beweglich u. geistig rege.
Dieses mal hatten wir mit keinem Gedanken an einen Verkauf des Grundstückes gedacht, bis wir im Januar 1908 erneut abbrannten. An einem Januartage in der Frühstückszeit erscholl der Ruf: „Unser Stall brennt!“ Ich stürzte in den Stall, wo das Vieh noch ganz ruhig u. ahnungslos stand. Ich machte in großer Eile die Rinder von der Kette los u. meine Frau die Pferde. Inzwischen waren auch Nachbarn herbeigeeilt u. halfen, die Tiere aus dem Stall treiben u. auch Wache halten, daß sie nicht wieder in den Stall zurückliefen. Und so wurden die Tiere alle gerettet, bis auf einige Hühner. Das Feuer konnte auf den Stall beschränkt werden. Das Vieh konnte bei den Nachbarn untergebracht werden. Diesesmal stand es aber bei mir fest, daß, wenn irgend möglich, verkauft werden mußte, um einen größeren Wirkungskreis, möglichst nahe einer Stadt mit guten Schulen, zu haben. Und diesem Wunsch kamen auch meine Nachbarn mit großem Interesse entgegen. Jeder wollte sich ein bischen vergrößern u. nun kam mir die zerstückelte Lage außerordentlich zustatten u. in einer halben Stunde waren wir uns über den Kaufpreis von 1200 Mark pr. culm. Morgen (0,56 ha.) einig u. Jeder bekam das Land, das ihm am günstigsten lag und das er daher gerne haben wollte. Das ganze lebende u. tote Inventar wurde im April per Auktion verkauft, das Wohnhaus u. den kleinen Speicher nebst der etwa 1 Morg. großen Hoflage kaufte die Gemeinde u. machte eine neue Schule daraus, die Scheune wurde zum Abbruch an einen Neufeld im Stuhmer Kreise verkauft u. das neue 2 Familienhaus an Jantzen Brodsack und nach Abrechnung aller Verbindlichkeiten blieb uns ein Vermögen von 60 000.- Mark. Da wir einmal vor 16 Jahren mit einem Vermögen von 21 000 Mark angefangen hatten, so war doch auch unser Wirken in Brodsack nicht vergebens gewesen. Nun wurden uns von dem Güterhändler Schneidemühl Neuteich sofort 20-30 Grundstücke aller Größen u. in allen Teilen des Kreises angeboten, an deren Spitze Gustav Mierau Liessau 95 ha stand. Aber ich lehnte zunächst jeden Kauf ab, da ich mir noch vorläufig die Hoflage mit den vorhandenen Gebäuden zurückbehalten hatte, da ich mit der Feuerversicherung noch nicht über die zu zahlende Feuerversicherungs Entschädigung einig war u. besonders, weil ich mir jetzt meinen sehnlichen Wunsch, mal etwas von der Welt zu sehen, glaubte erfüllen zu dürfen.
Bisher war ich nur einmal im Jahre 1889 auf eine Woche in Berlin gewesen, wo ich einen gleichalterigen Nachbarssohn besuchen wollte, der in Berlin studierte oder wenigstens studieren sollte. Ich hatte mich für diese von Vatern bewilligte Reise, sehr fein ausstaffiert u. als Bekrönung eine Jockeimütze mit recht langem Schirm gekauft, die bei meiner Ankunft in Berlin sofort das Entsetzen meines Freundes Hans Penner u. seines Studienfreundes Hansel [?] über diese unmögliche Mütze hervorgerufen hatte. Es war Abend u. an diesem Tage keine andere Kopfbedeckung zu beschaffen. Da wir einige Lokale aufsuchten, so mußte ich meine schöne Mütze schon vor Betreten des Lokals in die Hand nehmen, u. wenn wir Platz genommen hatten, wurde das Monstrum mit dem Hut meines Freundes bedeckt u. am nächsten Tage wurde ein Strohhut (Kreissäge) gekauft und die anstösige Mütze im Koffer für die Heimreise verstaut. Was ich damals in Berlin u. auch in Potsdam, wo ich einen alten Schulkameraden (Franz Dyck) besuchte, [gesehen habe], ist mir nur noch in nebelhafter Erinnerung, machte mir aber alles natürlich einen ungeheuren Eindruck. Ich will versuchen, bei Schilderung meiner späteren Reisen, noch darauf zurückzukommen.
Eine zweite Reise gestattete ich mir 15 Jahre später, als ich mit dem Landwirtschaftlichen Verein Neuteich eine zweitägige Reise nach Königsbergu. Trakehnen mitmachte, die uns zuerst zu den Versuchsgütern der Universität Quednau u. Waldgarten führte, wo uns Professor Backhaus das damals beginnende Versuchswesen in der Praxis vorführte u. ebenso einen elektr. betriebenen Pflug. Wir nahmen beide sehr gepriesenen Fortschritte in der Landwirtschaft zur Kenntnis, ohne vom Wert derselben sehr überzeugt zu sein. Nach einem kurzen Besuch im Königsberger Tiergarten, fuhren wir nach Trakehnen weiter, wo die großen Stutenherden (je etwa 100 Füchse, Rappen u. braune) frei auf den Weiden von einigen berittenen Wärtern gehütet wurden. Es war schon ein schönes Bild, wie auch die Fohlenherden. Auch die jungen ein u. zweijährigen Hengste waren auf der Weide, aber diese hatte man doch ordentlich eingezäunt. Die Nacht verbrachten wir in Trakehnen, das mit großen Gasthäusern schon auf solche Massenbesuche eingerichtet ist. Es wurde ein recht vergnügter Abend. Nachdem wir am nächsten Vormittag noch Wettrennen mit jungen Hengsten in der dortigen Rennbahn gesehen hatten, traten wir sehr befriedigt die Rückreise an, die in Königsberg noch einmal auf ein paar Stunden unterbrochen wurde, um auch die berühmte Fleckküche besuchen u. einige Teller Königsberger Rinderfleck an der Quelle einnehmen zu können. – Die Fleck bei meinem Bruder im weißen Lamm im Marienburg schmeckte mir besser.
Ich kehr[t]e nun zur Auflösung unserer Brodsacker Wirtschaft zurück u. begab mich nach den nötigen Vorbereitungen auf einen Monat Mitte Mai auf Reisen, wozu meine liebe Frau, wenn auch schweren Herzens, ihre Zustimmung gab. Schwiegermutter hatte versprochen, ihr während meiner Abwesenheit zur Seite zu stehen. Sie hatte 7 Kinder zu hüten u. erwartete zum August das 8te. Aber sie hatte wenigstens keine Wirtschaftssorgen. Den Hofraum u. die Gebäude hatte ich noch zurückbehalten. Die Brandkassenentschädigung war auch noch nicht geregelt, da die Feuerkasse mir nur die Hälfte des 6000 M. betragenden Brandgeldes ausgezahlt hatte u. die 2te Hälfte erst zahlen wollte, wenn auf der Brandstelle irgendein Gebäude gebaut war. Daher verzögerte sich die endgültige Regelung meiner Brodsacker Angelegenheiten bis zum Frühjahr 1909. Das Resultat habe ich aber bei Schilderung des Verkaufes meines Landes schon geschildert.
Für meine auf etwa 4 Wochen bemessene Reise hatte sich noch ein Bekannter, Cornelius Epp Niedau, zu mir gesellt, der ebenfalls seinen Hof verkauft hatte u. eine kleine Pause bis zum Ankauf eines andern Hofes einlegen wollte. Die vorgesehene Reise sollte über Berlin n. Hannover u. Köln rheinaufwärts bis Basel führen, von dort weiter Rheinaufwärts bis Lindau am Bodensee u. dann über München u. Berlin nach Hause. Von Basel war event. eine 2 wöchige Reise in die Schweiz vorgesehen.
Über diese Reise habe ich seinerzeit ein Tagebuch geführt, in doppelter Ausfertigung, für mich u. meinen Reisekameraden. Die Bücher sind beide auf unserer Flucht aus dem Osten verloren gegangen u. sie noch einmal aus dem Gedächtnis zu schreiben, ist mir unmöglich. Ich muß mich also schon auf eine Schilderung in großen Umrissen beschränken.
In Berlin, wo meine Schwester Helene mit ihrem Mann Johannes Fieguth u. ihren 3 Jungens wohnte (Die Tochter Anneliese war noch nicht geboren) wurde erste Station gemacht. Es hatte sich doch manches verändert, seit ich vor 20 Jahren zum letztenmal dort weilte.
Am königlichen Schloß war das große Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. erbaut, etwas gar zu sehr beengt von dem Schloß selbst u. dem vorbeifließenden Gewässer, am Lustgarten war der Dom, die Kaiser Wilhelmgedächtniskirche und vor dem Brandenburger Tor das neue Reichstagsgebäude erbaut. Automobile sausten durch die Straßen, wenn auch nicht in der beängstigenden Masse u. Schnelligkeit heutigen Tages. Die Puppchenallee mit den hohenzollernschen Königen u. Kurfürsten seit 1415 war erstanden, das Charlottenburger Mausoleum war noch immer eine Stätte weihevoller Andacht, ebenso Sanssouci in Potsdam, aber die alten Kasernen, in deren einer ich vor 20 Jahren meinen Schulkameraden Franz Dyck besucht hatte, der sogenannte lange Stall der ersten Gardeulanen, war abgebrochen. Er war auch wirklich nicht zu schade dazu. Sanssou-ci aber war in alter Pracht erhalten. Auch Babelsberg, der bescheidene Sommersitz Wilhelms I. u. die unweit befindliche Pfaueninsel hatte sich nicht verändert. Die Pfauen schlugen ihr Rad, wie je.
Nach einigen Tagen herzlichster Gastfreundschaft bei meinen Geschwistern setzten wir unsere Reise in einer Tour bis Köln fort. Die niedersächsischen, westfälischen Bauernhäuser, die wir bisher nur aus Bildern kannten konnten wir hier, allerdings nur im vorbeifahren, studieren, wie auch das Kaiserdenkmal an der Porta.
Als wir bei Köln den Rhein überquerten, da gab es die erste Enttäuschung: der schöne grüne Rhein führte genauso dreckiges Wasser, wie unsere alte Pollakenweichsel. Dom, Rathaus u. Gürzenich fanden unsern ungeteilten Beifall, aber am schönsten war ein Spaziergang über die Ringe, die in Anlagen umgewandelten Festungswälle u. Gräben. Da duftete der Flieder in seiner vollen Blütenpracht u. als wir in dem lieblichen Siebengebirge den Petersberg u. den Drachenfels besucht hatten, besserte sich unsere Ansicht vom grünen Rhein etwas. Bonn, damals noch kleine Universitätsstadt, u. Neuwied wurden nur flüchtig berührt, aber von Koblenz hatten wir bei unserm nahen auf dem Wasserwege einen phantastischen Eindruck. Es war gegen Abend u. stark nebelig geworden, als wir plötzlich zu unserer Rechten aus dem Nebel einen Reiter auftauchen sahen. Es war eines der stattlichsten Reiterstandbilder, die ich gesehen habe. Dem 2. Weltkriege fiel auch dieses Kunstwerk zum Opfer. Das Wetter war trübe, kühl u. regnerisch geworden, als wir von Koblenz am nächsten Tage den schönsten Teil der Rheinfahrt nach Rüdesheim antraten. Der Dampfer, der 1000 Personen aufnehmen konnte, hatte nur etwa 10-20 Passagiere, die sich mit Grog warmhalten mußten, aber die Sicht war nicht schlecht u. daß man auf dem Dampfer ungehindert nach beiden Seiten gehen u. sich das viele Sehenswerte auf dieser Tour ohne Gedrängele u. in Muße betrachten konnte, hatte auch seinen Vorteil, den ich bei einer viel späteren Rheintour mit meiner Frau schmerzlich vermißt habe. Das Niederwald-Denkmal, von dessen Höhe wir einen herrlichen Blick in das gegenüberliegende Nahetal hatten, Wiesbaden mit seinen für eine rheinische Stadt besonders regelmäßig angelegten Straßen, seinem pompösen Kurhaus mit Kochbrunnen u. der wundervollen griechischen Kapelle auf dem Neroberg und Frankfurt mit Römer u. Palmengaraten ziehen, wie im Traum, an meinem Geiste vorüber. Das Wetter war seit einigen Tagen schlecht u. so beschlossen wir, schleunigst in die Schweiz zu fahren, um diesem elenden Wetter zu entgehen. Auf dem Bahnhof lasen wir: „großer Wettersturz in der Schweiz, in Interlaken 30 cm Schnee!“ Aber wer a gesagt hat, muß auch b sagen u. so fuhren wir, wenig begeistert, nach Basel u. lösten uns dort für 26 Schw. Franken einen Paßpartou für 2 Wochen, der uns zur beliebigen Benutzung aller Bahnen u. Dampfer berechtigte. Am nächsten Tage besserte sich auch das Wetter u. blieb schön, bis auf die beiden letzten Tage in der Schweiz. Als wir nach einem kurzen Aufenthalt in dem sehr interessanten Bern am Abend in Interlaken eintrafen, war der Schnee schon wieder weggetaut, hatte aber doch erhebliche Schäden an den vollbelaubten Bäumen u. auf den Bergwiesen angerichtet, deren üppiger Grasbestand von dem Schnee ins Lager gedrückt war und nun vorzeitig gemäht werden mußte.
In Interlaken streiften wir eifrig u. wissensdurstig die schöne Umgebung ab, machten auch einige Bergfahrten mit Seil oder Zahnradbahn, z. B. auf den nahegelegenen „Harder“ u. zur kleinen Scheidegg. Auf der Scheidegg überraschte uns Schneegestöber u. hielt uns von der weiteren Fahrt per Seilbahn auf den Jungfraugipfel ab. Wie wir später hörten, hatten wir auch nichts versäumt. Die bedauernswerten Passagiere hatten oben 8 Stunden im Nebel sitzen müssen. Unsere weitere Reise führte uns dann über Lausanne nach Genf u. von dort über Montreux u. Zweisimmen, wo wir übernachteten, zurück nach Interlaken. Die lange Dampferfahrt auf dem Genfer See u. die Fahrt mit der Zahnradbahn von Montreux nach Zweisimmen, dem Centralpunkt der Simmentaler Zucht, waren herrlich u. lehrreich. Von Genf ist mir besonders das Braunschweig Denkmal [Monument Brunswick] am Hafen u. der Blick von hier auf den Mont Blanc in Erinnerung geblieben. In Luzern u. am Vierwaldstätter See haben wir dann einige schöne Tage verlebt. Von Luzern ist mir besonders die eigentümliche Kappel Brücke u. der Gletschergarten mit dem Löwendenkmal in Erinnerung geblieben. Nach einem längeren Spaziergang auf der Axenstrasse von Brunnen zur Tellkapelle entschlossen wir uns kurzhändig, noch schnell einen Tagesausflug nach Mailand zu machen, unterrichteten telef. unsere Wirtin in Luzern u. fuhren gleich nach Göschenen, kurz vor dem Gotthardtunnel. Die Eisenbahnfahrt vom Vierwaldstätter See zum Gotthardt-Tunnel ist schon ein Erlebnis für sich. Die vielfachen Kehren in Bergtunneln, die mehrfache Überquerung der Reuß u. daß man dadurch einmal mit Strom, dann wieder gegen den Strom fährt, machen den unerfahrenen Reisenden fast ein bischen verrückt. Zum Beispiel kommt man an einer Kirche vorbei, die hoch oben auf einem Berg liegt, nach einer Weile kommt man wieder an der Kirche vorbei, aber in gleicher Höhe mit der Kirche u. wieder nach einer Weile kommt man zum drittenmal an derselben Kirche vorbei, aber jetzt liegt sie tief unter uns im Tal. Durch die dauernden Kehren im Berge hat sich der Zug hoch geschraubt. Als wir uns in Göschenen Quartier besorgt hatten, gingen wir noch ein bischen an der Reuß aufwärts bis zur Teufelsbrücke spazieren u. sahen dem tosenden Bergfluß zu, wie sein Wasser durch das starke Gefälle in tosenden Gischt verwandelt wurde. Die Nacht wurde schon sehr kurz, da wir Morgens 1 Uhr von Göschenen nach Mailand abfahren wollten. Es gelang uns auch nur ganz knapp, rechtzeitig auf dem Bahnhof zu sein u. gleich darauf tauchten wir in den Tunnel ein und die Luft wurde trotz geschlossener Fenster bald recht schlecht u. wir waren froh, als der 22 klm. lange Tunnel durchfahren war u. wir die Fenster öffnen konnten. Es war noch recht früh in Mailand, als wir um 6 Uhr dort eintrafen u. besonders früh sah es in den eigentümlichen Abortanlagen des Bahnhofs aus. Aber wir hatten den Dom als Ausgangspunkt für unsere Unternehmungen dieses Tages ins Auge gefaßt u. kamen auch mit einigen Schwierigkeiten dahin u. bestellten uns zunächst erst mal in einem nahegelegenen Gasthaus ein ordentliches Frühstück. Mein Reisegefährte war schon etwas mürrisch, wegen der schwierigen Sprachverständigung, und als der Kellner nun noch für jeden eine große Kanne Milch u. nur wenig Kaffee brachte, wo er doch das Gegenteil erwartet hatte, da machte er den Vorschlag, aus dieser poalschen Gegend schleunigst wieder abzureisen, wogegen wiederum ich energisch protestierte. Aber wir hatten Glück; nach kurzer Zeit sprach uns auf deutsch ein einfach, aber gut gekleideter Mann an u. erbot sich, uns für 3 M. u. Mittagessen den ganzen Tag zu führen. Das nahmen wir denn beide gern an. Unser Führer war nach seinen Angaben ein gestrandeter Kaufmann aus Lübeck. Unter seiner Führung sind wir im Dom u. auf dem berühmten Friedhof – cimittero monumentale [gewesen]. Es ist kein Friedhof nach unsern Begriffen, sondern wir würden es für eine große Kunstausstellung [halten], auf die näher einzugehen, hier nicht der Platz ist. Mit erschütternder Realistik ist hier oft der Toten gedacht, die hier nur in Urnen beigesetzt werden dürfen. Auch dem einfachen Mann ist hier ermöglicht, in einem verschließbaren Fach, wie in einem riesigen Safe, seine letzte Ruhestätte zu finden.
Als wir mal unterwegs vor einem Friseurladen auf Freund Epp warten mußten, der sich gerade rasieren ließ, fragte mich unser Führer: „Wie lange sind Sie schon unterwegs?“ Als ich antwortete: „3 Wochen“, sagte er: „Ihr Reisegefährte kann schon nach Hause fahren, der sieht nichts mehr.“ Das Gefühl hatte ich auch. Wir haben uns dann noch ein bischen in der großen Stadt umgesehen u. auch noch eine Kirche u. anderes besucht u. in einem einfachen Restoranto Mittag gegessen u. unser Führer wollte uns noch immer mehr Sehenswürdigkeiten zeigen, aber nun war auch ich müde geworden u. so brachte uns unser Führer noch zum Bahnhof und um 4 Uhr Nachm. fuhren wir wieder ab u. waren um 10 Uhr in Göschenen in dem Hotel, das wir morgens um 1 Uhr in stürmischer Eile verlassen hatten. Nachdem wir gut ausgeschlafen hatten nach dem anstrengenden Tag u. über den Urner Teil des Sees zur Schwurwiese u. dem Hotel Sonnenberg, schräg gegenüber Brunnen, gefahren waren, [trafen] wir unterhalb dessen auf eine spitze, natürliche 17 m. hohe Felsnadel, die unweit des Ufers aus dem Wasser ragt und die Inschrift trägt: „Friedrich Schiller, dem Sänger Tells, die dankbaren Urkantone.“ Der Dampfer, der uns nach Luzern bringen sollte, trug auch eine Schulklasse, die das Lied sang: In der Heimat ist’s am schönsten. „Dat’s uck woahr!“ rief mein Reisegefährte aus u. am nächsten Tag fuhr er ab, direkt nach Niedau.
Ich war noch nicht so reisemüde u. fuhr am nächsten Tag nach Zürich weiter. Auf der Reise gab es ein heftiges Donnerwetter u. das Wetter kühlte sich erheblich ab u. blieb fast eine Woche regnerisch. Ich hielt mich daher nur einen Tag in Zürich auf, fuhr nach Schaffhausen, mir den Rheinfall anzusehen u. weiter nach Konstanz, wo ich am Pfingstabend eintraf. Das miserable Pfingstwetter hielt an u. ich fuhr per Dampfer über den schönen Bodensee nach Lindau u. weiter nach München, wo ich am 1. Pfingsttag Abends im Hofbräuhaus landete. Nach ein paar Tagen München u. noch einem Tag Aufenthalt in Berlin, war ich am 14. Juni wieder zu Hause, sehr herzlich begrüßt von den Meinigen.
So war mein sehnlichster Wunsch, mal etwas von der Welt zu sehen, erfüllt und ich bin auch heute in meinen alten Tagen der Ansicht, daß die 500 M., die mich diese Reise gekostet hatte, gut angelegt waren.
Ich übernahm nun wieder meine Amtsgeschäfte als Gemeindevorsteher u. Rechner des Eichwalder Raiffeisenvereins u. arbeitete an meinen „Reiseerinnerungen“. Aber in der Hauptsache beschäftigte ich mich doch mit der Beschaffung einer neuen Existenz, wobei ich auch andere Möglichkeiten, als nur Landwirtschaft, ins Auge faßte. Aber ich mußte bald feststellen, daß ich mich doch nur zum Bauern, eventuell mit etwas Nebenbeschäftigung, eigne u. begab mich auf die Suche nach einem passenden Hof. Bin auch in Gesellschaft meines Schwagers Gustav Wiebe einmal ein paar Tage durch Ostpreußen gefahren u. habe Landsleute, die dorthin gezogen waren, besucht u. mit deren Hilfe einige Grundstücke besichtigt, die dort zum Verkauf standen. Aber was ich haben wollte, Schulen in der Nähe, war dort überhaupt nicht angeboten. Unter anderem war ich auch bei Enß Reginenhof i. Brandenburg Ostpr., der sich besonders bemühte, Landsleute aus dem großen Werder in seiner Nähe seßhaft zu machen. Auch im großen Werder war ich herumgefahren u. besah mir einige Höfe, die mir z. T. durch Schneidemühl angeboten waren. Ich war bei Pohlmann Fürstenwerder, Wiebe Gr. Mausdorf, Wiebe Tannsee, Schulz Altweichsel, aber in Liessau war ich nie. Den Winter 08-09 verlebten wir noch in aller Ruhe in Brodsack, und als der Frühling kam, ging ich wieder einmal zu Herrn Schneidmühl. Da sagte er mir wörtlich: „Ich begreife Sie nicht, Herr Wiebe, daß Sie nicht einmal nach Liessau fahren. Da haben Sie doch alles, was sie sich wünschen; da sind Schulen, in dem nahen Dirschau für Jungen, auch Mädchen, u. der Schulweg führt nirgends durch freies unbebautes Land. Da haben Sie im Dorf eine gute Volksschule, eine Zuckerfabrik, Bahnhöfe von Staatsbahn u. Kleinbahn, Molkerei, Materialwarengeschäft u.s.w. Ich gebe zu, daß der Hof von seinem gegenwärtigen Besitzer schlecht bewirtschaftet ist, aber das werden Sie in einigen Jahren schon in Ordnung bringen!“
Das war gut gesprochen u. fiel bei mir auch auf guten Boden. Ich überwand also meine Scheu vor Liessau, die wohl einem gewissen Minderwertigkeitsgefühl entsprang u. fuhr nach Liessau. Und als ich den Hof, der damals von dem Schwiegersohn des Besitzers Albert Friedrich Gr. Lichtenau bewirtschaftet wurde, einmal besehen hatte, für den 212000 Mark gefordert wurden, da stand es bei mir sofort fest: Den Hof kaufst du!
Aber der Preis erschien mir zu hoch u. ich fuhr einstweilen unverrichteter Dinge nach Hause u. verhandelte mit der Gemeinde wegen Ankauf des Hauses u. mit Neufeld Peterswalde wegen Ankauf der Scheune u. mit der Feuerversicherung wegen der restlichen 3000 M. Brandgeld, die zu dem schon vorweggenommenen guten Ende führten. Mitte Mai erfuhr ich, daß wieder Hochwasser in der Weichsel wäre und da ich schon von anderer Seite vor dem Quellwasser in Liessau gewarnt war, fuhr ich sofort noch einmal nach Liessau u. fand meine schlimmsten Erwartungen bestätigt. Auf einem mit Zuckerrüben bestellten Ackerstück standen mehrere Morgen unter Wasser, auch sonst waren vielfach Quellschäden bemerkbar. Aber andererseits waren die Felder alle sauber bestellt u. kamen mir garnicht besonders verwahrlost vor. Über den Preis verhandelten wir diesesmal nicht, der Besitzer war wohl auch etwas bedrückt über die Quellschäden, die sich mir boten. Ich fuhr also nach Hause u. schrieb an Schneidemühl, der doch offenbar hier der maßgebende Mann war, folgenden Brief:
„Sehr geehrter Herr Schneidemühl!
Ich bin gestern noch einmal in Liessau gewesen u. fand meine schlimmsten Erwartungen betr. Quellwasserschäden noch übertroffen. Auf einem großen Zuckerrübenschlag am Weichseldamm gingen die Wogen, von andern kleineren Quellschäden ganz zu schweigen. Ich biete Ihnen trotzdem 206 000 M. unter folgenden Bedingungen: 1. Ich zahle Ihnen 50 000 Mark, zur Hälfte in baar, zur Hälfte in Forderungen an meine Brodsacker Nachbarn aus der Hofparzellierung in Brodsack.
2. Ich übernehme die eingetragenen Hypotheken einschließlich der Kleckerschulden (den 5 kleinen Hypotheken) von etwa 70 000 Mark u. Sie garantieren mir dafür, daß mir diese Kleckerschulden bei pünktlicher Zinszahlung 10 Jahre nicht gekündigt werden u. nicht mehr als 4% Zinsen pro Jahr kosten.
3. Das Restkaufgeld ist ebenfalls 10 Jahre bei pünktlicher Zinszahlung unkündbar u. kostet ebenfalls 4% Zinsen.
Ich fahre morgen noch einmal nach Ostpr., wo mir ebenfalls einige Objekte angeboten sind. Bevor ich dort abschließe, werde ich noch einmal telegr. anfragen, ob Sie mit meinem Angebot einverstanden sind.
Hochachtungsvoll H. Wiebe.“
Am nächsten Tage Nachm. 5 Uhr hatte ich auf meine telegr. Anfrage folgende Drahtantwort in Händen: Ihr Gebot angenommen, bitte morgen in Marienburg bei Justizrat Hartwich zur Verschreibung Schneidemühl“.
So wenig ist wohl selten um ein Grundstück verhandelt worden.
Am 1. Juni 1909 erfolgte die Übergabe, der Umzug konnte erst am 3. Juni, der Pfingstfeiertage wegen, beginnen.
So waren wir nun Liessauer geworden, unter welcher Bezeichnung uns unsere Verwandten u. Bekannten 36 Jahre angeredet haben. Es war ein großes Wagestück, aber der Himmel ist uns gnädig gewesen durch 36 Jahre. Wenn auch nicht alles nach Wunsch gegangen ist. So bin ich doch im Stande gewesen, mein unverrückt im Auge behaltenes Ziel, meinen vielen Kindern eine gute Schulbildung zu Teil werden zu lassen, zu erreichen.
Ich war nun aller Ämter ledig u. konnte mich vollständig meiner neuen Wirtschaft widmen. Wenn der Hof von 95 ha, zu dem noch 13,5 ha Pachtland gehörten, die Alb. Friedrich soeben von der Gastwirtin Ww. Ottilie Neumann Liessau für 700M. pr. Jahr gepachtet hatte, bei weitem nicht so schlecht war wie sein Ruf, so war doch mancherlei sehr verbesserungsbedürftig.
Das ganze lebende u. tote Inventar war kaum mittelmäßig, einen eigenen Dreschsatz besaß ich zunächst noch nicht u. an Stall, Schweinestall u. Speicher, waren allerhand Herstellungsarbeiten notwendig, die ich sofort in Angriff nahm, aber meine größte Sorge war doch der Acker, auf dessen Erträge ich vor allen Dingen angewiesen war. Da fehlte zunächst wieder die Kalkung, die fast vollkommen fehlte u. auch für etwa 20 ha. die Drainage, wie sich bald herausstellte. Das waren zwei kostspielige Probleme, auf die ich mich besonders konzentrieren mußte. Die Ernte 1909 war mittel, aber die Ausgaben, Ausbesserung der Gebäude u. Beschaffung des mangelnden Inventars, wozu auch ein eigener Dreschsatz gehörte, hatte meine Einnahmen doch wesentlich überschritten u. ich mußte meine Schwiegermutter noch einmal um ein Darlehen von 10000 Mark bitten, welches mir auch gewährt wurde. Das war das letzte mal, daß ich mir Geld leihen mußte. Es drückte mich nicht sonderlich schwer, da meine Frau diesen Betrag ja einmal erben sollte. Die Felder waren lange nicht in dem Umfang verqueckt, wie ich angenommen hatte. Der zweijährige Kleeschlag, den ich nach der Heuernte brachte, war allerdings gründlich verqueckt, aber ich konnte ihn, trotz ungünstigen Brachwetters, von diesem lästigen Unkraut einigermassen befreien. Die mannshohe Hedrichkultur, die sich nach der Ernte auf diesem Felde entwickelte, machte mir mehr Sorgen; die Schadenfreude lieber Mitmenschen garnicht gerechnet. Ich getraute mir nicht, diesen Hederichwald mit meinen Pferdegespannen unterzupfügen u. lieh mir den Dampfpflug, der in Liessau u. Umgebung schon segensreich seit mehr als 30 Jahren gewirkt hatte, nur auf meinen Feldern nicht. Von da ab pflügte der Dampfpflug regelmäßig in jedem Jahr wenigstens die Felder, die im kommenden Jahr mit Zuckerrüben bestellt werden sollten. Die Getreide u. Rübenernte war 1909 gut mittel, aber als der Winter sehr früh (Mitte November) mit viel Schnee einsetzte, war der Zuckerrübenacker aus der Ernte 1909 noch nicht gepflügt, aber glück[licher]weise das Land zum Rübenanbau 1910. Die Pflugarbeit mußte bis Jan. 1910 unterbrochen werden u. ich ging an die Anfuhr der 6000 Ctr. Kalkschlamm, die mir durch die Gunst meiner Nachbarn Ziehm Liessau ausnahmsweise in dieser Höhe bewillig wurden, der damals maßgebend für den Dampfpflug u. auch für die Zuckerfabrik war. Da der Boden unter dem vielen Schnee nicht überall gefroren war, mußte ich den Kalkschlamm zunächst neben den zu kalkenden Feldern in den Chausseegraben werfen, was wieder vom Kreiswegemeister gerügt wurde. Sofort nach Neujahr war der Boden soweit abgetaut, daß ich meine Pflugarbeiten beenden konnte u. Ende Februar kam noch gerade soviel Frost, daß ich den sämtlichen Kalkschlamm auf die Felder bringen konnte, was meinem Rübenanbau 1910 sehr nützlich war. Der Frühling 1910 setzte sehr früh ein und die Felder sahen alle gut aus, aber die Ernte enttäuschte doch etwas u. besonders die Getreidepreise waren zurückgegangen, erholten sich aber bald wieder. Von 1911 ab hatten wir eine Reihe von guten Jahren, die 1911 wieder von einem Brandschaden beeinträchtigt wurden. Am 6. September 1911 brannten Scheune u. Stall nieder. Diesesmal war es sicher böswillige Brandstiftung; der Täter wurde nicht ermittelt, aber wenn er etwa gehofft hatte, mich empfindlich zu schädigen, so war er sehr im Irrtum. Ich war gut versichert u. das bauen war damals verhältnismäßig billig (Erstklassige Mauersteine wurden mir für 24 Mark je tausend auf den Hof gestellt). Und so konnte ich für das Brandgeld den Stall um 50% verlängern u. die Scheune um 1 m. erhöhen und die notwendigen Zäune setzen. 1911 hatte ich das Amt eines Molkereigenossenschaftsvorstehers u. 1912 das Amtsvorsteheramt als Nachfolger von Ziehm Liessau übernommen, zu dem noch 1913 das Gemeindevorsteheramt in Liessau kam. Ich war jetzt doch wieder ganz im Brodsacker Fahrwasser.
Im Herbst 1911 hatte ich mit dem drainieren begonnen u. es gelang nicht nur, die am 6. September abgebrannten Gebäude wieder aufzubauen, sondern auch crc. 15 pr. Morgen zu drainieren. Das Land, das ich drainiert hatte, lag hart an der Kl. Lichtenauer Grenze u. war etwa 1590 bei einem Weichseldammbruch mit vielem andern Liessau’er u. auch etwas Damerau’er u. Kl. Lichtenauer Land, versandet. Der Sand lag 60-80 cm. hoch auf undurchlässigem blauen Tonuntergrund. Albert Friedrich, der, wie ich schon erwähnte, ein Jahr lang vor meiner Hofübernahme meinen Hof bewirtschaftet hatte, versuchte im Jahr 1908, dieses Land mit einem Tiefrajolpflug in Kultur zu bringen, aber das war ihm nur sehr unvollkommen gelungen. Der Pflug hatte zwar überall den tonigen Boden gefaßt, aber der Ton war nur sehr unregelmäßig in die höheren Landschichten gelangt u. wo ein Stück dieses Tons an die Oberfläche gekommen war, da dauerte es 10 Jahre, bevor der Winterfrost diese Kluten total aufgelöst u. mit dem Sandboden vermischt hatte. Eine wesentliche Bodenverbesserung war also doch festzustellen, aber das Übel der Undurchlässigkeit war dadurch nicht beseitigt u. der Schachtelhalm (Hermos) wuchs halbmeter hoch auf dem Felde. An die Beseitigung dieses Übels ging ich nun mit Hilfe des Kultur Ingenieurs Senk [?]Wandaub. Marienwerder mit gutem Erfolg heran. Das Land wurde mit 12 m. Strang weiter systematisch auf eine Tiefe von 60 bis 90 cm drainiert. Verwendet wurden zu den Saugern 5 cm u. zu den Sammlern 7 ½ -10cm. Tonröhren. Die Kosten stellten sich auf etwa 250 Mark pr. ha. Der Erfolg war durchschlagend. In 2-3 Jahren war der Schachtelhalm verschwunden u. das Land, das ich bisher immer erst zuletzt im Frühjahr bestellen konnte, war jetzt zuerst trocken. Es trug zwar keinen Weizen, aber alle andern Früchte konnte man mit Erfolg anbauen. In dieser Weise habe ich dann bis 1920 noch etwa 16 ha weiteren Landes drainiert. Es lag nicht immer an dem undurchlässigen Untergrund, sondern auf den sehr schönen, milden u. sehr durchlässigen Böden am Damm diente die Drainage nur zur Ableitung des Quellwassers. Aber sie hat auch hier gute Dienste geleistet. Während des 1. Weltkrieges haben mir die vielen Kriegsgefangenen gute u. billige Dienste dabei geleistet.
Die Kalkung der Böden wurde konsequent fortgesetzt. Man konnte hier aber schon mit kleineren Kalkgaben zum Ziel kommen, wie in Brodsack. Bei der ersten Kalkung wurden crc.400 Ctr. Kalkschlamm pr. ha. gegeben, bei den späteren Kalkungen kam man schon mit 200 Ctr. aus. Die eigenen Fabriken im großen Werder produzierten nicht ausreichend den notwendigen Bedarf. Da mußte denn von auswärts Kalkschlamm zugekauft werden, was in meiner Liessauer Zeit schon die hiesigen Zuckerfabriken übernahmen und uns den Kalkschlamm zu einem erschwinglichen Durchschnittspreis von etwa 25 Pf. pr. Ctr. fr [Fracht?] hiesiger Vollbahnstation zur Verfügung stellten. In Ausnahmefällen wurde auch mal Kalkmergel angewendet oder auch Brandkalk, der in Erdmieten gelöscht wurde, aber die Hauptsache blieb uns der Scheideschlamm der Zuckerfabriken, der auch erhebliche Beimengungen anderer Nährstoffe enthielt. Auf diese Weise war ich in Brodsack ohne weitere Gaben von chemischem Dünger ausgekommen, aber in Liessau wurden von Anfang an pr. ha. 4-5 Ctr. eines zwanzigprozentigen Stickstoffdüngers zu Rüben gegeben, später auch etwas mehr, aber nie in dem Umfang wie hier in Westdeutschland. In Getreide etwa die Hälfte, Kali u. Phosphorsäure wurden, abgesehen von unsern Sandböden, wenig verwendet. Es waren, wie ich schon erwähnte, bis zum Beginn des ersten Weltkrieges gute Jahre für die Landwirtschaft, auch für mich u. 20 000 Mark hatten wir bis dahin zurücklegen können. Aber dann brachte uns der Krieg in erhebliche Aufregung. Die wehrpflichtigen Leute bis 45 Jahren mußten sofort eintreten, auch der Landsturm. Am dritten Mobilmachungstage wurden mir bei der Pferdeaushebung 7 Pferde abgenommen u. für damalige Verhältnisse gut bezahlt. Aber sie fehlten zunächst doch im Betriebe u. konnten auch vorerst nicht durch Zukauf ersetzt werden. Die Getreideernte war mit Hilfe weiblicher Arbeitskräfte, die sich Anfangs sehr bereitwillig zur Verfügung stellten, rechtzeitig geborgen werden. Aber mit der großen Zuckerrübenernte sah es zunächst sehr kritisch aus. Aber in der Schlacht von Tannenberg waren hunderttausende von Russen in deutsche Gefangenschaft geraten u. als deren Unterbringung erst geregelt war, wurden uns genügend Gefangene zur Verfügung gestellt, daß wir unsere Rübenernte bergen konnten. Aber nun war noch ein anderer Übelstand, besonders für Liessau u. Umgebung. Die Liessauer Zuckerfabrik war 1913 im Zuge der letzten Phase der Weichselregulierung stillgelegt, und die Zuckerrübenbauern konnten ihre Rüben 1913 nach Schwetz u. benachbarte Fabriken liefern. Für 1914 hatte die Zuckerfabrik Dirschau mit uns Verträge abgeschlossen u. baute die Fabrikanlage entsprechend größer aus. Bei diesem Umbau war Dirschau vom Kriege überrascht, konnte den Umbau nicht beenden; auch wurden ihre ganzen Räume von der Heeresverwaltung für Kriegsdepotzwecke beschlagnahmt. Sie erklärte daher kurz u. bündig unsere Rübenanbauverträge für null u. nichtig und kümmerte sich auch nicht weiter um uns. Wir mußten nun jeder für sich sehen, wie wir unsere große Rübenernte am besten verwerten konnten. Schließlich machten wir Liessauer mit Praust Vertrag u. wurden die Rüben zu dem „horrenden“ Preis von 70 Pf. pr.Ctr. los. Andere bekamen von Tiegenhof nur 50 Pf. und im nächsten Jahr 1915 wurde auf Anordnung der Regierung der Zuckerrübenbau soweit eingeschränkt, daß ich anstatt 17 ha nur 3 ha. Rüben anbauen konnte. Der große Überstand an Zucker u. auf der andern Seite der Mangel an Getreide hatte zu dieser Maßnahme gezwungen. Damit mußten wir uns abfinden, und wir erklärten uns auch bereit, diese kleine Rübenmenge trotz des eigenartigen Verhaltens der Zuckerfabrik Dirschau im Jahre 1914 nach Dirschau zu liefern, wollten aber von Dirschau für unsere Verluste von 1914 entschädigt werden. Dirschau hatte nämlich von der Heeresverwaltung eine große Entschädigung erhalten, war also recht wohl im Stande, ihre neuen Kunden in Liessau nun auch ihrerseits zu entschädigen. Trotz aller Versprechungen war aber nichts geschehen, was mich dazu zwang, in den neuen Vertrag für 1916 die Bedingung einzusetzen, daß dieser Vertrag ungültig würde, wenn bis 1. August 1916 meine Forderung aus 1914 nicht erfüllt sei. Sie wurde nicht erfüllt u. ich verkaufte daher meine Rüben, die inzwischen wieder in altem Umfang angebaut werden konnten, an die Zuckerfabrik Pelplin u. meine Nachbarn taten dasselbe. Und so haben wir dann 4 Jahre lang nach Pelplin geliefert u. waren mit Pelplin sehr zufrieden. Soweit das Verhältnis von uns Liessauern zu Dirschau u. Pelplin.
Bald nach Kriegsausbruch und nachdem abzusehen war, daß der Krieg sich über Jahre hinziehen würde, setzte die Regierung die Preise für landw. Produkte um etwa 50% herauf. Wir bekamen also für unsern Weizen etwa 15,00 M. u. für Zuckerrüben 1.50 M pr. Ctr u. für die Milch etwa 15 Pf. pr. Liter. Das sind Preise, die nicht annähernd an die diesbezügl. heutigen Preise heranreichen. Aber diesen, für Kriegszeiten ungewöhnlich niedrigen Preise, stand auch manche sehr erhebliche Vergünstigung gegenüber. Da waren zunächst die Kriegsgefangenen, sie schon im Herbst 1914 unsere Helfer in großer Not gewesen waren u. vom Frühjahr 1915 bis Kriegsende bei uns blieben. Sie erhielten ihre Löhnung von der Heeresverwaltung u. dieselbe zahlte uns noch etwa 40 Pf. Beköstigungszuschuß pr. Kopf u. Tag, ebenso war es mit dem Wachmann, der doch auch die Aufsicht über die Gefangenen bei der Arbeit hatte. Das war eine große Ersparnis für uns. Dann waren die Einkommensteuern für den Bauern im allgemeinen recht niedrig u. betrugen z.B. für mich, wegen meiner hohen Verschuldung u. meiner 10 Kinder nur 44.00 M. pr. Jahr, nicht von mir deklariert, sondern von der zuständigen Voreinschätzungskommission festgesetzt. An dieser geringen Steuer wurde weder bei mir, noch bei den andern Bauern während des ganzen Krieges etwas geändert. Ich besteuerte mich aber gewissermassen selbst, in dem ich im Laufe des Krieges 60 000 Mark Kriegsanleihe übernahm.
1916 kaufte ich von der Frau Ottilie Neumann die 13,5 ha. Land, die neben meinem Land lagen u. von mir seit 1909 für 700 M. pr. Jahr gepachtet waren, für 20000 Mark. Ich zahlte 10000 M. an u. der Rest wurde mir auf 10 Jahre gestundet. 1917 trat die Landschaft Westpreußen, von der ich ein erststelliges Pfandbriefdarlehen von 56 000Mark hatte, an mich heran u. bot mir eine Erhöhung des Darlehns auf 120 000 Mark an u. war bereit, meine andern Gläubiger bis zu dieser Höhe abzufinden. Darauf ging ich gerne ein, zahlte auch den Rest des Kaufgeldes an Frau Neumann u. hatte nun nur noch die Pfandbriefschuld an die Landschaft u. das Restkaufgeld an die Mierau’schen Erben. Die mir gelieferten Pfandbriefe wurden von mir aber nicht umgesetzt, da ich das zu erzielende Geld nicht gerade brauchte, sondern in meinem Banksafe eingeschlossen.1919, sofort nach der Revolution, machte ich von dem gesetzlich zugestandenen Recht Gebrauch u. tauschte meine 60 000Mark Kriegsanleihen Mark gegen Mark gegen 60 000 Mark Pfandbriefe ein, die ebenfalls in den Safe kamen. Das Restkaufgeld an die Mirau’schen Erben wurde ebenfalls, noch etwas vor dem Fälligkeitstermin, zurückgezahlt. Und so hatte ich 1919 praktisch eine schuldenfreie Wirtschaft von 108, 8 ha., denn für die einzige, noch eingetragene Landschaftsschuld von 120 000 Mark hatte ich die Pfandbriefe liegen u. konnte noch an meinen Neffen Hermann Fieguth zu seiner Pachtung u. Neubau 25 000 Mark leihen.
Das war das Ergebnis der Kriegszeit für mich. Ich kann meinen Kindern u. Freunden ehrlich bekennen, daß kein Pfennig dieses verhältnismäßig riesigen Gewinnes aus Wucher oder glücklichen Spekulationen entstanden ist, wie es damals leider so häufig war. Ich habe gute Ernten gehabt, aber da ich bis 1920 keiner Züchtervereinigung angehörte, auch keinen besondern Gewinn aus der Tierzucht gehabt. Und in der Lotterie gewonnen habe ich auch nicht.
Unsere deutsche Währung hatte sich bis 1921 gut gehalten. Man sprach zwar von teuren Zeiten, wie man sie in Kriegen immer erlebt hat, aber der Ausdruck „Inflation“ war uns damals noch unbekannt.
Erst die Friedensverhandlungen in Versailles, die riesigen Landabtretungen in West u. Ost, der Verlust sämtlicher Kolonien, die fabelhaften Milliarden Forderungen unserer Gegner brachten das Währungsgebäude ins Wanken.
1921 konnte ich gerade noch rechtzeitig meine 120 000 Mark Pfandbriefe an die Landschaft zurückgeben u. erhielt dafür auch löschungsfähige Quittung und nun war auch mein Grundbuch von allen Hypothekarischen Eintragungen befreit.
Es war doch ein sehr angenehmes Gefühl, auf schuldenfreiem Hof zu sitzen u. sich ohne sonderliche Bedrückung der Erziehung u. Ausbildung seiner Kinder widmen zu können. Die Revolution war in Liessau u. ich glaube auch im ganzen Kreise Marienburg unblutig verlaufen. In Marienburg waren zwar eine Anzahl Geschäfte (besonders Lebensmittel, Genußmittelgeschäfte u. Kleiderläden) geplündert worden. Aber da sich den Plünderern keine Polizei in den Weg stellte, kam es auch dort zu keinem Blutvergießen. In Liessau hatten die heimkehrenden Soldaten sich mehrfach Gewehre und Munition mitgebracht u. gingen nun mit Kugelbüchsen auf Hasenjagd. Sie taten den Hasen zwar wenig zu leide, aber sie brachten doch die Einwohner des Dorfes in Gefahr. Aber als die Munition verknallt war, hörte sich auch die Schießerei auf. Mir selbst haben Langfinger einmal den Fleischkeller ausgeräumt u. einmal 3 Schafe gestohlen. Derartige Räubereien kamen noch Jahre lang vor. Das requirieren lag den ehemaligen Soldaten doch immer noch im Blut.
Die Ortsbehörden hatten sich auf landrätliches Anraten den neuen Machthabern unterstellt. Mich, als Amtsvorsteher, ging das neue Regime weniger an, aber der derzeitige Gemeindevorsteher Schulz, der das im Jahre 1917 von mir abgegebene Gemeindevorsteheramt verwaltete, mußte sich einige Monate die ständige „Aufsicht“ der P.G. [?] gefallen lassen. Das waren übrigens harmlose Menschen, die von Tuten u. blasen keine Ahnung hatten. Und als dann einige Monate nach der Revolution ein P.G. als Gemeindevorsteher gewählt wurde, warf er sofort seine Freunde, die auch bei ihm „das beaufsichtigen“ fortsetzen wollten, vor die Tür.
Dieser P.G. Gemeindevorsteher hätte aber die Aufsicht sehr nötig gehabt, denn einige Jahre später wurde er wegen Unterschlagung von 6000 M. Amtsgelder zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt.
1919 begann dann in der Landwirtschaft u. besonders in Liessau ein frischer Wind zu wehen. Ernst Penner begann schon damals mit eigenen Versuchen u. bearbeitete den schon seit vielen Jahren einflußreichen Nachbarn Ziehm Liessau, Kreis- oder Landesmittel zur Anstellung exacter Versuche in allen landwirtschaftlichen Ackerfragen zu beschaffen.
Nachdem Herr Ziehm 1920 in dem neugeschaffenen Freistaat Danzig Landwirtschafts-Senator geworden war, wurde 1921 der Dipl. Landwirt Emil Wiebe (Schwerkriegsbeschädigter) von Herrn Penner für den neu zu gründenden Versuchsring gewonnen u. auch bei Penner stationiert, der seine Felder zu den geplanten Versuchen zur Verfügung stellte. Andere Mitglieder konnten sich nach Belieben auf ihren eigenen Feldern von Emil Wiebe Versuche anstellen lassen, aber in der Hauptsache waren etwa 10 Jahre lang die Felder Herrn Penners das Hauptversuchsfeld, das von vielen Landwirten des kleinen Freistaates im Sommer besucht wurde. Die Versuche sind sehr wertvoll für uns gewesen.
Wie zahlreich die Früchte waren, die wir nacheinander anbauten, habe ich schon in dem Kapitel „Wirtschaftsweise“ geschildert; wir Liessauer waren am Anbau aller genannten Früchte beteiligt, zum Teil auch als Erstanbauer, aber es waren oft auch andere Gemeinden tonangebend und Jeder lernte gerne vom andern, so daß eine sichtbare Verbesserung der Felder im großen Werder festzustellen war.
Das Vereinsleben war sehr rege. Eine der ersten Neugründungen im Freistaat Danzig war der Rübenbau Verein, der ein gutes Gegengewicht gegenüber der diktatorischen Haltung der Zuckerfabriken war. Der Verein setzte es durch, daß er durch seine Vertrauensmänner jederzeit berechtigt, das wiegen u. Probeputzen zu kontrollieren. Für mich machte das, schätzungsweise, eine Erhöhung meiner Rübenerndte um crc. 10% aus, die ich in einem Durchschnitt der letzten 20 Jahre mehr geerntet habe.
Wenn man es ganz discret ausdrücken will, so war vordem offenbar das „Socialproduct“, in diesem Falle die Zuckerrübe, ungerecht zwischen den Rübenbauern u. den Fabriken [ ] verteilt. Auch die Tierzuchtvereine: Herdbuch Gesellschaft, Stutbuch Gesellschaft für Kalt u. Warmblüter, Schweinezucht Gesellschaft arbeiteten rege. Ich war Mitglied in all diesen Vereinen, aber die Tierzucht lag mir nicht u. habe deshalb auch keine nennenswerten Erfolge erzielt. Ich habe zwar in den beiden Weltkriegen etwa 20 Pferde aus eigener Zucht verkauft, auch zwischendurch noch ab u. zu ein Pferd verkauft, aber Luxuspferde oder Remonten waren nicht darunter. Ähnlich ging es mir in den andern Zuchten.
Meine ganze Liebe war der Acker. Den habe ich gehegt u. gepflegt u. das hat er mir gedankt bis zu meinem letzten Tage in Liessau.
Ich möchte nun über einige Jahre sprechen, die in meiner fast 36jährigen Wirtschaftszeit in Liessau durch abnorme Witterung meine Arbeiten zumeist ungünstig, aber auch einigemale günstig beeinflußt haben. 1912 hatten wir Mitte Mai einige Tage einen furchtbaren Weststurm, der mir von meinen 25 ha Zuckerrüben etwa die Hälfte auswehte u. auch viele Gräben zuwehte. Ich ging noch während des Sturmes zur Zuckerfabrik Liessau u. bestellte 7 Ctr neuen Rübensamen u. bestellte sofort noch einmal die ausgewehten Flächen. Es kam auch recht bald Regen u. die Rüben gediehen gut, konnten aber doch den Vorsprung der früh gesäten Rüben nicht einholen. Dann kam der Sommer u. Herbst, bis etwa den 10. Oktober mit normalem Wetter. Danach gab es 5 Wochen lang Frost, Schnee, Tauwetter, Regen in schnellem Wechsel. Die Rüben wurden mit 6 Pferden in halben Fuhren vom Lande geschleppt u. auch mit halben Fuhren zur nahe gelegenen Abnahmestelle der Zuckerfabrik Liessau in Dauer angefahren. Der Frost verhinderte mehrmals die Fortsetzung der Arbeit u. Mensch u. Tier wollten schier verzagen. Aber nach wochenlangen unendlichen Mühen war am 16. November die Arbeit geschafft u. sämtliche Rüben – 16 500 Ctr. abgeliefert. Aber in diesen Abnahmestellen waren viel angefrorene Rüben abgenommen worden, die zu vielen tausend Ctr. verfaulten. Das war für Liessau die letzte Campagne, die natürlich mit großem Verlust abschloß. Aber die Zuckerfabrik wurde im Frühjahr 1913 von der Strombauverwaltung im Zuge der restlichen Weichselreguierung so gut entschädigt, daß sie diesen Verlust verschmerzen u. ihren Aktionären bei der Abrechnung noch 171 % ihres Aktienkapitals auszahlen konnte. Wir Bauern aber konnten bei trübem stillem Wetter bis 8. Dezember ungestört pflügen u. uns dann einige Wochen wohl verdiente Ruhe gönnen.
1924 hatten wir einen langen schneereichen Winter, der uns am 2. April das größte Hochwasser in der seit 1915 regulierten Weichsel brachte, das ich schon in meinem Kapitel „Entwässerung“ geschildert habe. Wir konnten in diesem Jahr erst am 26. April mit der Saatbestellung beginnen, hatten aber einen so günstigen Frühling u. Sommer, daß wir eine vorzügliche Ernte u. besonders Rübenernte einbringen konnten. In diesem Jahr konnte ich zum erstenmal meine Rübenernte als sehr gut bezeichnen. Sie betrug 800 Ctr. pr. ha. während der gute Durchschnitt meiner Rübenernten 1924-44 bei 720 Ctr lag. 1940, wir waren schon im 2ten Kriegsjahr, hatten wir einen nicht sonderlich nassen Herbst, aber Menschen u. Angespann waren knapp u. so besahn [besann] ich mich noch einmal auf das Verfahren, das ich 1905 in Brodsack angewendet hatte. Ich setzte alle Kräfte ein, damit zunächst die Rüben aus der Erde herauskämen u. in 3 großen Mieten a 5000 Ctr zusammen gefahren wurden, pflügte dann, auch nach Brodsacker Vorbild, meinen ganzen Acker. Die Rüben lagen zu 2/3 hart an der Chaussee u. machte deren Abfuhr also keine besondern Schwierigkeiten, aber die letzten 5000 Ctr. lagen 1 Klm. Landweg von der Chaussee u. da kein Frost kommen wollte, holte ich mir von meinem Sohn Kurt, der seit 1929 in Kl. Lichtenau wohnte u. eine Feldbahn besaß, diese Feldbahn u. konnte damit auch ohne sonderliche Anstrengung meine Rübenernte beenden. 1942 hatten wir einen sehr kühlen Vorsommer. Folgedessen konnten wir erst am 15. August mit der Ernte beginnen. Ich hatte schon seit einigen Jahren einen Mähbinder u. 1942 einen kleinen 20 P.S. Traktor gekauft. Diese beiden Maschinen kamen mir jetzt ausgezeichnet zustatten u. mähten u. banden das ganze fast restlos stehen gebliebene Getreide, u. meine wenigen Leute hatten nur die Arbeit, aufzustellen u. einzufahren. Gedroschen wurde in diesem Sommer nichts vom Fuder, während sonst etwa die Hälfte vom Fuder gedroschen u. die Hälfte eingefahren wurde. Da alles mit Binder gemäht war, hatte die ganze Ernte in der Scheune Platz u. in 16 Tagen, einschließlich zweier Sonntage, war die ganze Getreideernte beendet. Ist mir niemals vorher gelungen. 1943 hatten wir eine gute Getreideernte u. eine außergewöhnlich gute Zuckerrüben, Zuckerrübensamen u. Gemüseernte. Die Zuckerrübenerndte wäre in diesem Jahre wieder schwierig geworden, wenn wir nicht die Pomritzpfüge u. Köpfschippen besessen hätten, die erst vor 2 Jahren bei uns eingeführt waren. Seit meinen ersten Wirtschaftsjahren hatten sich Bauern u. Fabrikanten bemüht, einen Apparat zu konstruieren, der das ausheben der Rüben, besonders aus verhärtetem Boden, ermöglichte. 1911 glaubte man, einen solchen Apparat erfunden zu haben. Er bestand aus einem starken Rahmen auf 4 Rädern, der 2 oder 3 große starke Gänsefüße trug, mit denen man 4 bis 6 Reihen Rüben zwar nicht ausheben, aber stark lockern konnte, so daß die meisten Rüben mit der Hand herausgezogen werden konnten, vereinzelt ungenügend gelockerte Rüben konnten aber auch leicht mit einem Rübenducker ausgehoben werden. Die Rüben wurden nicht geköpft, erlitten aber keine Beschädigungen. Aber der Apparat, der in einer Tiefe von 30 cm. durch den Boden gezogen wurde, brauchte soviel Kraft, daß Dampfpflugmaschinen dazu benötigt wurden, um ihn zu ziehen. Das war natürlich nur in Großbetrieben möglich. Außerdem war es ein großer Übelstand, daß der Boden so tief gelockert wurde. Bei nassem Wetter riskierte man, daß man die Rüben nur mit großer Mühe abfahren konnte, dagegen bei trockenem Wetter mit Wind u. Sonnenschein konnte man es erleben, daß die auf 8 Tage Vorrat gelockerten Rüben, in der Erde welk wurden u. gewaltig an Gewicht verloren. Ich habe beide Fälle erlebt, da ich ja auf Vorrat roden mußte, da mir der Apparat nur beschränkt zur Verfügung stand. Und doch habe ich es nach vielen Jahren noch einmal ganz Ende Oktober riskiert, diesen Vorratsroder zu benutzen, da ich sonst keine Möglichkeit sah, meine schönen Rüben ernten zu können. Und diesesmal glückte das Wagnis u. ich konnte alle Unkenrufe lieber Berufsgenossen lächelnd abtun.
Doch nun wieder zu meiner Rübenerndte 1943. Die Rüben wurden mit Köpfschippen, stellenweise auch mit Köpfschlitten, geköpft u. mit dem leichten Pommritzpflug ausgepflügt u. von einigen Mädchen zu Haufen geworfen. Heute macht eine Maschine in einem Gang das köpfen, roden u. auf den Wagen laden. Aber damals erschien uns die neue Erleichterung schon als märchenhaft u. weil der Boden so hart war, spannte ich 4 Pferde davor, die ich bei der Abfuhr einsparte, weil ich bei den schönen glatten Wegen zweispännig statt vierspännig fahren konnte.
Die Rübenernte brachte in diesem Jahr meine größte Ernte mit 820 Ctr. pr. ha und die Rübensamenernte 60 Ctr. pr. ha, die Gemüseernte rnd. 30 000 Mark. Da die andern Früchte ähnlich gute Erträge gaben, konnte mir im Dez. 1944 endlich das Resultat meiner steuerpflichtigen Einkünfte aus 1943/44 von der Buchstelle in Danzig mitgeteilt werden; es lautete: 61 000 Mark Einkommen u. 28 000 M. Einkommensteuer. 4 Wochen später ging alles verloren u. am 24.3.1945 gingen wir mit Handkoffer auf das Schiff, das uns am 28.3.45 wohlbehalten, aber total verarmt nach Warnemünde brachte.
Die Familie 1921-45
Bis 1920 hatte die große Familie noch keine erheblichen Kosten verursacht. Die Älteste Grete hatte schon 1912 ihr Examen als techn. Lehrerin gemacht u. im Dezember eine Stelle in Kirchheim [durchgestrichen: Bolanden] DobroluckLausitz[Kirchhain- Dobrilugk] angetreten, die sie etwa 1917 mit einer Stelle bei der höheren Mädchenschule in Marienwerder vertauschte. Else war in der Kriegszeit bei Tante Marie in billiger Pension u. machte 1918 ihr Lehrerinnenexamen, und die andern Kinder gingen in Dirschau zur Schule.
Aber 1920 wurde Dirschau polnisch und die Kinder mußten in Pension gegeben werden. Das war zeitweise recht teuer u. mir kam jetzt sehr zustatten, daß ich keine Schuldenzinsen mehr zu zahlen hatte. Und an die Schulen schlossen sich in 4 Fällen die Universitäten an u. die Ausbildung der übrigen Kinder war auch nicht umsonst, so daß die großen Einnahmen der Jahre 1920 bis 1935 zum großen Teil dafür verbraucht wurden. Aber ich kann es meinen Kindern bestätigen, daß keiner von ihnen sich über Gebühr auf den Ausbildungsstätten aufgehalten hat.
Aber trotz aller Kinderausgaben blieb immer noch soviel übrig, daß Vater sich auch noch recht oft eine Reise erlauben konnte und daß Mutter sich jetzt endlich auch einigemale daran beteiligen konnte.
1921 brachte ich Lotte in die Haushaltungsschule in Neustädtel in Schlesien u. fuhr von dort aus auf einige Tage nach Dresden u. in die sächsische Schweiz. Es war ein großer, lange entbehrter Genuß für mich u. wurde zudem noch vom schönsten Frühlingswetter begünstigt. Die Bahnfahrt von Neustädtel nach Dresden über Bautzen war schon sehr interessant u. erst recht die Dampferfahrt nach Wahlen u. der Spaziergang durch die eigenartigen Formationen des Kleinen Gebirges über Bastei u. Kuhstall zum großen Winterberg. Nach Übernachtung in Schandau kehrte ich am nächsten Tage nach Dresden zurück u. genoß noch ein paar Tage Dresden mit seinen wunderbaren Bauten u. Kunstschätzen, die allerdings noch nicht vollständig aus ihren Kriegsverstecken zurückgeholt worden waren. Der wunderbare Zwinger, Hofkirche, Grünes Gewölbe, Brühlsche Terrasse u. eine Fahrt nach Dresden-Loschwitz am jenseitigen Elbufer mit dem Sanatorium „Weißer Hirsch“ sind mir in Erinnerung geblieben u. auch ein Besuch im kgl. Schauspielhaus, wo „Jedermann“ gegeben wurde, das mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Ein Tagesbesuch in Leipzig, wo ich in Auerbachs Keller mein Mittagessen einnahm und dann zum imposanten Völkerschlacht Denkmal hinausfuhr, beendeten den Tag in Leipzig und nun drängte es mich doch, nach Hause zu kommen.
1922 war schon alles viel teurer geworden, aber das Wort „Inflation“ u. seine Bedeutung kannten wir damals noch nicht, aber, bevor ich fortfahre, möchte ich für Enkel u. Urenkel etwas darüber aufschreiben, was mich u. viele meiner Landsleute aufs tiefste bewegt und abwechselnd genützt und geschädigt hat.
Bis 1914 hatten wir die deutsche Goldmark u. Silbermark u. nur zur Geschäftserleichterung die Reichsbanknoten, die aber überall, auch im Ausland, anstandslos gegen Goldmark eingewechselt wurden. Bei Kriegsausbruch mußte sofort alles Goldgeld abgeliefert werden. Die Silbermünzen blieben einstweilen noch im Verkehr, wurden aber auch bald durch kleine u. kleinste Banknoten ersetzt. Trotz alledem hielt sich die deutsche Währung noch über den Krieg hinaus, aber 1922 wurde doch schon oft von Inflation gesprochen. Die Hauptgründe habe ich schon früher erwähnt. Für den Bauern, der ja immer von neuem Goldwerte in seinen Produkten erzeugte, war die Sache wenig gefährlich, wenn er von seinen Produkten immer nur soviel verkaufte, als er gerade für Haus u. Wirtschaft benötigte. Aber da konnten sich viele von der alten Gewohnheit nicht freimachen, ihre gesamte Ernte sofort zu verkaufen und das Geld auf die Bank zu bringen, ja eine, wenn auch kleine Anzahl, ließ sich sogar durch die „großen Grundstückspreise“ verleiten, ihren ganzen Besitz zu verkaufen u. sich zur „Ruhe“ zu setzen. Die Letzteren standen im nächsten Jahr vor dem Nichts, die Ersteren gerieten mindestens in erhebliche Zahlungsschwierigkeiten durch eine solche unüberlegte Handlung. Und 1923 waren wir, die wir trotz unserer Freistaatsherrlichkeit noch immer an der deutschen Mark festgehalten hatten, soweit, daß eine Goldmark mit einer Billion Papiermark bezahlt wurde.
Ich selbst u. auch viele andere Danziger, war schon 1922 dazu übergegangen, meine Produkte für U.S.A. Dollar zu verkaufen, was uns Liessauer1923 die Möglichkeit bot, uns elektr. einzurichten.
Dann kam im Herbst 1923 der Danziger Gulden, der sich auf das engl. Pfund stützte mit 25 Gulden = 1 Pfd. Deutschland bekam Anfang 1924 seine Rentenmark, die Goldwert hatte. Beide Vorgänge sind mir nie recht klar geworden. Von der deutschen Mark sagte man, daß Schacht, der frühere Reichsbankpräsident, sie durch gewisse Manipulationen mit Auslandwährung geschaffen habe. Wenigstens behauptete das Ausland später, daß Schacht die Ausländer maßlos betrogen habe. – Soll ihm von mir aus vergeben sein. – Auch die Polen, mit denen wir nun doch vielfach in geschäftlicher Verbindung standen, hatten sich im „Zloty“ eine neue Währung geschaffen, die unserm Danziger Gulden gegenüber aber immer wesentlich schlechter stand. Nachdem wir etwa 10 Jahre mit dem Gulden gut gewirtschaftet hatten, kamen die Nationalsozialisten ans Ruder. Sie hatten mit den ersparten Geldmitteln des Staates so verschwenderisch gewirtschaftet, daß über Nacht der Wert des Guldens auf den Wert das Zloty, also etwa um 30 Pf pr Gulden, heruntergesetzt werden mußte, was natürlich alle etwaigen Ersparnisse an Danziger Gulden auch entsprechend schädigen mußte. 1939, nach der Einverleibung Danzigs in den Reichsverband, wurde der Gulden auf 70 Pfennige RMark u. der Zloty auf 50 Pf bewertet.
Das war das hin u. her in den 19 Jahren unserer Freistaatherrlichkeit. Es hat manchen mühelos zum reichen Mann gemacht u. manchen wohlhabenden Rentner zum Bettler.
Ich selbst hatte mich durch diese Zeit durchjongliert, ohne neue Schulden machen zu müssen. Daß man seine Produkte für Dollar anstatt für R.Mark verkaufen mußte, hatte ich auch mindestens 1 Jahr zu spät begriffen.
1922 reiste ich mit meiner Familie in den Harz, wobei uns Vetter Rudolf Wiebe Gr. Lesewitz begleitete. Wir wohnten in Drei Ah[n]nen-Hohne am Fuße des Brockens u. machten Ausflüge in die Hermannshöhle bei Elbingerode u. durch das Bodetal von Thale nach Treseburg u. auf den Brocken. Meine Frau blieb dann in Ilseburg u. Rudolf u. ich fuhren nach Nürnberg zur Ausstellung u. am Schluß der Nürnberger Tage machten wir noch einen Ausflug der Dt. Landw. Gesellschaft in den Ochsenfurter Gau zu Heil Gelchsheim nach Erbachshof u. Gnötzheim mit, überall freundlich aufgenommen u. gastfrei bewirtet. Gelchsheim war die Zuchtstätte der Frankengerste, die damals bei uns in Aufnahme kam, u. Gnötzheim hatte ¼ seines etwa 125 ha großen Landbesitzes mit fränkischer Luzerne bestellt, die bei uns immer sehr begehrt, aber nie zu bekommen war. Erbachshof war Kammergut. Bevor wir uns in Würzburg von unsern Reisegefährten trennten u. nach dem Harz zurück kehrten, besichtigten wir noch das bischöfliche Schloß daselbst, einen der vielen sehenswerten Barockbauten mit wundervollen Wandgemälden u. konnten uns an einer Weinprobe im Schloßkeller beteiligen. Am nächsten Morgen waren wir wieder in Ilseburg. Nachdem wir gut ausgeschlafen u. meine liebe Frau zur Bahn gebracht hatten, sie fuhr nach Berlin zu meinen Geschwistern voraus, machten wir noch mit etwa 10 Danzigern Besuche in der Nähe von Halberstadt auf den Gütern Mahndorf (Erbsenzucht), Strube Schlanstedt u. Emersleben u. fuhren dann auch nach Berlin u. am nächsten Tage nach Hause.
1923 fuhren wir beide mit dem Ehepaar Konrad Berendt auf 14 Tage nach Breslau u. ins Riesengebirge, wo wir in Oberschreiberhau Zimmer bestellt hatten. Wir hatten sehr schöne Tage in Oberschreiberhau, machten auch einige Ausflüge zur Talsperre Mauer u. (mit Pferdefuhrwerk) auf den Riesengebirgskamm u. zur Schneegrubenbaude. Ganz in der Nähe die Elbquelle. Während die andern drei am Abend nach Schreiberhau zurückkehrten, übernachtete ich auf der Baude (1500 m hoch). Es war erbärmlich kalt u. ich brach in aller Frühe auf, um zur Schneekoppe zu wandern. Hatte auch gute Sicht von der Koppe u. stieg dann hinunter durch den Melzergrund nach Krummhübel, wo ich den Omnibus erreichte, der mich nach Schreiberhau zu meiner Frau und meinen Reisegefährten zurückbrachte. Den Rückweg machten wir wieder über Berlin, wo Konrad für ein Frühstück schon ¼ Million bezahlen mußte. – Die Inflation war in vollem Gange u. wir machten schleunigst, daß wir nach Hause kamen.
Noch ein paar Blüten aus dieser Zeit: Ein Bauer von 50 ha. im großen Werder war im Frühjahr 1923 abgebrannt u. hatte den Umbau seiner Gebäude sofort mit einem Baumeister fest abgemacht. Er zahlte im Herbst die ganzen Baukosten aus dem alten Eisen der Brandstelle. Ein anderer war einige Monate später abgebrannt u. konnte seine Gebäude nicht mehr aufbauen. 1924, als wir schon den Danziger Gulden hatten, ergab sich zuerst die Schwierigkeit, den Wert der Produkte auf die neue Währung abzustimmen. Manche verkauften ihren Weizen mit 4-5 M. pr Ctr. Ich wartete einige Monate ab u. erhielt etwa das doppelte.
Als die erste große landwirtschaftliche Ausstellung in Danzig im Mai 1924 veranstaltet wurde, zu der ich wieder gemeinsam mit meiner Frau gefahren war, da hatte sich der Danziger Gulden schon eingependelt u. wir haben uns an dem schönen Bild erfreut, das eine unerwartet große Zahl von prächtigen Tieren aller Art boten. 1924 war, wie ich schon mehrfach erwähnte, ein spätes Frühjahr nach einem riesigen Weichselhochwasser, aber wir hatten eine besonders günstige Witterung bis in den Herbst u. eine durchweg gute Ernte.
1925 suchte ich zum erstenmal wegen Verdauungsbeschwerden ein Bad, Kissingen, auf, nachdem ich noch vorher die Ausstellung in Stuttgart mit einem Ausflug nach Tübingen besucht hatte. Auch diese Fahrt über Böblingen, Schaichhof u. Bebenhausen verlief sehr zufriedenstellend, aber ich konnte in Stuttgart keine Landsleute treffen u. so machte ich mich schon etwas früher wie beabsichtigt auf den Weg nach Kissingen, wo ich Landsleute traf, wodurch die mancherlei Spaziergänge in Kissingen wieder reizvoller wurden. Den Heimweg nach Berlin u. nach Hause nahm ich über Eisenach u. besuchte Reuters Grab u. die Wartburg. Das herrliche Wetter machte mich wohl noch empfänglicher für die schöne thüringische Landschaft, die mir besonders vom Lutherzimmer aus auffiel. Den Abstieg von der Wartburg machte ich nach der hintern Seite über die steile, leicht unzugänglich zu machende hohe Treppe.
1926 fuhr ich mit einigen Freunden aus der Heimat zur Ausstellung nach Breslau u. machten wir auch gemeinsam den Ausflug nach der Herrschaft Rohnstock am Fuße des Riesengebirges, dem Grafen Hochberg gehörig, mit. Die Gastfreundschaft war auch hier groß, was schon etwas sagen will, wenn man bedenkt, daß etwa 80 Männerchendaran teilnahmen. Die Wasserburg mit Wasser in den Gräben u. einer regelrechten Zugbrücke, der alte 80jährige Graf mit Sohn u. Enkel u. nicht zuletzt das Sektbowlenfrühstück für 80 Menschen boten einen durchaus feudalen Charakter, was sich auch in den auf Spitzbögen gewölbten Viehställen ausdrückte. Der Garten, wenigstens ein Teil desselben, war noch ganz in dem Stil erhalten, den er zur Zeit Friedrichs des Großen, der hier einmal übernachtet haben soll, gehabt hat.
Vom Rohnstock gingen wir noch verabredungsgemäß auf ein paar Tage in das Riesengebirge. Krummhübel, Kirche Wang, Teichbaude/Koppe, von der wir ganz herrliche Sicht bis nach Breslau hatten, waren die ersten Etappen. Auf der Koppe gesellten sich noch 3 Ehepaare aus der Heimat zu uns u. wir machten uns auf den Weg nach Spindelmühle, tschechisches Gebiet, wo wir übernachten wollten. Das geschah auch an verschiedenen Orten, aber als wir am nächsten Morgen bei strömendem Regen aufwachten, da war kein Halten mehr für die Gesellschaft. Nur raus, raus aus der Tschechei u. sofort nach Hause. Ich selbst hatte wenig Lust zu diesem überstürzten Rückzug, aber wenn ich nicht allein bleiben wollte, mußte ich mich fügen u. nachdem wir uns bis zur Spindlerbaude hatten mit Auto hinauf fahren lassen, [musste ich] den etwa 4 stündigen Fußweg, immer bergab, bis Hirschfeld antreten. Da taten meine Füße aber ordentlich weh. Nach einer kurzen Ruhepause in Hirschfeld ging es geradenweges nach Hause, wo wir wohlbehalten am nächsten Morgen ankamen.
1927 hatten Lotte u. Hans Penner im Juni Hochzeit, aber nach derselben machten etwa 10 Danziger Herren, darunter auch ich u. mein Schwiegersohn Hans, einen Ausflug nach Cujawien, dem jetzt polnisch gewordenen, hoch entwickelten Gebiet, das auch jetzt noch überwiegend in deutscher Hand war. Etwa 5-6 Güter haben wir dort besichtigt, darunter auch ein Gut in polnischem Besitz, dessen Eigentümer besonders stolz auf seine Rübensamenzucht war. Von deutscher Seite sind mir nur die Namen von Heidebreck u. Fhr. von Willamowitz-Möllendorf u. Baron Rosenstiel in Erinnerung geblieben. Was aus ihnen nach dem II. Weltkriege geworden ist, weiß ich nicht.
1928 u. 29 bin ich dann noch 2x in Altheide Grafschaft Glatz zur Kur gewesen, aber ich war nicht bettlägerig krank u. habe neben der Kur auch recht oft Ausflüge in die nähere u. weitere Umgebung gemacht u. bin so nach Glatz, Reinerz, Kudowa u. Bad Langenau gekommen, auf einigemale in den damals noch ganz deutschen Teil Nordböhmens u. zum Winterberg oder Schneeberg u. der Heuscheuer.
1929 heiratete Kurt seine Ruth u. ich kaufte zur Hälfte mit Kurt von Friedrich Gr. Lichtenau einen 95 ha. großen Hof. Dieser Kauf hat mir viel Sorge gemacht, ist aber nach Jahren erheblicher Spannung zwischen Friedrich u. mir zu einem guten Ende geführt.
In der 2ten Sommerhälfte 1929 war dann am 15 Oktober 1929 die Hochzeit.
1930 war ich zur Kur in Oeynhausen u. habe auch von hier aus gerne ein bis’chen in die Umgebung geschaut und bin dabei nach Münden mit seinem imposanten Übergang des Mittellandkanals über die Weser u. dem dazu gehörigen Schiffshebewerk, welches 18 m Höhenunterschied überwindet [, gekommen]. Ich bin dann auch nach Bad Eilsen, nach Bückeburg, nach Detmold, in dessen Nähe das Hermannsdenkmal berühmt wurde, u. nach Pyrmont u. Salzuflen, sowie nach Hameln gekommen.
1931, 32 u. 33 war ich mit meiner Frau je etwa 3 Wochen in Oliva, was uns beiden sehr gut getan hat u. wobei wir erst jetzt die Schönheiten des uns so nahe gelegenen Oliva recht kennen lernten u. immer sehr befriedigt nach Hause kamen. 1933 war ich mit meiner Tochter Lena u. Tante Idchen aus Gr. Lesewitz nach Berlin zur Ausstellung gefahren. Der Nationalsozialismus hatte in Deutschland schon die Macht ergriffen, aber in den ersten Jahren war der privaten Initiative noch etwas Raum gelassen u. so konnten die vorgesehenen Ausflüge noch größten teils ausgeführt werden. Ich selbst machte mit beiden Reisegefährten u. Nichte Anneliese Fieguth den Ausflug in den Spreewald mit, auf dem wir mit der Bahn bis Lübbenau u. dann auf gestakten Kähnen durch den Spreewald fuhren u. auch auf einer kleinen Insel mit einem für Ausflügler eingerichteten Gasthaus zu Mittag assen. Er ist doch eine sehr eigenartige Landschaft, dieser Spreewald. Die gärtnerisch genutzten Flächen befinden sich wohl zumeist am Rande des Spreewaldes, jedenfalls wurden uns dort die großen Gurkenfässer u. die Meerrettiganlagen gezeigt. Die Boote, deren Bedienung wohl eine Haupteinnahme der Spreewälder Bauern ist, werden mit einem langen Ruder vorwärts gestoßen; die Kanäle sind flach u. haben durchweg sandigen Untergrund. Bei dem schönen Wetter machte die ganze Bootsfahrt Spaß, aber für die Männer u. besonders die älteren, war es doch eine anstrengende Arbeit u. so Tag aus, Tag ein im Wasser zu sitzen, würde mir doch nicht behagen. An einem weiteren Tage machte ich noch eine Fahrt zu dem berühmten Roggen u. Haferzüchter von Lochow, Petkus, mit. Man muß staunen, was die Familie v. Lochow aus dieser Sandbüchse gemacht hat, aber trotzdem noch viel Strohdach vorhanden war, aus dem getäfelten Speicherraum, in dem auch die großzügige Bewirtung der etwa 80 Gäste stattfand, konnte man doch entnehmen, daß die Sache etwas eingebracht hatte.
1934 war ich in Frankfurt a.M. zur Ausstellung u. konnte meine Erinnerungen aus dem Jahre 1908 noch einmal auffrischen. Palmengarten, Römer, Paulskirche wurden noch einmal aufgesucht u. auch eine Äppelwoi Kneipe, aber ich konnte mich für Äppelwoi nicht begeistern. Die früher so zahlreichen Omnibusausflüge waren schon sehr eingeschränkt, aber einen, der uns das schon in der Ausstellung angepriesene neue Dorf Riedrode bei Darmstadt vorführen sollte, machte ich doch mit. Zuvor ging die Fahrt auf einer der neuen Autobahnen nach Heidelberg u. auf dem Rückwege dann die Bergstraße entlang über Darmstadt nach Frankfurt zurück. Bei Darmstadt bog der Omnibus nach dem Rhein zu ab u. nach etwa 3 klm. Fahrt waren wir in Riedrode. Na, so kraß, wie ein anderer Fahrtteilnehmer die Anlage beurteilte, will ich mich nicht ausdrücken, wenn er sagte: „Hier ist Malz u. Hopfen verloren“!, aber sehr verlockend sah der Anfang nicht aus. Es waren zwar alles neue nette Gehöfte, etwa 20 an der Zahl. Aber der Acker war wahrscheinlich erst kurz vor der Bestellung gepflügt u. nachdem war der Regen ausgeblieben u. da kann man sich mit wenig Phantasie den Stand der Felder vorstellen. Die neuen Siedler, die von Oberhausen oberhalb Kassel herkamen, waren durchaus nicht entmutigt.
1935 fuhr ich mit meiner Frau nach Hamburg zur Ausstellung u. auch zum Besuch der Familie Lange. – Frau Lange war eine Schulfreundin meiner Frau. – Die Ausstellung fand besonders bei meiner Frau, die solche Ausstellungen seit 1924 in Danzig nicht mehr gesehen hatte, großes Interesse u. auch die Spaziergänge durch die große Stadt, wo Langes oft den Führer machten, desgl. die Fahrten auf der Elbe u. der Binnen u. Außenalster, zum Ohlsdorfer Friedhof u. besonders dem Hagenbeckschen Tierpark in Stellingen. Dann nahm ich noch mit meinem Sohn Ernst, der damals gerade in Oldenburg in Stellung war, an einem zweitägigen Ausflug durch die Westseite Schleswig-Holsteins teil. Die Fahrt führte über Neumünster u. Friedrichstadt nach Husum, wo wir übernachteten u. am andern Tage über Melle[n], Heide, Brunsbüttelkoog nach Hamburg zurück. Es wurde auf etwa 10 Stellen Station gemacht u. Höfe, Ländereien u. Anlandungs-Unternehmen in allen Stadien der Entwickelung besichtigt. Es war nur doch alles sehr neu, die Art u. Weise, in der ein neuer Koog entsteht, die ersten Arbeiten, die nach Schließung des neuen Deiches vorgenommen werden. Die sehr fruchtbaren Marschen mit ihren nicht sonderlich sympatischen Bauern, den Ulen, wie sie Frennren [?] nennt u. der, von unzähligen Knick’s durchzogenen, weniger fruchtbaren Geestländereien, deren Bewohner mir erheblich liebenswürdiger vorkamen, die Kreyen. Und so kraß, wie der Charakterunterschied der Bewohner, war auch das Landschaftsbild. Aber als wir am 2ten Tage Abends in Hamburg landeten, konnten wir dem Dipl. Landwirt, der uns geführt hatte, das Zeugnis ausstellen, daß die Reise glänzend organisiert gewesen wäre.
1936 hatten Ernst u. Christel Hochzeit und dieses Ereignis beherrschte das Jahr 1936.
1937 war ich mit meiner Frau nach Altheide ins Bad gefahren. Diesesmal war meine Frau die Erholungsbedürftigere, aber ich ging auch diesesmal gerne mit. Wir hatten gute Pension mit lieben Menschen angetroffen u. da auch meine Frau nicht bettlägerig krank war, haben wir auch diesesmal die schöne Umgebung besucht. Die Heuscheuer hatte ich aus meinen früheren Besuchen noch nicht kennen gelernt. Mit etwa 6 oder 7 andern Badegästen machte ich auch eine Omnibusfahrt über Nachod u. Königgrätz nach Prag mit. Es war eine recht anstrengende, aber auch lehrreiche u. von schönstem Wetter begünstigte Reise. Aber die Stimmung in Böhmen war schon etwas gereizt gegen die Deutschen. Wir sind aber nicht belästigt worden u. die Fahrt durch das fruchtbare Böhmen mit seinen Erinnerungen an 1866 u. die Rundfahrt mit Stadtomnibus u. deutschsprechendem Führer, die uns zu vielen Sehenswürdigkeiten u. auch am Wallensteinpalais vorbei auf den Hradschin führte, war wundervoll. Da haben wir lange an der Mauer gestanden u. auf das tief unter uns liegende goldene Prag geschaut. Ein unvergeßlicher Blick im Abendsonnenschein. In der Kirche des Hradschin zeigte man uns noch einige, gut faustgroße, Kanonenkugeln, die dort zum Andenken an die Belagerung Prags durch Friedrich den Großen aufgehängt waren. Als besondere Sehenswürdigkeit wurde uns in der Stadt der Judenfriedhof u. die älteste Synagoge Europas gezeigt, die zunächst einmal ein Kellergelaß gewesen u. später mit einem Stock über der Erde verschönt ist. Die Grabsteine auf dem Friedhof standen oft zu 4 u. 5 dicht hintereinander, was mit dem engen Raum u. dem Glauben der Juden, daß keine Begräbnisstätte geräumt werden darf, zusammenhängen wird. Mitten in der Nacht u. todmüde, aber doch sehr befriedigt, kamen wir nach Altheide zurück.
1938 suchten wir noch einmal im Interesse meiner Frau das Bad Nauheim auf. Auch hier hatten wir in einer kleinen Pension sehr nette Kurgäste gefunden, was mich, wie auch im Vorjahr in Altheide, für meine, etwas schüchterne Frau, besonders freute.
Für unsere gemeinsamen Ausflüge blieben wir in der Stadt u. ihrer nächsten Umgebung. Ich selbst bin dann auch etwas weiter in die Umgebung, in die Wetterau u. das benachbarte Friedberg, gegangen und zum Abschluß unserer Kur machten wir noch gemeinsam eine kombinierte Omnibus u. Dampferfahrt am u. auf dem Rhein mit, die uns über Wiesbaden, Rüdesheim mit Niederwalddenkmal u. von Assmannshausen bis Niederlahnstein per Dampfer nach Koblenz führte, wo wir wieder den Omnibus bestiegen. Nachdem uns der Omnibus noch an das Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I auf dem deutschen Eck an der Moselmündung gefahren hatte, traten wir den Rückweg durch das schöne Lahntal an u. machten nur noch einmal in Limburg Halt, wo einige Gäste die Stadt besichtigten. Ich aber stieg hinauf zu dem weißen, weit ins Land strahlenden Dom. Meine Frau blieb schon im Omnibus sitzen, schon recht müde, aber doch recht froh, daß sie auf ihre alten Tage auch noch einmal an den Rhein gekommen war. Auf dem Heimweg machten wir, wie üblich, noch bei unsern Geschwistern in Berlin – Gr. Lichterfelde Ost, Station.
1939 standen wir schon vom 1. Juli ab unter der Kriegsdrohung. Am 1.7. wurde mein Wirtschaftsgehilfe Wölke auf unbestimmte Zeit zu einer Übung einberufen u. von da ab habe ich meine Wirtschaft wieder ohne männliche Hilfe geführt, fand aber schon 1942 an meiner jüngsten Tochter Lena eine bereitwillige u. verständnisvolle Helferin.
Am 1.9.1939 morgens zwischen 4 u. 5 Uhr weckte uns furchtbares Flugzeuggeräusch über unsern Köpfen u. Geschützdonner, von dem wir nicht wußten, woher er kam. Wir flüchteten zunächst in den Keller. Meine verheirateten Leute aber kamen mit Kind u. Kegel auf den Hof gestürzt, rissen sich jede Familie ein paar Pferde aus dem Stall, luden ihre wenigen Sachen u. Kinder auf die Wagen u. fuhren davon. Um etwa ½ 6 Uhr morgens wurden von den Polen die beiden großen Weichselbrücken Liessau-Dirschau gesprengt. Jetzt wußten wir, daß die Deutschen die Angreifer waren u. daß uns von den Polen kaum noch Gefahr drohe. Es war auch bisher kein Artilleriegeschoß zu uns herübergekommen. Die Polen schossen nur mit Maschinengewehren, wobei aber bei Erzwingung des Übergangs über die Weichsel 6 von unsern braven Soldaten getötet u. 12 verwundet wurden. Das Artilleriefeuer kam von Gr. Lichtenau, wo in der vergangenen Nacht Artillerie in Stellung gegangen war. Am Abend des Tages war Dirschau in deutscher Hand. Die gesprengte Eisenbahnbrücke wurde zwar in 3 Monaten wieder aufgebaut, aber die Fuhrwerksbrücke wurde nicht mehr aufgebaut u. der Verkehr nach Dirschau wurde sehr behelfsmäßig übereine Fähre etwa 1 klm unterhalb der Eisenbahnbrücke durchgeführt.
Wir hatten nun während des Krieges wenig davon gesehen u. hatten auch aus Polen genügend Arbeitskräfte, so daß wir unsere Felder fast friedensmäßig bestellen konnten. Aber wir waren nun doch alt geworden u. mußten beide einigemale das Marienkrankenhaus aufsuchen. Ich selbst war 1942 etwa 4 Wochen in Danzig u. 1943 8 Wochen u. als ich nach Hause kam, feierten wir, schon recht bescheiden, unsere goldene Hochzeit. Uns beiden Jubilaren war auch nicht sehr nach feiern u. wir zogen uns zurück, bevor die Gäste das Haus verließen u. glaubten nicht mehr an viele Erdentage, aber das schlimmste stand uns noch bevor. Am 24. Januar mußten wir unsere Heimat verlassen u. alles im Stich lassen, was wir uns in 52 Wirtschaftsjahren geschaffen hatten. 2 Jahre hielt meine liebe Frau dieses Flüchtlingsleben noch aus, dann schloß sie am 26. Februar 1947 die müden Augen für immer. Ich aber zog 1948 aus Flötz Kreis Zerbst, wo meine Frau gestorben u. auch begraben ist, meinen Flüchtlingsweg weiter u. habe zunächst mit meiner jüngsten Tochter Lena 3 ½ Jahre in dem Dorfe Leeste bei Bremen gewohnt, wo uns Liesbeth aufgenommen hatte. Dann wohnen wir seit August 1950 hier in Hannover bei meiner Tochter Else. Aber wenn ich geglaubt hatte, daß meine Wanderlust in der Heimat erloschen wäre, so hatte ich mich geirrt u. sofort, nachdem ich nach Leeste gekommen war, also nach Westdeutschland, begab ich mich [sofort] auf die Suche nach Verwandten u. Bekannten. Ich suchte meine Kinder Lotte u. Hans Penner in Alfeld, meinen Sohn Hans Hermann u. Frau in Oeynhausen, meine Tochter Grete u. Frl. Bänfer in Stade, meinen Vetter Mekelburger u. Freund Dyck früher Ladekopp in der Lüneburger Heide, Nichte Irmgard Neugebauer u. Familie in Varel am Jadebusen u. Nichte Annemarie Fieguth in Brake bei Oldenburg, auf u. auch einen Neffen Hermann Fieguth in der Heide. Diese Besuche schaffte ich noch vor der Währungsreform, denn nach derselben war uns das Geld sehr knapp geworden. 1950, als uns Flüchtlingen einige Vergünstigungen bei Bahnfahrten u. auch eine kleine monatliche Rente zugebilligt waren, faßte ich sogar den kühnen Entschluß, meinen jüngsten Schwager Heinrich Penner u. dessen 2te Frau, mit der wir aber immer sehr gut harmoniert hatten, im Altersheim in Leutesdorf a. Rhein aufzusuchen u. war auch bei meiner Nichte Hilde Effertz geb. Wiebe in Fliesteden bei Köln u. diese Besuchsreisen an den Rhein habe ich noch 1951 u. 1954 wiederholt. War 1954 sogar noch bei einem Dampferausflug auf Mosel u. Rhein, gelegentlich eines Aufenthaltes in Braubach zu der, hart über Braubach liegenden Marksburg hinauf geklettert. Und so habe ich in meinen alten Tagen auch etwas Nordwestdeutschland kennen gelernt, das mir, trotz meiner vielen Reisen, bis dahin fremd geblieben war; abgesehen von einer kurzen Reise nach Ostfriesland mit einigen Mitgliedern der Herdbuch Gesellschaft in der Mitte der zwanziger Jahre.
So habe ich nicht gerade die Welt, aber mein deutsches Vaterland kennen gelernt.
Aber im Sinne meines sparsamen Vaters war diese Lebensweise gewiß nicht. Er hätte mich mit seinen gütigen Augen sicher strafend angesehen, wenn ich ihm gebeichtet hätte, daß ich recht viele Tausender für meine 10 Kinder ausgegeben hätte u. auch einige für mich u. meine Reiseleidenschaft, die sich übrigens glänzend auf meine Nachkommenschaft vererbt hat.
Und nun werden wir übermorgen im engsten Kreise, zu dem wohl nur einige Töchter zählen werden, meinen 86. Geburtstag feiern, so Gott will.
Mehr als dreißig Jahre lang waren das rauschende Feste in Liessau u. an besonde[ren] Werktagen, wie 70. oder 75. Geburtstag oder goldenem Hochzeitstage, waren auch meine Nachbarn am Vormittag erschienen, die immer treu zu mir gestanden haben. Aber dann wurde es stiller u. stiller um mich. Meine Geschwister waren bis auf Schwester Agathe schon alle vor dem II. Weltkrieg gestorben. Aus meiner Generation nahmen an unserer goldenen Hochzeit nur noch die Schwester meiner Frau, Tante Mariechen aus Marienwerder, meine Schwester Agathe mit ihrem Manne Johannes Fieguth u. mein jüngster Schwager Heinrich Penner mit seiner 2ten Frau teil.
Und dann kam 1 ½ Jahre danach das bittere Ende am 24. Jan. 1945. Schwester Agathe u. ihr Mann fuhren am Abend vorher von Dirschau ab nach Berlin u. sind seitdem spurlos verschwunden, Tante Marie aus Marienwerder kam auf ihrer Flucht noch bis Pommern u. starb dort etwa Ende Februar, von den Russen gehetzt u. auf freiem Felde, ohne Sarg beerdigt.
Ich bin meinem Schöpfer ewig dankbar, daß er meiner lieben Frau u. mir solch gräßliches Erleben erspart hat. Wir haben nie einen Fliegerbeschuß u. brennende Trümmer über uns erlebt u. auch keine Schiffskatastrophe, wie sie sich besonders grauenhaft im Untergang der „Gustloff“ auswirkte, wo 5000 Landsleute ums Leben kamen.
„Keine Schwalbe bringt, keine Schwalbe bringt
Dir zurück, worum du weinst.
Doch die Schwalbe singt, doch die Schwalbe singt
Im Dorf, wie einst!“
Hannover d. 3. März 1955 Hermann Wiebe
Inhaltsverzeichnis
| Vorwort | S. 1-7 | |
| Kap. I | Entwässerung und Besiedlung | 8-45 |
| II | Verkehr | 46-53 |
| III | Wirtschaftsweise der Bauern | 54-91 |
| IIII | Bauten | 92-109 |
| V | Kulturelles | 109-124 |
| VI | Dorfjugend – Mitte des 19. Jahrh. | 125-133 |
| VII | Kleidung | 134-149 |
| VIII | Freistaat Danzig | 150-158 |
| IX | Dammbruch bei Jonasdorf | 159-207 |
| X | Großväter Peter Wiebe u. Jacob Wienz | 209-248 |
| XI | Meine eigene Wirtschaftszeit | 250-372 |
Wohnorte meiner Familie in der Zeit von 1750-1945
Mierauerwald Freienhuben Schönsee
Herrenhagen Ladekopp Irrgang Gr. Lesewitz
Kl. Lesewitz Kaminke Marienau Brodsack
Liessau Kl. Lichtenau Trampenau
Siebenhuben Orlofferfeld Tiegenhagen Susewald
Beiershorst Schönhorst Neuteich Pordenau
Czattkau Gutsch Pastwa Kl. Schadau Gr. Schadau
Gr. Bandtken Gr. Ottlau Johannisdorf
Marienfelde Patschkau Sandhof Tiege
Tiegenhof Neuteich Neuteichsdorf Reimerswalde
Abgunstkampe Rückenau Fürstenau Lindenau
Halbstadt Marienburg Stadtfelde Kalthof